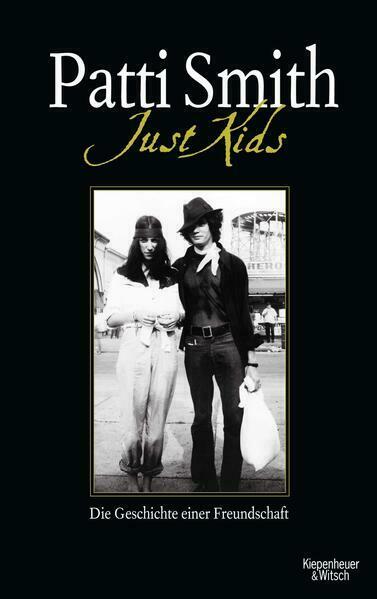Am Abgrund geht die Sonne auf
Matthias Dusini in FALTER 22/2010 vom 02.06.2010 (S. 22)
Gleich mehrere Schauen widmen sich einem der spannendsten Kapitel der neueren Kulturgeschichte: dem kaputten New York um 1980
Welch grandioses Angebot für den New-York-Flaneur: Er kann durch Brandruinen schlendern oder einem Raubüberfall beiwohnen, ein Schwätzchen mit seinem Dealer halten oder dem Graffitikünstler Fab 5 Freddy beim Sprayen zuschauen. Ein Model in einem Cabriolet fragt den Bummler, ob er zu ihm ziehen möchte. Dann schaut er im Tonstudio vorbei, wo Arto Lindsay gerade seine Gitarre würgt.
Am Abend geht er in den Mudd Club, wo die Discoband Kid Creole and the Coconuts auftritt. Wenn die Obdachlosen sich dann ihre Pappkartons überziehen, erscheint dem müden Spaziergänger Debbie Harry als gute Fee. Warum gerade ihm? Weil er Jean-Michel Basquiat ist, ein 22-jähriger Hipster auf dem besten Weg, die Kunstwelt zu erobern.
Glenn O'Briens semidokumentarischer Film "Downtown 81", der demnächst in der Kunsthalle Wien zu sehen sein wird, versammelt alle Motive, die New York City um 1980 zu einem magischen Ort machten: Absturz und Hedonismus, Verbrechen und Gemeinschaft, Verweigerung und Kreativität. In den Ruinen der Metropole blühten Post-Punk, Hip-Hop und Garage House, neoexpressionistische Malerei und ein neues, direktes Kino.
Gleich mehrere Wiener Institutionen widmen sich den mythischen Jahren von New York City, in denen zwischen radikalem Underground und kommerzialisiertem Hype oft nur wenige Monate und Häuserblocks lagen. Der Walk on the Wild Side beginnt im Österreichischen Filmmuseum, wo eine Reihe von "No Wave"-Filmen zu sehen sind.
Vielleicht geht der Begriff "No Wave" auf ein Fanzine namens NO zurück, vielleicht, vermutet Kurator Christian Höller, sei er aber ganz allgemein dem ausgeprägten Negationsgeist von Musikern wie Lydia Lunch oder Arto Lindsay geschuldet, die 1977 begannen, auf die Antihaltung, die Punk dem etablierten Kulturbetrieb entgegenbrachte, ein noch viel radikaleres "Nein" draufzusetzen. "Sie griffen zu den Gitarren und wir zu den Kameras", beschreibt Eric Mitchell das Do-it-yourself-Ethos der Szene.
Aus Frankreich stammend und ab 1975 in New York wohnhaft war Mitchell einer der Protagonisten des Super-8-Undergrounds, dem die formalen Experimente des strukturellen Films zu öde waren. Man drehte billige Filme über planetare Verschwörungen, kaputte Beziehungen oder hielt einfach nur die Kamera aufs räudige Jetzt. Treffpunkt war Mitchells "New Cinema" – ein Videobeamer genügte, um die auf Video kopierten Kurzfilme zu projizieren. "Es schaut alles aus wie eine einzige verzerrte, rosa Suppe", beschrieb eine Kritikerin der Village Voice das filmische Angebot.
Während die Musik der Zeit durch den Sampler "No New York" (1978) abrufbar ist und die Band Sonic Youth das Erbe von Noise als produktiver Zerstörung bis heute am Leben hält, sind die entsprechenden Zeugnisse rotzigen Filmemachens weitgehend in Vergessenheit geraten. Nur Jim Jarmusch, in dessen Debüt "Permanent Vacation" (1980) ebenfalls ein junger Mann durch Manhattan treibt, war eine echte Filmkarriere beschieden. "Denen ist noch heute nicht ganz geheuer, was da abging", schildert Höller seinen Eindruck bei der Recherche unter den heute als Buchdrucker, Professoren oder Maler arbeitenden Veteranen. Der intensive Gebrauch von Drogen trug einiges zum Gedächtnisverlust bei.
Weit musste man nicht gehen, um Bilder für eine Gesellschaft zu finden, der nach '68 der Glaube an die Revolution des Guten abhanden gekommen war. Coleen Fitzgibbon hält in "L.E.S." (1976) den Verfall der Lower East Side fest, ein überwiegend von Puerto-Ricanern bewohntes Viertel im Südosten Manhattans. Die Steuern waren höher als die Mieterträge, sodass die Eigentümer die Häuser nicht instand hielten.
Die Stadtverwaltung war pleite, die Sozialausgaben wurden gekürzt. Graffitis sollten die verwahrlosten Fassaden und U-Bahn-Züge verschönern. Werkstätten wurden abgesiedelt, der Flugverkehr nahm dem Hafen seine Funktion, die Mittelschicht flüchtete in die Vorstadt. So entstand der Freiraum für die Boheme.
"Es gab Gegenden in der Lower East Side, die aussahen wie Filmszenen aus dem Wien des Dritten Mann', so als wären sie vor kurzem bombardiert worden", erinnert sich Glenn O'Brien. Die Armut war sexy genug, um Künstler aus der Provinz anzuziehen. Der Mythos der kreativen Stadt, in deren Ruinen sich junge Selbstverwirklicher einnisten, wurde während des Anti-Golden-Age von New York City geboren. Die Galerien, der neue Musiksender MTV, die Musik- und Modeindustrie packten die Authentizität der Straße dann in ihre eigenen Formate.
"Eigentlich habe ich morgen Schule", sagt die Schauspielerin Brooke Shields, in einem Nobelrestaurant in einer Runde von New Yorker Celebrities sitzend; auf dem Tisch stehen Flaschen mit Perrier-Wasser und Moët-Champagner. Sie hat eine Föhnfrisur und einen glossy Lippenstift; sie ist sooo süß. Das ist das New York der 80er-Jahre, die Stadt des Kunstmarktbooms und der Markencoolness, von Fiorucci und der Gloria-Vanderbilt-Jeans.
Im Museum moderner Kunst (Mumok) kann man im Rahmen der Ausstellung "Changing Channels" (nur noch bis 6.6.!) in diese Atmosphäre eintauchen. Eine ganze Etage ist den TV-Magazinen Andy Warhols für das New Yorker Kabelfernsehen und MTV gewidmet. Hier kommen alle vor: die junge Madonna und der Graffiti-Künstler Futura 2000, der Galerist Tony Shafrazi und die Jungstars, an denen noch die Eierschalen des Undergrounds klebten.
Frisuren und Schuhe – Ballerinas, Sneakers, Pumps – sind ebenso wichtig wie der angesagte Club und der Kunsthype. Alle wollten zu Andy. Grandiose Upper-Class-Gestalten wie die Modejournalistin Diana Vreeland ebenso wie die Jungs aus den Schwulendiscos. Trend und Scout in einem, fungierte Warhol als Mäzen und Makler der Szene. Seinen Lieblingen Keith Haring und Jean-Michel Basquiat widmet die Kunsthalle Wien gleich zwei Ausstellungen.
Im Getümmel der Stile und Attitüden schätzte man am anderen das, was man selbst nicht war. Haring sah im Privatschulabsolventen Basquiat den Black-Ghetto-Abkömmling, Basquiat seinerseits bewunderte Harings Graffitiqualitäten, obwohl der Kunststudent sich mit experimenteller Lyrik beschäftigte und nur selten zur Spraydose griff. Die Ambitionen von beiden lagen aber ohnehin nie außerhalb der Kunstwelt: "Basquiat und Haring waren die Ersten, die Kunst auf der Straße in der Hoffnung machten aufzufallen. Außen malen, um innen Ausstellungen zu kriegen", sagt Glenn O'Brien.
Die beiden lernten sich kennen, als sich Basquiat in den Hof von Harings Kunstschule schlich, um dort eines seiner Haiku-artigen Mauergedichte anzubringen. Sein Künstlername SAMO war da schon ein Begriff. Dann nahm die Kunstwelt auch von seinen Zeichnungen und bemalten Holztafeln Notiz. In "Downtown 81" trägt Basquiat bereits eine Leinwand durch die Stadt. Der anrollende Kunstmarktboom gierte nach neuen Namen, und einige Kunstkritiker sahen in dem wilden Gekritzel des Autodidakten das heiße Ding.
Basquiats krakelige Figuren und zerborstene Wortbilder wirkten, als hätte Cy Twombly seinen Urlaub nicht in Südtirol, sondern in der South Bronx verbracht. Mit 24 war der Jungstar am Cover des New York Times Magazine, jede Ausstellung ausverkauft. Bis heute scheiden sich die Geister darüber, ob er nur eine Erfindung cleverer Kunsthändler war oder in den Olymp der New York School gehört. Seine afroamerikanische Herkunft war ein Startvorteil, der sich schließlich in ein Stigma verkehrte: zu echt, um wahr zu sein.
Keith Haring hatte mit einem anderen Makel zu leben, dem der Popularität. Um 1980 entwickelte er gestrichelte Piktogramme, mit denen er nicht nur Leinwände und Mauern, sondern auch T-Shirts und Wodka-Flaschen versah: den Hund, das Radio, den Atomreaktor, den Phallus und die fliegende Untertasse. Er bemalte den Körper von Grace Jones und den Mantel von Madonna, die Wände von U-Bahn-Stationen und TV-Shows. Kunst für alle: Touristen konnten sich in einem Shop am Broadway mit lustigen Postern und T-Shirts eindecken. Obwohl er über das seltene Talent verfügte, aus nichts eine Welt zu schaffen, gilt Haring heute als Merchandisingkünstler à la Hundertwasser.
Harings experimentelles Frühwerk präsentierend, versucht die Kunsthalle Wien nun durch die Übernahme einer Ausstellung des Contemporary Arts Center, Cincinnati, eine Ehrenrettung des Künstlers. Die ursprünglich geplante Ausstellung über die Künstlerin Laurie Anderson, auch sie eine Schlüsselfigur der New Yorker New-Wave-Ära, musste abgesagt werden.
Basquiat starb 28-jährig an einer Überdosis Drogen, Keith Haring 32-jährig an den Folgen seiner Aids-Erkrankung. Ihr früher Tod symbolisiert auch das Ende dieser unglaublich dichten Ära kultureller Produktion. Mitte der 80er-Jahre verwüstete Aids die New Yorker Boheme, der Golfkrieg und die damit einhergehende Finanzmarktkrise beendeten schlagartig den Kunstmarktboom. In den 90er-Jahren beseitigte der konservative Bürgermeister Rudolph Giuliani schließlich die letzten Reste der Ruinenromantik, die Obdachlosen, Prostituierten und Nachwuchskünstler zogen weiter. Heute ist Berlin die Projektionsfläche für kreativen Eskapismus bei günstigen Mieten.
Für Debbie Harry, die Sängerin der Band Blondie, hat es sich übrigens gelohnt, Basquiats Glücksfee zu spielen. Während der Dreharbeiten kaufte sie ihm um hundert Dollar eines seiner Bilder ab.