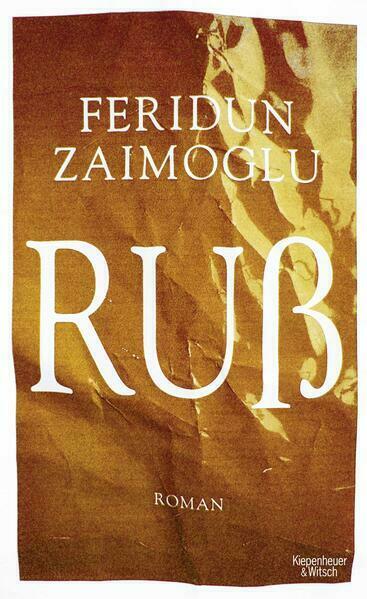Der Versuch, den Tod zu umdribbeln
Anja Hirsch in FALTER 41/2011 vom 12.10.2011 (S. 19)
Feridun Zaimoglu führt in "Ruß" ungewohnt verhalten durchs Ruhrgebiet – und weiter
Zu manchen Zeiten ist das Ruhrgebiet dunkles, vermintes Gelände. Es ist ein unwirtliches Land, aus dem die Frauen fliehen und in das sie erst wieder zurückkehren, wenn ihr Glück auch in der Ferne nicht anspringt – eine graue, chamäleonartige Gegend mit dunklen Straßen, die man lieber taub und stumm in Hab-Acht-Stellung durchmisst, sonst "begibt man sich in eine Geschichte", in andere zerbrochene Leben.
Hier, wo sonst Schimanski die anarchistische Unterwelt ordnet, wurzelt Feridun Zaimoglus neuer Roman mit dem plakativen Titel "Ruß". Der Ort ist Programm: Duisburg verspricht eine hohe Dichte an Lebenstaumlern. Sie alle versammeln sich bei Renz, der einen kleinen Kiosk betreibt – ein Gucktheater, in dessen Winkeln der abgestandene Atem verkorkster Existenzen unzumutbar nah rückt.
In Zaimoglus Ruhrgebietsarchiv gehören Überfälle, der Kaffee für 80 Cent und die Erinnerung an eine Kindheit, in der die Devise galt: "Ruhe im Haus, Maul halten". Und doch trägt der Autor den bekannten Ruß, den man von den Fassaden kennt, nur deshalb Schicht für Schicht auf und ab, um darin eine ganz andere, bewegendere Geschichte zu erzählen.
Zaimoglu ergründet die Möglichkeiten, sich in der größten Wut selbst beruhigen zu können. Manche verstreichen für Renz ungenutzt, und es kommt erwartbar zu Schlägereien. Andere bringen Passagen hervor, in denen dieser große, unausgegorene Text plötzlich Form annimmt und für alle Widrigkeiten entschädigt. Sprechen wir zuerst von den Widrigkeiten. Das sind die vielen typischen Figuren: Norbert, Kallu, Hansgerd, die kleinen Kioskhelden, die, wenn sie miteinander sprechen, zwar Realität, aber nicht immer auch Literatur ergeben. Eher wirkt es so, als habe Zaimoglu hier und da ein Mikrofon an einer Kreuzung gen Trinkhalle gehalten und dabei Wörter aufgeschnappt wie "Pullerbudenwärter" oder "Tresenlieschen". Das ist alles nicht schlecht, aber oft zu viel. Manchmal steigt das Niveau, und man unterhält sich darüber, ob es wohl möglich wäre, "den Tod zu umdribbeln", was eine wunderbare Formulierung ist, bei der man sofort andächtig verweilt.
Und dann geschieht das, was Zaimoglu, der über lange Strecken mit Informationen geizt, einkalkuliert haben könnte: Man mischt sich ein, man zetert, man ärgert sich, weil die Handlung ständig Nebenpfaden folgt, die im Nichts enden. Und man probiert aus, ob diese Formulierung nicht vielleicht sogar auf das diffuse Verhalten dieser gar nicht recht fassbaren Hauptfigur passt. Umdribbelt Renz also den Tod?
Renz, der Büdchenmann, hatte mal eine solide Existenz als Arzt, bis Einbrecher seine Frau erschlugen und er den Schmerz im Alkohol ertrank. Die Arbeit im Seltershaus regelte lang sein Leben. Doch der Mörder hat seine Haft abgesessen und läuft nun frei herum. Soll Renz sich rächen? Die Frage tritt zunächst in den Hintergrund.
Es steht sogar das generöse Angebot im Raum, dies dreckige Geschäft könnten alte Bekannte für ihn erledigen. Im Gegenzug muss Renz allerdings ein Opfer erbringen. Er soll zusammen mit Karl einige Wochen lang dem psychotischen Josef auf einer Urlaubsreise Gesellschaft leisten und ihn etwas lenken. Begleitmann, das ist als Job so aus der Mode gekommen wie etwa der Beruf der Hausdame. Und doch ist es ein Auftrag ganz nach Zaimoglus Geschmack und für den Roman hintergründiger, als man annehmen könnte.
Der 1964 in Anatolien geborene, seit 35 Jahren in Deutschland lebende Autor, der mit "Kanak Sprak" 1995 das Thema Integration sozialkritisch für die Literatur einspielte, hat längst andere Furchen geschlagen, zuletzt mit "Hinterland" gar ins Unterholz deutscher Romantik. Auch jetzt steht in gewisser Weise die Romantik Modell, die Flucht aus dem eigenen, maßgeschneiderten Leben, das Gesetz der Reinigung durch Spiegelung.
Der Aufbruch über die Grenzen des Ruhrgebiets wird für Renz, den sensiblen Hemdsärmligen, zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und während wir ihn, Karl und den "verdrehten Jungen" Josef bis nach Warschau und Österreich begleiten, rollt wie ein ständig unterbrochener Film die allmähliche Verpanzerung Renz' vor uns ab: eine brutale Kindheit unter trostlos ziellosen Eltern, eine Vorstadtjugend unter dem Gesetz der Straße, das Präparieren von Leichen als Student. Erst Stella bringt Licht in sein Leben, und ihr Tod den Absturz: "Er war verlorengegangen, irgendwann."
"Ruß" bezieht sich nur bedingt auf den Ort.
Es steht für die schwarze Ohnmacht, für die ständige Versuchung, für den Wunsch nach Vergeltung. Die Auftragsreise ließe sich als Übung verstehen, auch für den Leser, der einer Flucht beiwohnt, wie sie heute oft genug üblich ist: ein anderer Park, eine andere Stadt, auch mal eine andere Kneipe und ein etwas anderer Umgangston.
Es würde einen nicht durch den Roman drängen, wären da nicht die brodelnde Introviertheit Renz' und die Sprachkraft des Autors: "Auf halbem Wege zurück zum Tisch hielt er inne, er sah sie alle aufstehen, und Karl, der sonst jede unnötige Nähe mied, beugte sich leicht und flüsterte Josef einige Worte ins Ohr. Sie sahen aus wie verliebte Geister, wie von Raureif bedeckte Statuen. Dieses Bild wollte er sich einprägen."
Immer wieder gestaltet Zaimoglu in größter Unruhe Ruhepole. Selbst Sex prolongiert er zum ewig prickelnden Vorspiel, um es dann endlich lapidar in einem Satz explodieren zu lassen. Wo sonst, etwa in "Liebesbrand", eine Frau ungestüm zu jagen war, dominiert jetzt statt Feuer eine genießerische Verhaltenheit. Im großen Verlauf hat sie allerdings manchmal den Hang stillzustehen.