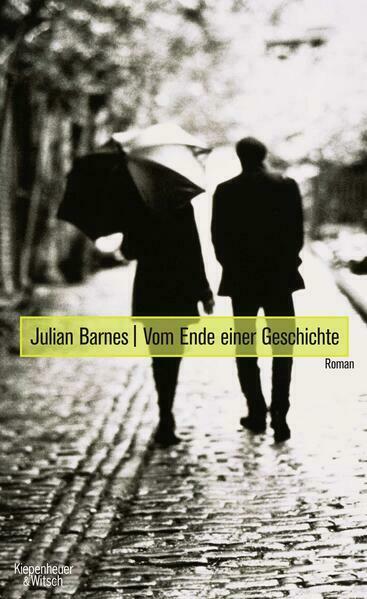Klaus Nüchtern in FALTER 51-52/2011 vom 21.12.2011 (S. 38)
Die Literatur hat drei große Themen: die Liebe, den Tod und den Erwerb von Einbaumöbeln – und bekanntlich kann man eins davon zur Not auch weglassen. Der Brite Julian Barnes hat sich in den letzten Jahren eher selten bei Ikea umgesehen und sich stattdessen in dem Erzählband "Der Zitronentisch" und dem autobiografischen Großessay "Nichts, was man fürchten müsste" eindringlich mit Alter, Tod und den damit einhergehenden Ängsten, Wünschen und Vorstellungen auseinandergesetzt.
Mit der Novelle "Vom Ende einer Geschichte", die in der deutschen Ausgabe als Roman ausgewiesen wird (wie alles, was den Umfang von 148 Seiten überschreitet), bleibt Barnes diesem Thema treu und beendet unter vernehmbarem Aufatmen des britischen Feuilletons den peinlichen Missstand, bereits dreimal für den Man Booker Prize nominiert worden zu sein, ihn aber bislang nie erhalten zu haben.
"The Sense of an Ending" borgt sich seinen Titel von einer Studie des englischen Literaturkritikers Frank Kermode, die sich damit befasst, wie in der Literatur ebenso wie im Leben das schiere Vergehen von Zeit durch Fiktionalisierung in sinnvolle und kohärente Muster umgeschrieben wird – nichts, was man vermeiden müsste (oder auch nur könnte), aber doch etwas, dem man mit einer gewissen Skepsis begegnen darf. Und genau diese Skepsis ist der Motor des Barnes'schen Schreibens.
Die erste, deutlich kürzere Hälfte des Buches ist eine thematisch an Barnes' Debüt "Metroland" (1980) anknüpfende Adoleszenzgeschichte von vier bücher- und sexhungrigen jungen Männern, die das, was als Leben vor ihnen zu liegen scheint, mit aggressiver Arroganz ins Auge fassen: "Ja, natürlich waren wir prätentiös – wozu ist die Jugend sonst da?" Wobei sich die große zeitliche Distanz zu "damals" nicht nur in den Temporaladverbien, sondern auch in einer geschärften Sensibilität für die Unschärfe von Epochenschwellen manifestiert.
Von sexueller Freizügigkeit ist in jenen Zeiten, in denen man mit einem Mädchen "ging" und erst danach herausfand, "welche Sexualpolitik sie betrieb", für die Protagonisten nicht allzu viel zu bemerken: "Du magst einwenden: Aber das waren doch die Sechzigerjahre?" wird der Leser auf deutsch unangemessen kumpelhaft geduzt. "Ja, aber nur für einige Leute, nur in bestimmten Teilen des Landes."
"The Sense of an Ending" meint beides: den Sinn, der einer Geschichte vom Ende her verliehen werden mag, und den Sinn dafür, dass etwas zu Ende geht. "Geschichte ist die Summe der Lügen der Sieger" wirft der juvenile Ich-Erzähler in der genitivfreudigen Übersetzung (im Original: "History is the lies of the victors") seinem Lehrer selbstherrlich an den Kopf, worauf dieser seinem Schüler antwortet, er möge "die Summe der Selbsttäuschungen der Besiegten" nicht aus den Augen verlieren.
Genau die Frage danach, wo das ständig Neu- und Überschreiben des eigenen Lebens, das wir "Biografie" nennen, auf Selbsttäuschung oder auch schierem Unwissen beruht, gewinnt im zweiten Teil des Buches eine überraschende Dringlichkeit. Tony Webster, der mittlerweile längst in die Kohorte "der Nichtjungen" eingetreten ist, muss sein weder unglückliches noch erfolgloses, aber mitunter von der leicht fahlen Aura freundlicher Angepasstheit umflortes Leben einer jähen Revision unterziehen und feststellen, dass die bald beendete Beziehung zu seiner ersten Freundin und diejenige zu seinem damaligen besten Freund keineswegs ein abgeschlossenes Kapitel seiner Biografie darstellen.
Viktoria und Adrian, so deren Namen, waren nämlich selbst kurz ein Paar, und der sexuell frustrierte Tony hatte den beiden seinerzeit einen bitterbösen und längst aus seinem Gedächtnis gelöschten Brief geschrieben, der Adrians frühen Selbstmord in einem ganz anderen Licht erscheinen und die unwirschen Reaktionen der nun nach so langer Zeit wieder kontaktierten Viktoria nur allzu verständlich erscheinen lassen.
"Das Ende einer Geschichte" ist ein ebenso ökonomisches wie uneitles Buch, das nichts "entlarven" und niemanden "überwältigen" will. Es verdankt seine beachtliche Wirkkraft einzig seiner luziden Ernsthaftigkeit, die in der Einbaumöbelliteratur rar geworden ist. Sein letzter Satz lautet: "Es herrscht große Unruhe."