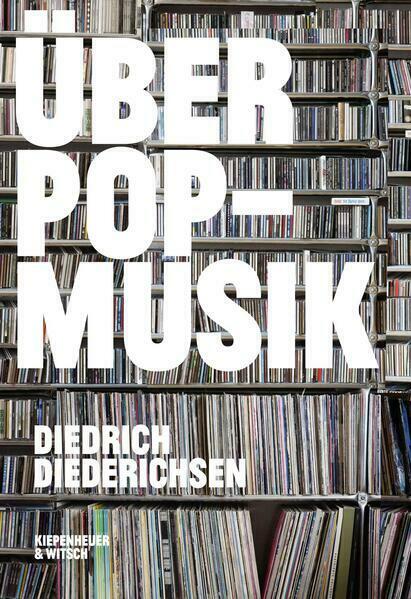Der geile Sound des Unverständlichen
Gerhard Stöger in FALTER 11/2014 vom 12.03.2014 (S. 41)
Pop: Ein Fall für die Analyse im privaten Lesekreis: Diedrich Diederichsens Opus Magnum "Über Pop-Musik"
Diedrich Diederichsen, wir lieben dich, aber deine Bücher verstehen wir nicht", singt die Elektropopband Saalschutz über den 56-jährigen deutschen Autor, Kunstprofessor und Theoretiker. Langjährige Leser seiner Texte dürften beides nachvollziehen können: die Zuneigung, aber auch das Hadern.
Als Redakteur der Magazine Sounds und Spex war Diederichsen in den 1980er-Jahren entscheidend daran beteiligt, auch im deutschsprachigen Raum eine über die ästhetische Bewertung hinausgehende Beschäftigung mit Popmusik zu etablieren. Der gebürtige Hamburger wurde zum bedeutendsten Vertreter des sogenannten Popdiskurses, einer außerakademischen Disziplin, die Musik in Kombination mit einem interdisziplinären Wissen – gespeist aus Soziologie, Philosophie, Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Cultural Studies – dafür nutzt, die Welt aus linker Perspektive zu verstehen, zu erklären und zu hinterfragen.
Diederichsens Qualität ist eine Mischung aus Originalität und apodiktischen Urteilen, überbordendem Wissen und analytischer Schärfe bei gleichzeitigem Spaß an der Abschweifung, aus Positionsstärke, Leidenschaft für die Musik, Lust an der Kritik und der Verknüpfung loser Fäden, die Popsongs mit sozialen Bewegungen ebenso verbinden wie mit Entwicklungen der bildenden Kunst.
Der Haken ist die Verständlichkeit. Speziell in seinen Büchern pflegt Diederichsen, der seit 2006 an der Akademie der bildenden Künste in Wien unterrichtet, einen Stil, den "komplex" zu nennen noch euphemistisch wäre. Das ist durchaus reizvoll. Man kann sich als Leser aber auch ziemlich blöd vorkommen. Oder den Autor zu klug finden. Zu klug für diese Welt, wie die österreichische Punkband Chuzpe einst sang.
Jetzt legt Diederichsen sein bislang gewichtigstes Werk vor. Es fasst die Entstehung und Entwicklung von Popmusik analytisch – also: Rock'n'Roll der 1950er-Jahre und alles, was über Punk und Hip-Hop bis zu Techno und dem Nischenkulturallerlei der Gegenwart folgte. Er stellt Bezüge zur Jazzgeschichte, zu Kino und Literatur her und liefert eine komplexe Theorie der Kunstform Popmusik.
Einer Kunstform, die, so eine zentrale These des großformatigen 500-Seiten-Ziegels, gar nicht als Musik, sondern nur als komplexes Zusammenwirken von Musik mit Bildern, Sehnsüchten, Posen, Wünschen, Rezeptionsverhalten und derlei mehr zu verstehen ist: "Pop-Musik ist kein Spezialfall aus dem größeren Gegenstandsbereich Musik. Und Pop-Musik ist nicht nur sehr viel mehr als Musik. Pop-Musik ist eine andere Sorte Gegenstand."
Die gute Nachricht: "Über Pop-Musik" ist spannend, vielschichtig, erhellend, klug, bisweilen sehr amüsant und bei allem inhaltlichen Gewicht auch unterhaltsam, speziell in den persönlichen Passagen – das erste Konzerterlebnis (der Bluesrocker Johnny Winter, ausgerechnet!) oder der alte Song der Incredible String Band, der sich über die innere Stimme unvermittelt meldet und so Diederichsens Reflexionsmaschine anwirft.
Die schlechte Nachricht: Streckenweise ist "Über Pop-Musik", das über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren entstand, noch schwerer zu fassen als frühere Musikbücher des Autors. Polemisch formuliert legt sich vor allem in der ersten Hälfte häufig der dichte Nebel des Theorieschwurbels über seine Ausführungen; weniger polemisch formuliert muss sich Diederichsen die Frage gefallen lassen, ob "Über Pop-Musik" einen Adressaten hat oder ob es einfach darum ging, den gelegentlich ausgelassenen, zumeist aber hochkomplexen Tanz seiner Synapsen zu Papier zu bringen.
Während er Detailaspekte (das Leben und Wirken des britischen Produzenten Joe Meeks etwa) detailliert referiert, setzt er für das Buch zentrale theoretische Überlegungen in Halbsätzen als gegeben voraus. Referenzen werden nur durch das Zufallsprinzip erklärt, und der Aufbau wirkt zwar logisch, laboriert aber daran, dass letztlich alles mit allem zu tun hat, was sich in Doppelungen sowie dutzendfachen Verweisen auf später zu Erklärendes oder bereits an anderer Stelle Gesagtes niederschlägt.
Lässt man sich darauf ein, entwickelt des Buch aber auch in den unverständlichen Passagen einen geilen Sound, der im einen Moment einer verwirrend-verstörenden und gleichzeitig ungemein anziehenden späten John-Coltrane-Platte wie "Ascension" gleicht und im nächsten der verwegenen Rotzigkeit einer deutschen Spät-1970er-Punkband wie Mittagspause.
Um die Frustration gering zu halten, empfiehlt sich allerdings eine Lektüre im privaten Lesekreis. "Das Kapital" hat man einst ja auch nicht alleine studiert...