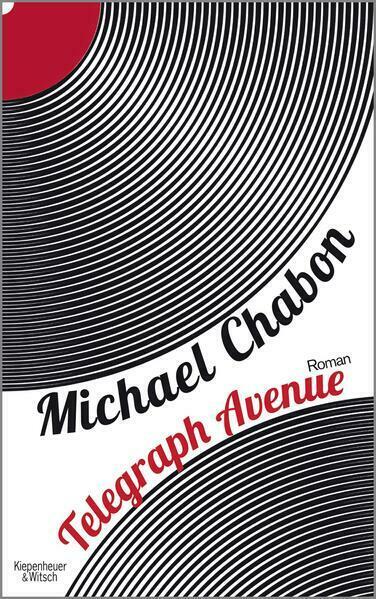Väter und Söhne, Vinylnostalgie & Funk-Gestöhne
Klaus Nüchtern in FALTER 25/2014 vom 20.06.2014 (S. 28)
Der US-amerikanische Autor Michael Chabon (Jg. 1963), zu dessen bekanntesten Werken "Die Vereinigung jiddischer Polizisten" und "Wonderboys" zählen (verfilmt mit Michael Douglas im pinkfarbenen Frotteebademantel in der Hauptrolle), ist ein Tausendsassa und unternimmt nicht allzu große Anstrengungen, dies zu verbergen. In seinem jüngsten Roman gibt es ein eigenes Kapitel von wenigen absatz- und punktlos durchgeschriebenen Seiten, die aus der Sicht eines Papageis erzählt sind. Das kann er also auch. Wenn man den manierierten Maximalismus des Autors erträgt, bei dem Sneakers, Trainingsanzüge und andere Accessoires nie gelb, orange oder bunt, sondern prinzipiell "tukanschnabelfarben" sind, kann man mit "Telegraph Avenue" aber durchaus auf seine Kosten kommen. Der Roman ist eine grelle, mit allerlei popkulturellen Referenzen auf die jüngere Film-, Musik- und Modegeschichte prall gefüllte Wundertüte.
Epizentrum der Handlung ist der Laden Brokeland Records, in dem die Freunde Nat (weiß) und Archy (schwarz) rares Vinyl verchecken, dessen Existenz aber dadurch gefährdet ist, dass sich in der Gegend die Filiale eines Megastores ansiedeln soll. Zugleich hängt dieses ungleiche Kräftemessen auch noch mit einem Verbrechen in der Vergangenheit zusammen und führt in eine Ära zurück, in der Archys Vater Luther als Karateweltmeister zugleich Held in den Blaxploitation-Filmen der "Strutter"-Serie war (offenkundig angelehnt an die "Shaft"-Streifen mit Richard Roundtree).
Chabons Buch ist eine Fan-enzyklopädisch ausstaffierte Hommage an die Seventies; es ist des Weiteren ein Väter-und-Söhne-Roman, in dem die Enkerln zur großen Genervtheit der Väter die Coolness der Opas wiederentdecken; es handelt darüber hinaus von der resoluten Lebenstüchtigkeit zweier Hebammen, die sich das hysterische Rumgezicke ihrer Männer (genau: Nat & Archy) einfach nicht leisten können; und es ist schließlich ein Lobgesang auf die Kreolität, in der sich Hautfarben, Kulturen und Küchen mischen. Nicht eben Low-Carb-Kost also, sondern ein fettes Gumbo.