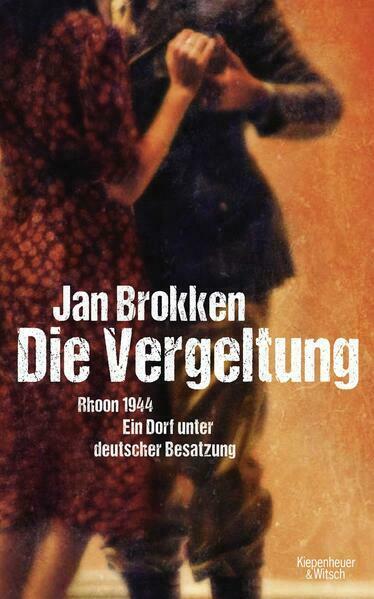Eine historische Spurensuche als meisterhafter Krimi
Julia Kospach in FALTER 32/2015 vom 05.08.2015 (S. 18)
Ein literarisches Sachbuch beschreibt, wie der Tod eines jungen Wehrmachtssoldaten ein niederländisches Dorf seit 1944 in Atem hält
„Die Vergeltung“ klingt, als handelte es sich um einen weiteren brutalen Krimi aus der posthum erschienenen „Millennium“-Reihe des großen schwedischen Autors Stieg Larsson, mit deren eindringlichen Titeln „Verblendung“, „Verdammnis“ und „Vergebung“. Tatsächlich aber ist „Die Vergeltung“ ein Sachbuch, es „basiert auf wahren Ereignissen“, und doch gleicht es einem klassischen Kriminalroman in mehr als einer Hinsicht: Es ist spannend wie eine gute Detektivgeschichte, seine Handlung schlägt wilde Volten, sein Personal ist vielschichtig und überraschend wandelbar, und es lässt zwischen den Zeilen jede Menge Platz für Spekulationen über die alles entscheidende Frage: „Whodunit?“
Eins sei gleich vorweggenommen: Das Verbrechen, um das es geht – wenn es denn überhaupt eines war! – wird nicht restlos geklärt. Eher werden seine möglichen Urheber umzingelt und wie Insekten unter die Lupe genommen, ihre möglichen Motive gegen die anderer Verdächtiger abgewogen. Mindestens ebenso viel Raum widmet die Erzählung der Kettenreaktion von wüsten Vergeltungsmaßnahmen, die auf das „Verbrechen“ folgten.
Mehr als einmal finden sich in dem Buch Sätze wie: „Zugegeben, das ist Spekulation ...“ , aber gerade durch solche eingestandenen Ungewissheiten bekommt es seine flirrende, dichte Atmosphäre, wird es zum Porträt einer Gemeinschaft, die über Jahrzehnte von einem nie aufgeklärten Verbrechen und dessen Folgen in Atem gehalten wird. Oder wie es am Ende des Buches heißt: „Dinge, die nicht untersucht werden, blähen sich zu grimmigen Ausmaßen auf und können jahrzehntelang im Geheimen weiterschwelen, bis jeder seinen eigenen Verdächtigen hat oder seinen eigenen Schuldigen. Ein Dorfbewohner verglich das mit einem Wassergraben, der nie gespült wird und anfängt, zu faulen und zu stinken, bis er zur Brutstätte übler Algen wird.“
Der Autor von „Die Vergeltung“ ist der Niederländer Jan Brokken, Jahrgang 1949, der als einer der wesentlichen Schriftsteller seines Landes gilt. Sein Buch stand wochenlang auf den niederländischen Bestsellerlisten und wurde für mehrere Literaturpreise nominiert. Es erzählt eine Geschichte von „bitterem Charakter“. Eine, die eingestandenermaßen „zwischen Fakten und Vermutungen hin- und herpendelt“ und aus dieser Spannung ihre große, modellhafte Eindringlichkeit schöpft. Brokken studierte dafür tausende Seiten mit Augenzeugenberichten, Zeugeneinvernahmen, Dokumenten, Akten und Notizen. Allein: „Manche Fakten lassen sich nicht mehr ermitteln.“
Als Brokken als Sohn eines kurz zuvor aus Indonesien in das kleine südholländische Dorf Rhoon bei Rotterdam zurückgekehrten Pfarrers geboren wurde, lagen die Ereignisse, denen er sich in seinem Buch widmet, nur fünf Jahre zurück. Ort der Handlung: eben dieses Dorf Rhoon, in dem Jan Brokken selbst aufwuchs. 1944 war es ein kleiner, sehr ländlicher Flecken im Maas-Delta, dessen Häuser an vielen Stellen im Schatten hoher Deiche lagen, die sie vor Sturmfluten schützten.
Im Jahr 1944 stand Rhoon unter deutscher Besatzung, und der Tod eines blutjungen deutschen Besatzungssoldaten ist es auch, der die Spirale der Ereignisse in Gang setzt. Am Abend des 11. Oktober 1944 wurde der 18-jährige Ernst Lange in der abendlichen Dunkelheit auf dem Deich von einem herunterhängenden Stromkabel getötet. Noch in derselben Nacht zerrten die Deutschen acht Männer des Dorfes aus ihren Betten und erschossen tags darauf sieben von ihnen, vertrieben die Familien der Hingerichteten und steckten deren Häuser in Brand.
Zurück blieben ein zerrüttetes Dorf und ein riesiges Schlangengeknäuel von Fragen: War der Tod von Ernst Lange ein Sabotageakt oder ein Unfall? Wieso trafen die Vergeltungsmaßnahmen genau jene sieben Männer – und einen der Verhafteten nicht? Hätte auch den zwei Dorfmädchen, die an diesem Abend mit dem jungen Deutschen und seinem Vorgesetzten unterwegs waren, als „Moffenhuren“ ein Denkzettel verpasst werden sollen? Nutzte der örtliche Nazi-Befehlshaber den Tod des Soldaten, um sich – ohne große Untersuchungen oder Autorisierung von oben – einiger unliebsamer einheimischer Störenfriede zu entledigen? Welche Rolle spielten die Mitglieder niederländischer Widerstandszellen, welche örtliche Kollaborateure, Mitläufer, Besatzungsprofiteure, betrogene Ehemänner, zornige junge Männer aus dem Dorf?
Ein beispielhaftes Kriegsdrama
Es sind die paar wenigen ewigen Dinge, die aus diesem Vorfall ein beispielhaftes Kriegsdrama machen, das einem so nahe rückt, als hätte es sich gerade erst gestern zugetragen: Liebe, Hass, Angst, Mut, Erniedrigung, Ehre, Feigheit. Die ganze Welt dreht sich in Jan Brokkens Buch um diese Grunddinge – wie sie das in jeder guten Literatur tut. „Die Vergeltung“ ist vor allem auch ein hochliterarisches Sachbuch, das die Dinge höchst kunstvoll in der Schwebe hält. Erzählt ist es von einem „Ich“, das darin Vermutungen anstellt, sich selbst erinnert und die Menschen, die ihm aus der Kriegsgeschichte entgegentreten, mit jenen vergleicht, denen es selbst als in Rhoon aufgewachsenes Kind zum Teil noch persönlich begegnete – freilich ohne damals von den Ereignissen des Oktobers 1944 zu wissen.
Das Kriegsende am 8. Mai 1945 brachte für das Dorf Rhoon keine Befreiung: „Es war, als ob an diesem Tag alle angestaute Wut hervorbrach, Wut über die unschuldigen Opfer, Wut über die materiellen Schäden im Dorf, vor allem aber Wut über die Frauen und Mädchen, die aus dem Krieg ein Fest und aus dem Feind Bettgespielen gemacht hatten.“ Viele Fakten mögen verloren gegangen sein, die alten Rechnungen blieben offen. „Die Vergeltung“ macht das auf faszinierende Weise deutlich.
Was geschah am 10. Oktober?
Sigrid Löffler in FALTER 12/2015 vom 18.03.2015 (S. 31)
n der faszinierenden Recherche „Die Vergeltung. Rhoon 1944” taucht Jan Brokken in den Horror der deutschen Okkupation in den Niederlanden ein
Das Ganze ist jetzt 70 Jahre her, aber für die Dorfbewohner von Rhoon ist die Sache bis heute nicht ausgestanden. Immer noch geben sie – jetzt schon in der zweiten und dritten Generation – einander reihum die Schuld an dem, was damals passierte, als Rhoon von der deutschen Wehrmacht besetzt war. Denn bis heute ist nicht klar, was genau in dieser kleinen niederländischen Gemeinde südlich von Rotterdam in der Nacht des 10. Oktober 1944 geschah.
War es ein Unfall? Eine Verkettung unglücklicher Umstände? Ein Mordanschlag? Ein politischer Sabotageakt? Unbestritten ist nur, dass der deutsche Soldat Ernst Lange – 18 Jahre alt, Matrose in Ausbildung – in der Dunkelheit auf dem Deich in das herunterhängende Kabel einer Hochspannungsleitung lief und von einem 500-Volt-Stromschlag getötet wurde.
Tags darauf übten die deutschen Besatzer grässliche Vergeltung an den Dörflern. Sieben Männer wurden wahllos ergriffen und erschossen, ihre Häuser in Brand gesteckt. Die Erinnerung an diese Racheaktion entzweit das Dorf Rhoon bis heute, da die Einwohner (und deren Nachkommen) einander für den Tod des Soldaten – und damit indirekt auch für die deutsche Vergeltungsaktion – verantwortlich machen.
Der niederländische Autor Jan Brokken, Jahrgang 1949, wuchs in Rhoon als Sohn des Pfarrers auf. Seine Lokalkenntnisse waren entscheidend für sein Buchprojekt, das die Vorgänge um dieses halb vergessene, aber bis heute fortschwärende deutsche Massaker erhellen möchte.
Brokkens Ermittlungen, bei denen ihm ein ehemaliger Schulkamerad mit Archivforschungen und hunderten von Zeugenbefragungen zuarbeitete, führen ihn in die „geheimste Geschichte von Rhoon” – dorthin, wo sich mangels Faktensicherheit in den Köpfen der Dorfbewohner ein Gewirr von Vermutungen, Verdächtigungen, Spekulationen, Vorwürfen und unzuverlässigen Erinnerungen festgesetzt hat.
„Manche Fakten lassen sich nicht mehr ermitteln”, räumt Brokken gleich eingangs ein. Schon deshalb nicht, weil die meisten unmittelbaren Zeugen von damals nicht mehr befragt werden können, denn sie sind entweder tot oder dement. Gleichwohl fördern seine Nachforschungen ein genaueres, umfassenderes und beklemmenderes Bild von den Vorgängen in Rhoon unter deutscher Besatzung zutage, als vorab zu erhoffen war. Das Ergebnis seiner akribischen Recherchearbeit liegt nun auf Deutsch unter dem Titel „Die Vergeltung” vor.
Es ist eine faszinierende Lektüre, denn Jan Brokken lässt den Leser an seinen detektivischen Ermittlungen, seinen Schlussfolgerungen wie auch an seinen Zweifeln teilhaben. Er stellt aufgrund seiner kriminalistischen Befunde vorläufige Hypothesen auf, nur um sie sogleich zu hinterfragen und probeweise durch neue, andere Hypothesen zu ersetzen. Er erörtert die Widersprüche, Zweideutigkeiten, Lücken und Rätselhaftigkeiten bei der Suche nach der historischen Wahrheit. Und immer ist er sich bewusst, dass letzte Gewissheit über die tatsächlichen Zusammenhänge wohl nicht mehr zu erlangen ist.
„Jede Wahrheit ist lediglich eine Interpretation dessen, was sich in Wirklichkeit zugetragen hat” – diesen Satz stellt der Autor als Motto seiner atemberaubend spannenden Untersuchung voran und bekennt sich dazu, dass „diese Geschichte zwischen Fakten und Vermutungen hin- und herpendelt”. Dennoch gelingt Brokken etwas Exemplarisches: Er macht am Beispiel eines kleinen niederländischen Dorfes unter deutscher Okkupation modellhaft die bis heute nachwirkenden Schreckensdimensionen des nationalsozialistischen Eroberungskriegs kenntlich.
Die Okkupation brutalisiert die Besatzer und korrumpiert die Besetzten. Diesen Prozessen wechselseitiger Verderbnis und moralischer Verrohung spürt Brokken an zahllosen Beteiligten auf deutscher und niederländischer Seite bis in die feinsten Nuancen nach. Dass er ferner auch den geheimen Aktivitäten der örtlichen Widerstandskämpfer sowie den unschuldigen und unbeteiligten Opfern gerecht wird, das macht die außerordentliche Qualität dieser Rekonstruktion eines Kriegsverbrechens aus.
Je tiefer Brokken mit seinen Recherchen in die Dorfgeschichte eindringt, desto unübersichtlicher wird sie. Denn in Rhoon, einer 2200-Seelen-Gemeinde, waren insgesamt zwischen 300 und 400 Wehrmachtsangehörige einquartiert; gleichzeitig waren ebenso viele Untergetauchte und Flüchtlinge heimlich auf Dachböden und in Hinterzimmern versteckt.
Je genauer Brokken die Beteiligten prüft, desto schillernder und widersprüchlicher erscheint deren Verhalten. Da sind die Dorfmädchen, die mit den Besatzern fraternisieren und sich auf Liebschaften mit deutschen Soldaten einlassen, und die Dorfburschen, die sich in der Kneipe mit Mut aufpumpen und dann losziehen, um „die Moffen” mit Steinwürfen und allerhand Sabotageakten (vielleicht auch mit dem Herunterreißen eines Starkstromkabels?) zu ärgern. Da sind die Kollaborateure, meist Mitglieder der niederländischen Nazi-Partei, die gut daran verdienen, der Wehrmacht zu Diensten zu sein, und die Mitglieder der Untergrundbewegung, einer Schattenarmee, die an ihren geheimen Widerstandsaktionen werkelt und über die Kollaborateure im Dorf genau Buch führt, für später. Und da sind schließlich die Besatzer, deutsche Offiziere und Soldaten, darunter viele blutjunge Kerle – und doch mögen sich so manche zu Sadisten entwickelt haben, die zu allem fähig waren, wie das Massaker von Rhoon zeigt.
Jan Brokken beschreibt das Dorf Rhoon als einen Ort, in dem unter Kriegs- und Besatzungsbedingungen alle einander misstrauen und buchstäblich jeder eine zweite, geheime Agenda hat. Auch 70 Jahre nach Kriegsende sind diese Verwerfungen noch zu spüren. Sie machen diesen Dokumentarkrimi zu einem Meisterstück historischer Aufklärung.