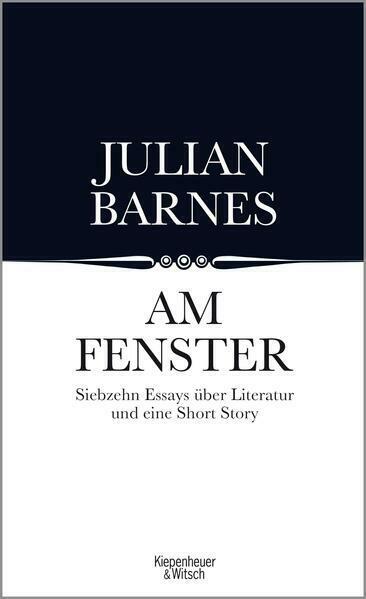Als der „Ulysses“ von Joyce beim Drogentest durchfiel
Karl A. Duffek in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 22)
Mit seinen Essays beweist Julian Barnes, dass er nicht nur ein brillanter Autor, sondern auch ein brillanter Leser ist
Das war Kate, seine intelligenteste Studentin, auch wenn sie in ihren Geschichten zu viele Hunde unterbrachte. Einmal hatte er mit Rotstift an den Rand geschrieben ‚Hund killen‘. Als Nächstes hatte sie dem Seminar eine Geschichte mit dem Titel ‚Der unsterbliche Dackel‘ vorgelegt. Das hatte ihm gefallen.“
Ein nicht länger erfolgreicher Autor gibt Kurse für kreatives Schreiben und reflektiert dabei sein eigenes privates wie berufliches Leben. Diese wunderschöne Kurzgeschichte unterbricht die Essays über Literatur in Julian Barnes’ Buch „Am Fenster“ („Through the Window“, 2012). Die Aufsätze kennzeichnet eben jene Noblesse, die sich auch durch seine Romane, von „Flauberts Papagei“ bis „Vom Ende einer Geschichte“, zieht. Noch das Grausamste wird ohne große Geste erzählt, wirkt daher aber umso stärker.
Die besondere Qualität dieses Autors liegt in dessen Präzision – nie ein Satz zu viel. Seinem Erzähler in der erwähnten Geschichte legt Barnes daher auch ein völlig zutreffendes Urteil über eine Ikone der Weltliteratur in den Mund: „Die ‚Dubliners‘ seien ein Meisterwerk, aber der ‚Ulysses‘ sei bei aller Brillanz des Anfangs im Grunde eine mit Steroiden vollgepumpte Short Story, grotesk aufgeschwellt. Wenn der ‚Ulysses‘ bei den Olympischen Spielen antreten wollte, würde er beim Drogentest durchfallen.“
Die Essays sind unerhört feinfühlig. Selbst einem Autor wie George Orwell, dessen Verbissenheit ihm offensichtlich sehr, sehr fremd ist, kann Barnes noch das eine oder andere Positive abgewinnen.
Die schönsten Texte des Buches, oft im Guardian oder der New York Review of Books erschienen, beschäftigen sich aber eher mit Schreibenden am Rande des Kanons. Sein intensives Plädoyer für Ford Madox Ford, mit dem Barnes nicht zuletzt eine veritable Frankophilie verbindet, macht ungeheure Lust darauf, „The Good Soldier“ und „Parade’s End“ endlich einmal zu lesen.
Penelope Fitzgerald, „der besten lebenden Romanschriftstellerin Englands“ (sie verstarb im Jahr 2000), begegnet Barnes bei einem Podiumsgespräch und fährt mit ihr gemeinsam nach London zurück. Er möchte ein Taxi rufen, beide wohnen im Norden der Stadt, Fitzgerald besteht aber darauf, mit der U-Bahn zu fahren, weil sie auf dem Weg von der Station nach Hause noch Milch kaufen wolle. Zudem habe sie vom Londoner Bürgermeister so eine wunderbare Dauerkarte geschenkt bekommen. Dem Einwand, man könne bei dem Geschäft ja auch kurz Halt machen, begegnet sie mit völliger Verständnislosigkeit.
Dann eben die Franzosen. Neben einem grandiosen Text zum Übersetzen von Flaubert findet sich unter anderem eine überraschende Hommage an Michel Houellebecq, für den Barnes in einer Preisjury gestimmt hat. Ein wenig schwingt Entschuldigung in dem Essay mit, aber es ist das im besten Sinne Unverschämte, das ihn an diesem Autor reizt: „Wenn er (…) über Sex schreibt, ist das seltsamerweise pornografisch und sentimental zugleich. Pornografisch in dem Sinn, dass er sich sämtliche Bewegungsabläufe und Bilder aus der Pornografie holt (…). Sentimental, weil die wirklich netten, unkomplizierten Figuren (…) asiatische Masseusen und Prostituierte sind, die ohne Fehler, Krankheiten, Zuhälter, Süchte oder Probleme dargestellt werden.“
Den Abschluss des Bandes bildet eine autobiografische und selbstironische Darstellung des Lebens mit Büchern, das mit der beginnenden Pubertät einsetzt: „Mein Bruder besaß das ‚Satyricon‘ von Petronius, was das mit Abstand heißeste Buch in den Regalen der Familie war. Die alten Römer führten ein entschieden wilderes Leben als das, was ich in Northwood, Middlesex, mitbekam. (…) Doof wie ich war, nahm ich an, all seine Klassikerausgaben seien ähnlich erotischen Inhalts. Ich verbrachte deshalb viele öde Tage mit seinem Hesiod, bis ich herausfand, dass dem nicht so war.“
Barnes verteidigt seine Bibliomanie auf sehr nachvollziehbare Weise: „Noch immer kaufe ich Bücher schneller, als ich sie lesen kann. Doch das kommt mir vollkommen normal vor: Es wäre sehr sonderbar, nur so viele Bücher um sich zu haben, wie man in seiner verbleibenden Lebenszeit noch lesen kann.“