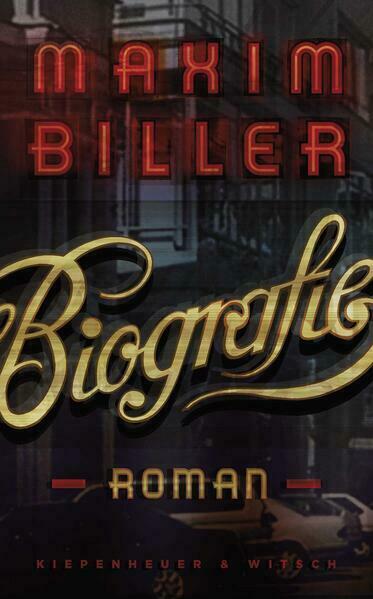Er hört nicht auf: Das Opus magnum eines Provokateurs
Sebastian Fasthuber in FALTER 18/2016 vom 04.05.2016 (S. 33)
Maxim Biller schreibt in seinem großen Roman „Biografie“ über die traumatisierten Kinder von Holocaust-Überlebenden
Seit gut 25 Jahren gibt Maxim Biller in deutschen Medien hingebungsvoll den Juden, den die Deutschen hassen sollen. Seine Zeitungsartikel und jüngst auch seine Auftritte im wiederbelebten TV-Format „Das literarische Quartett“ zeugen von einem Mann mit übersteigertem Geltungsdrang und zwanghaftem Hang zur Provokation. Thomas Bernhard nannte er ein „großes, faules, provinzielles, österreichisch-deutsches Arschloch“. Und zu Thomas Mann ließ er verlauten: „Es muss mir gelingen, ihn zu zerstören.“
Biller ist manchmal sehr lustig und oft sehr anstrengend. Selbst Bewunderer seiner Formulierkunst und seines losen Mundwerks denken sich bisweilen mit Harald Schmidt: „Biller nervt.“ Wahrscheinlich lacht sich Maxim Biller in solchen Momenten ins Fäustchen. Weil es ihm gelungen ist, für ein Arschloch gehalten zu werden. Er selbst würde wohl sagen: ein „großes, faules, höhnisches, jüdisch-deutsches Arschloch“.
Die Sache hat auch einen Haken: Die öffentliche Figur Biller hat den Autor in den Hintergrund gedrängt. Pries man seine ersten Erzählbände wie „Wenn ich einmal reich und tot bin“ als „Wiederkehr der jüdischen Literatur nach Deutschland“ (Süddeutsche Zeitung), wurde sein späteres Werk vom „Esra“-Skandal überschattet.
Die Exfreundin des Autors hatte sich in der Hauptfigur des 2003 erschienenen Romans wiedererkannt und Anzeige erstattet. Schließlich wurde „Esra“ vom Bundesverfassungsgericht wegen „Verletzung von Persönlichkeitsrechten“ verboten. Seither sind Erzählungen, Kinderbücher, satirische Kurzgeschichten und ein Theaterstück erschienen, aber kein Roman mehr.
Biller hat die Munition für sein Opus magnum aufgespart, wie sich nun zeigt. Schon beim Titel seines neuen Romans geht das Kopfkino los. Welche Biografie erzählt er in dem Buch, gar seine eigene? Der Ich-Erzähler Solomon „Soli“ Karubiner ist nah an Biller gebaut. Wie er wurde Soli in Prag geboren und kam als Kind mit seinen russisch-jüdischen Eltern und seiner Schwester nach der Niederschlagung des Prager Frühlings nach Deutschland. Und wie Biller ist er ein Provokateur, seine Bücher tragen Titel wie „Post aus dem Holocaust“.
Sein Vater ist Holocaust-Überlebender, diente danach als kommunistischer Spion und schlug seinen Sohn regelmäßig. Soli kann Sex darum nur dann richtig geil finden, wenn er mit Schmerzen verbunden ist: „Das Blut schoss immer schneller in meinen müden Schwanz, während diese kleine israelische Sadistin tief in meiner Seele und meinem Arsch nach weiteren wunden Stellen suchte. Dann fing ich an zu weinen.“
Überhaupt, Sex: Alle Figuren in dem Buch haben am Holocaust oder am Stalinismus gelitten oder zumindest an den Schäden, die diese an ihren Vorfahren angerichtet haben. Ihre Art, damit umzugehen, ist, es fast ständig zu tun und die restliche Zeit darüber zu reden. Am sichersten fühlt sich Soli, wenn er seinen „Dudek“ in der Hand halten kann. Das passiert ihm auch schon einmal in der Öffentlichkeit. Bei einem Saunabesuch beginnt er angesichts des mächtigen Hinterteils einer deutschen Schönheit an sich rumzuspielen.
Ein deutscher Jungautor namens Clausi-Mausi droht daraufhin, mit einem Überwachungsvideo davon an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn Soli ihm nicht zu einem Buchvertrag verhilft.
Die zweitwichtigste Sache in „Biografie“ ist das Schreiben. Fast alle tun es oder haben es zumindest vor. Vater Karubiner hat früher trockene Romane verfasst, die kein Mensch las, und beneidet seinen recht erfolgreichen Sohn. Solis Schwester kämpft nicht nur mit Übergewicht und dem Drang, ihren kleinen Bruder zu vergewaltigen, sondern müht sich auch schon länger mit einem Roman ab. Sie wird am Ende mit einem dubiosen „Sexrabbi“, der seinerseits mit dem Ratgeber „Geld ist alles“ einen Bestseller landete, ihr Glück finden.
Die Romane von Solis bestem Freund Noah „Noahle“ Forlani, darunter potenzielle Kracher wie „Fick meine Frau, Goldmann!“, kommen dagegen über die Titelfindung nicht hinaus. Noah wurde zwar von seinen Eltern nicht geschlagen, dafür filmten sie heimlich seine ganze Kindheit mit und schritten auch nicht ein, als ihn sein Kindermädchen misshandelte.
Lust kann der erwachsene Noah nur empfinden, wenn eine riesige Frau ihn niederringt. Die Millionen, die er von seinem steinreichen Vater hat, verpulvert er mit dubiosen Film- und Sozialprojekten. Und um seine dominante Frau loszuwerden, inszeniert er sogar seine eigene Entführung.
„Biografie“ ist ein Roman über Juden heute, der sich liest, als hätte Mel Brooks auf Speed einen Acht-Stunden-Schinken produziert. Ein großer Teil des deutschen Feuilletons durfte ihn denn auch guten Gewissens als furchtbar überzeichneten Slapstick ablehnen. Oberflächlich betrachtet stimmt das schon: Fast 900 Seiten Sex und halbwegs geschmacklose Witze sind ermüdend und schwer zu ertragen. Auch stilistisch ist das Buch über weite Strecken eine Zumutung, eine in die Hose gegangene Mischung aus weit ausholendem Parlando und Internet-Pornosprech.
Vielleicht sollte man das Buch aber als Billers subtile Rache an den Nachfahren der Täter – an seinen Lesern – verstehen. Positiver formuliert, macht er ihnen mit „Biografie“ ein Angebot: Auch wenn sie den Schmerz der Opfer nie nachvollziehen können werden, dürfen sie beim Lesen dieses schwer konsumierbaren Brockens leiden und sich als böse Nazis fühlen.
An einer Stelle im Roman betrachtet Soli ein Mahnmal und kommt zu der Erkenntnis, die Deutschen hätten „dieses Monument errichtet, weil sie es fast geschafft hätten, uns auszurotten – es ist ihr Triumphbogen“. Maxim Biller wird nicht aufhören, lästig zu sein. Das ist sein Triumph.