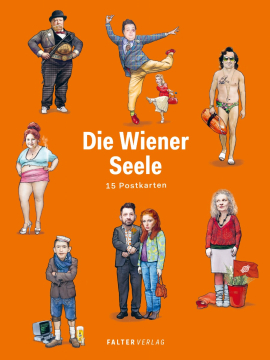Die anderen sind noch viel schlechter dran
Klaus Nüchtern in FALTER 36/2016 vom 07.09.2016 (S. 35)
In ihrem Roman „Drehtür“ lässt Katja Lange-Müller eine Krankenschwester über das Wesen des Helfens nachdenken
Jahrelang hat Katja Lange-Müller Tiere für den Titel ihrer Bücher herangezogen: „Verfrühte Tierliebe“, „Vom Fisch bespuckt“ oder „Böse Schafe“. Jetzt, wo kaum noch ein Cover ohne Fauna-Sujet auskommt, ist es ihr offenbar zu dumm geworden. „Drehtür“ heißt ihr jüngster Roman, obwohl Tiere darin nach wie vor eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielen: deutsche Wespen zum Beispiel, eine trächtige tunesische Katze oder lesbische, soll heißen: auf Lesbos lebende Geckos.
Den Wespen rückt die Protagonistin in jugendlichen Jahren mit Spülmittel an die Taille; der Katze steckt sie heimlich geraubte Essensreste zu; die Geckos vertreibt sie im Auftrag ihres mit ihr urlaubenden Freundes, eines Ösis namens Kurt, der „eben kein großzügiger Wiener“, auch kein „großkotziger Schlawiner“, sondern „ein ehrgeiziger Sozialwissenschaftler aus der Steiermark“ mit ausgeprägter Viechphobie ist: „,Asta‘, rief er, ,mach sie weg, die Biester! Du bist Krankenschwester. Du ekelst dich nicht.‘“
Da hat er was kapiert, der Kurt. Krankenschwestern sind von Berufs wegen unzimperlich, und das lässt sich auch von der Schriftstellerin Katja Lange-Müller behaupten, die nach ihrer Ausbildung zur Schriftsetzerin als Hilfsschwester auf der geschlossenen Psychiatrie gearbeitet hat. Ihr Tonfall changiert zwischen schnoddrig, sarkastisch und selbstironisch: „Wenn du zum Helfen berufen oder eben ermächtigt bist, ist es tröstlich und herausfordernd, jemandem zu begegnen, dem es schlechter geht als dir selbst, am besten viel schlechter.“
Das Helfen, Helfenmüssen, Helfendürfen und Helfenkönnen ist das Leitthema des Romans, der keine durchgängige Handlung aufweist, sondern in einzelne Episoden zerfällt. Ihrer erinnert sich die Ich-Erzählerin, Asta Arnold, in dem Moment, in dem sie nach 20 Jahren im Dienste internationaler Hilfsorganisationen nach Deutschland zurückgekehrt ist und vor einer Drehtür auf dem Münchner Flughafen ständig alte Bekannte zu erblicken meint. Wegen zunehmender Fehlleistungen hat sie die Kollegenschaft am Hospital Alemán Nicaragüense (kurz: HAN) zum 65. Geburtstag mit einem One-Way-Ticket ausgestattet, denn „wenn du (…) noch immer nicht ans Aufhören denkst, dann schufte dich doch irgendwo in Deutschland tot, oder in Osteuropa, nur bitte nicht mehr bei uns“.
Die Rede vom Helfersyndrom liegt hier nahe und wird dennoch nicht zynisch-entlarvend bedient, denn Selbsthass ist, wie die Autorin und ihre Protagonistin sehr wohl wissen, kein verlässlicherer Ratgeber als sentimentale Selbstgefälligkeit: „Helfen wollen ist womöglich bloß ein angeborener Reflex, helfen können dagegen ein Triumph, ein vorläufiger wenigstens, über die An- und Hinfälligkeit jedweder Kreatur (…).“
Die einzelnen Teile, aus denen das Patchwork dieses Romans zusammengestückelt ist – Erinnerungen an selbst Erlebtes, aber auch Nacherzähltes aus zweiter Hand oder der Kommentar zu einem Spielfilm, den Asta vor vielen Jahren gesehen hat –, sind nicht von einheitlicher Eindringlichkeit, lohnen aber alle der Lektüre. Am stärksten ist die Geschichte, die eine Kollegin auf der onkologischen Kinderstation in Temeswar im fortgeschrittenen Zustand ziemlicher Bezechtheit erzählt. Wie ein Kommentar aus dem Off auch anmerkt, ist es ziemlich unglaubwürdig, dass Asta sie so detailreich zu reproduzieren vermag, glänzend dargeboten aber ist sie allemal.
Es beginnt ganz harmlos damit, dass der Programmchef der Buchmesse mit dem Aussehen eines „vorschnell gealterten, leicht verfetteten Hobbyrocker[s]“, auf diese Tamara Schröder einredet, die sich vor ihrer Helferinnenkarriere als Schriftstellerin versucht hat, um sie zu einem gemeinsamen Auftritt mit indischen Kollegen zu überreden, wobei die verbose Eitelkeit des Mannes schön satirisch auf die Schaufel genommen wird.
Die Situationskomik, die der Geschichte innewohnt, weicht freilich bald einer beklemmenden, bedrückenden Atmosphäre, und die vermeintlich freundliche Einladung nach Kalkutta entpuppt sich als kalkulierter Horrortrip, durch den die zartbesaitete Ersteweltschriftstellerin aus ihrer Komfortzone gelockt und moralisch erpresst werden soll. Die Aktion ist sogar erfolgreicher als erhofft, wirft aber einmal mehr die Frage auf, ob und in welchem Falle der Zweck die Mittel heiligt. Kann es eine Caritas brutalis geben? Gegenfrage: Warum nicht – wenn’s hilft?!