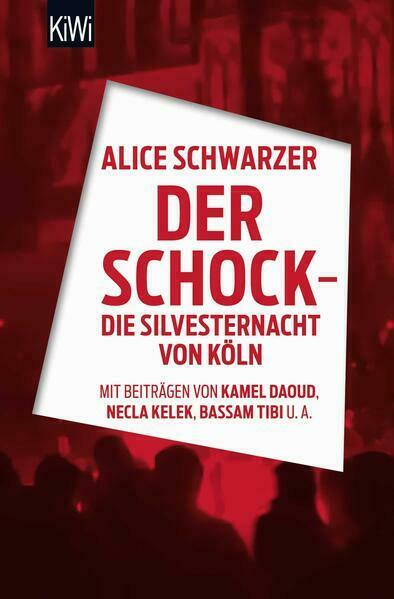„Guck mal, die steckt das einfach weg“
Gerlinde Pölsler in FALTER 51-52/2016 vom 21.12.2016 (S. 36)
# aufschrei-Initiatorin Anne Wizorek über das Leben mit Hasspostings, die Silvesterübergriffe von Köln und „Organisierte Liebe“
Schlagartig bekannt wurde Anne Wizorek (35) durch den von ihr erfundenen Twitter-Hashtag #aufschrei: Tausende teilten unter diesem Schlagwort Erfahrungen mit Sexismus und sexueller Gewalt gegen Frauen. 2014 legte die Bloggerin im Buch „Weil ein #aufschrei nicht reicht“ einen „Feminismus von heute“ dar. Seit 2015 ist sie Mitglied der Sachverständigenkommission für den Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung.
Kurz nach den Kölner Silvesterübergriffen prägte Wizorek den Hashtag #ausnahmslos mit. Motto: „Gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus. Immer. Überall.“ Sie sah eine von Rassismus dominierte Debatte, geprägt vom Bild „des wilden schwarzen Mannes, der seine Sexualität nicht kontrollieren kann und nur darauf aus ist, die passive, weiße Frau zu vergewaltigen“.
In der feministischen Deutung zu Köln gilt Wizorek damit als Gegenpol zu Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer: Diese sieht in den Tätern „fanatisierte Anhänger des Scharia-Islam“; im Buch „Der Schock“ (für das auch Falter-Chefredakteur Florian Klenk einen Beitrag lieferte) spannt sie den Bogen von Köln bis zum Kairoer Tahrir-Platz.
Kürzlich war Wizorek auf Einladung mehrerer Fraueneinrichtungen in Graz. In den USA kochte gerade eine Sexismusdebatte, täglich befeuert von Donald Trump, hoch. Wizoreks Thema: „Man wird ja wohl noch sagen dürfen: Antifeminismus und Backlash“. Der Falter traf sie zum Interview über ein breites Themenspektrum. Nur eine Frage wollte Wizorek partout nicht näher beantworten: Wie damit umgehen, wenn ein muslimischer Mann einer Frau den Handschlag verweigert? Sie sprach von der katholischen Kirche und von Religionen allgemein, eine konkrete Antwort war ihr auch auf mehrfache Nachfrage nicht zu entlocken.
Falter: Frau Wizorek, demnächst jähren sich die Silvestervorfälle von Köln. Inzwischen gibt es dazu neue Erkenntnisse, laut dem Kriminologen Rudolf Egg hätte ein Gutteil der Übergriffe verhindert werden können, doch die Polizei habe viele Frauen im Stich gelassen. Wie sehen Sie diese Nacht heute?
Wizorek: Ich sehe hier ein Versagen der Polizei, aber auch der Stadt selber. Dass es keinen offiziellen Veranstalter und damit kein Sicherheitskonzept für ein solch großes Ereignis gab, finde ich immer noch unfassbar. Auch sind ja Berichte von Betroffenen bekannt, die erst einmal von Polizisten abgewiesen wurden, mit so Hinweisen, sie hätten eben besser auf ihre Sachen aufpassen müssen. Das zeigt, wie tief verwurzelt es ist, Frauen in solchen Situationen nicht zu glauben und ihnen sogar eine Mitschuld zu geben. Erst als dann das schreckliche Ausmaß der Gewalt deutlich wurde, änderte ja die Polizei ihr Vorgehen, was dann aber an dem Punkt schon nichts mehr half.
Sie haben damals geschrieben: „Die Rape Culture wurde nicht importiert – sie war schon immer da.“ Man könne sich „nur verwundert die Augen reiben“, wenn man „nicht schon vor Wut schäumt. Die Gewalt am Kölner Hauptbahnhof als singuläres Ereignis darzustellen, schadet von Gewalt Betroffenen.“ Aber hatten die Ereignisse von Köln nicht doch eine für Europa neue Dimension? Ist da nicht verständlich, dass enormer Redebedarf bestand?
Wizorek: Geredet werden muss auf jeden Fall – und wird es ja auch. Ich finde es nur heuchlerisch, zu sagen, sexualisierte Gewalt sei nur thematisierenswert und solle nur ernst genommen werden, wenn es um migrantische Täter geht. Das dient dann vor allem dazu, rassistische Stimmung zu machen – wie im Fall der Kölner Debatte gegen Geflüchtete –, und nicht dazu, das eigentliche Problem zu lösen.
Sie haben auf das Oktoberfest verwiesen und geschrieben, da würden im Schnitt zehn Vergewaltigungen gezählt, die Dunkelziffer werde auf 200 geschätzt. Nun lautet die heurige Polizeibilanz nach dem 17-tägigen Fest: eine angezeigte Vergewaltigung, 31 Anzeigen wegen Sexualdelikten. Schlimm, aber doch eine völlig andere Dimension.
Wizorek: Ich habe mich bei den Zahlen auf einen Artikel der taz bezogen. Die Autorin hat nachträglich noch einmal genau erklärt, wie sie zu dieser Zahl gekommen ist. Eine Dunkelziffer bezeichnet außerdem alle begangenen Taten. Dass die Zahl mit den angezeigten Taten nicht übereinstimmt, sondern hier eine große Differenz besteht, war im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt schon immer Realität, daher sollten diese Zahlen nicht miteinander gleichgesetzt werden. Ansonsten ging es darum, den Kontext herzustellen: Es gibt sexualisierte Übergriffe auch beim Karneval, auch wenn Menschen abends weggehen, und nicht nur auf der Domplatte zu Silvester. Die meisten Übergriffe, bis zu 80 Prozent, passieren im näheren sozialen Umfeld und sind oft auf den ersten Blick nicht sichtbar. Man soll nicht immer so tun, als wäre bei uns alles super, so werden wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht.
Wer tut denn so, als würden sexualisierte Übergriffe nicht auch auf dem Karneval oder sonst wo geschehen?
Wizorek: Genau so wird von konservativer Seite und der Neuen Rechten argumentiert, Sexismus und sexualisierte Gewalt von weißen Tätern werden verharmlost oder abgestritten. So werden dann eher Obergrenzen für Geflüchtete gefordert, statt darüber zu sprechen, wie Sexismus den Nährboden für sexualisierte Gewalt schafft.
Es gibt aber viele, die schon ewig Sexismus kritisieren und gleichzeitig besonderen Aufholbedarf bei manchen muslimisch-arabisch geprägten Zuwanderergruppen sehen. Das kommt von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, seien es Alice Schwarzer, Seyran Ates oder Ahmad Mansour.
Wizorek: Was ich problematisiere, ist, so zu tun, als gäbe es Aufklärungsbedarf nur bei geflüchteten Menschen. Dass es in unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen unterschiedlichen Aufklärungsbedarf gibt, das ist etwas anderes. Darüber müssen wir uns aber eben auch unterhalten. In der deutschen Gesellschaft sehen zum Beispiel gerade junge Mädchen tagtäglich, dass sie nur auf ihre Körper reduziert werden, und entwickeln darüber in Massen Essstörungen. Das ist auch eine Ausformung von Sexismus. Diese Bilder führen außerdem dazu, dass die Hemmschwelle für Gewalt gegen Frauen und Mädchen sinkt. Trotzdem werden sie den meisten Menschen in Deutschland bislang leider nicht als problematisch erscheinen. Wenn es um migrantische Communitys geht, sollte etwa mit muslimischen Feministinnen zusammengearbeitet werden, die sich mit der spezifischen patriarchalen Struktur ihrer Gesellschaften auskennen.
Für Ihren #aufschrei haben Sie viel Zuspruch bekommen, aber auch viel Hass abgekriegt. Wie schlimm war es für Sie?
Anne Wizorek: Es hängt immer von der Tageskondition ab. Es gibt Tage, da kann ich mir die Kommentare angucken und es berührt mich eigentlich nicht so, und an anderen trifft es mich umso mehr. Da reicht dann eine fiese Beleidigung. Aber dieses konstante Sich-dem-aussetzen-Müssen hat klar negative Effekte auf die Gesundheit.
Wie kann man mit den Posts umgehen – darauf reagieren oder besser ignorieren? Und wie schützen Sie sich?
Wizorek: Ich kann da keine allgemeinen Ratschläge geben. Es kann lustig sein, die Absurdität mancher Posts bloßzustellen. Wobei es ein Problem ist, wenn von Betroffenen dieser humorvolle Umgang sogar erwartet wird: Guck mal, die steckt das einfach weg! Ich finde es genauso okay, dass man die eigene Verletzung sichtbar macht oder sich diese Kommentare gar nicht erst anguckt. Wobei Letzteres auch schwierig ist: Wenn zum Beispiel jemand droht, er komme bei einer Veranstaltung „vorbei“, muss man das ernst nehmen.
Ist Ihnen das passiert?
Wizorek: Es kamen Ankündigungen, aber es gab noch bei keiner Veranstaltung wirklich ein Problem. Mittlerweile lasse ich meinen Twitter- und E-Mail-Account filtern, einmal von meinem besten Freund, einmal von meinem Freund. Die leiten mir nur die Sachen weiter, die ich sehen soll und möchte, sagen mir aber auch, wenn etwas dabei ist, das ich ernst nehmen muss. Wobei es Tage gibt, da schaue ich mir das auch ungefiltert an. Aber ich entscheide das. So bekomme ich ein Stück Kontrolle und Selbstbestimmung zurück.
Der Falter setzte heuer auch Journalistinnen aufs Cover, die wegen der Hassmails aufschrien: „Uns reicht’s.“ Corinna Milborn sagte, sie habe eine dicke Haut, aber auch sie müsse inzwischen überlegen, ob sie sich gerade stark genug fühlt, einen Kommentar zu veröffentlichen. Geht es Ihnen auch so?
Wizorek: Absolut. Wenn ich gucke, was ich früher auf Twitter geschrieben habe! Da habe ich mich viel sorgenfreier geäußert. Das fehlt mir heute, und das finde ich schon bedrückend. Twitter war für mich ein Werkzeug, wo ich auch einmal Gedanken formuliert habe, die ich vielleicht noch gar nicht fertiggedacht hatte. Aber gerade das bietet leider sehr viel Angriffsfläche. Dabei glaube ich, dass wir da hinkommen sollten, dass Menschen auch einmal unfertige Dinge sagen dürfen und eine respektvolle Diskussion daraus entstehen kann.
Wie versuchen Sie der Selbstzensur entgegenzuwirken?
Wizorek: Ich versuche, solchen Gedankenaustausch eher im geschützten Raum zu besprechen, offline oder auf privaten Accounts. Ohne diese Rückzugsräume geht es nicht. Aber bloß weil eine Person sich noch nicht oder nicht sofort geäußert hat, bedeutet es keineswegs, dass ein Thema sie nicht beschäftigt. Diese Anspruchshaltung in Bezug auf Social Media ist einfach falsch. Das setzt Menschen unnötig unter Druck.
Gerade unterstützen Sie den Hashtag „OrganisierteLiebe“. Damit soll man Inhalte versehen, die man gut findet?
Wizorek: Ja, unter diesem Schlagwort hat die mit mir befreundete Aktivistin Kübra Gümüşay darauf hingewiesen, dass Hass im Netz organisiert ist, weswegen es umso wichtiger ist, auch Liebe zu organisieren. Wir regen uns eher über Negatives auf, anstatt auch zu sagen, was uns gefällt. Dabei sollten wir zum Beispiel die Stimmen in den Medien unterstützen, von denen wir mehr hören wollen, und nicht immer nur den Artikel teilen, über den wir uns aufregen, sodass der noch mehr Klicks bekommt. Es geht auch darum, diesen Raum ein bisschen zurückzugewinnen, der mittlerweile sehr von Hass dominiert wird.
Und wie läuft’s mit dem Liebe-Organisieren?
Wizorek: Es könnte natürlich immer mehr Liebe verbreitet werden, aber Kübra Gümüşay hat damit auch eine Debatte angestoßen, wie Diskussionskultur im Netz funktioniert. Gerade Onlinemedien setzen mittlerweile oft gezielt auf Shitstorms, um viele Klicks und damit Werbeeinnahmen zu bekommen. Das hat einen negativen Effekt auf die Diskussionskultur und den Journalismus und kann Debatten verzerren.
Was kann so eine Netzaktion bewirken, was blieb denn vom #aufschrei?
Wizorek: Betroffene merken durch solche Hashtag-Initiativen erst einmal, dass sie nicht allein sind, nicht schuld sind an dem, was ihnen passiert ist, und dass sie sich Hilfe holen dürfen. Gerade Männer verstehen durch diese konkreten Beschreibungen aber auch, wie die Realität aussieht. Darüber hinaus ist klarer geworden, dass es Feminismus immer noch braucht, und es konnten sich neue und stärkere feministische Netzwerke herausbilden. Feministinnen, die schon länger aktiv sind, aber vielleicht nicht im Netz, dachten, es gebe gar keinen Nachwuchs, jetzt verstehen sie, dass das Netz genutzt werden kann, um diese Themen zu platzieren.
Im Präsidentschaftswahlkampf hatten auch die USA ihre Sexismusdebatte, es gibt den Schweizer „Aufschrei“ und in Deutschland machte die CDU-Politikerin Jenna Behrends parteiinterne Untergriffe publik. Drehen wir uns eigentlich immer nur im Kreis?
Wizorek: Wir müssen wohl akzeptieren, dass es immer ein paar Schritte vor und ein paar zurück gibt. Aber wir kommen auch vorwärts. Zum Beispiel ist in Deutschland nun endlich die Sexualstrafrechtsreform durch. Früher musste die Person immer nachweisen, dass sie sich ausreichend körperlich gewehrt hat, damit eine Vergewaltigung als solche galt. Das ist jetzt weg. Genauso sagten viele in Reaktion auf den offenen Brief von Jenna Behrends, ja, natürlich ist Sexismus ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das war beim Aufschrei noch nicht so selbstverständlich.
Ein anhaltendes Problem ist, dass man Menschen mit geringerer formaler Bildung mit Feminismus weniger erreicht. Was sollte man tun?
Wizorek: Es wäre wichtig, feministische Kämpfe und Themen der Geschlechtergerechtigkeit schon in der Schule zu behandeln. Auf der anderen Seite haben wir gerade aktuell Schauspielerinnen, Künstlerinnen, die sich als Feministinnen positionieren. Zum Beispiel Beyoncé oder Emma Watson, die durch ihre Rolle bei „Harry Potter“ viele junge Fans hat. Darin sehe ich großes Potenzial, um feministisches Bewusstsein zu schärfen.
In einem Interview wurden Sie zu Fällen gefragt, wo muslimische Väter Lehrerinnen nicht die Hand geben wollten. Die Frage war, wo Sie die Grenze zwischen Sexismus und Religionsfreiheit ziehen würden, und Sie sagten, es sei „interessant, dass sich solche Debatten immer an Traditionen von muslimischen Menschen entzünden, die im christlichen Kontext oft nicht hinterfragt werden“. Wie meinen Sie das?
Wizorek: Es gibt immer noch patriarchale Verhaltensmuster im christlichen Kontext, zum Beispiel in der katholischen Kirche. Kritik an Herrschafts- und Machtverhältnissen beinhaltet auch Religionskritik, vor allem, wenn Religion eben als Unterdrückungsmittel eingesetzt wird. Diese Kritik sollte aber nicht einseitig passieren.