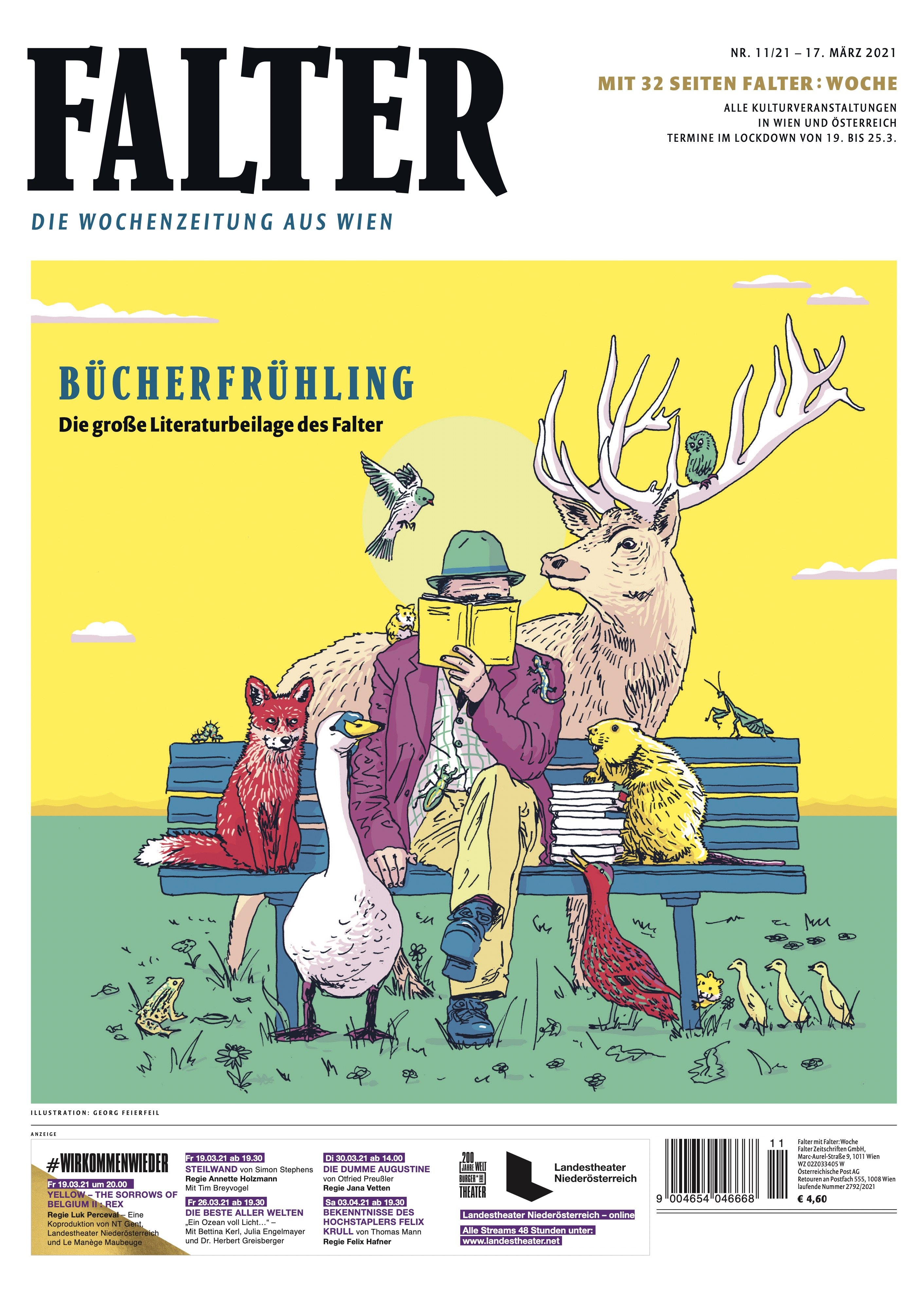
Mama Kracht ist ein Kracher
Sebastian Fasthuber in FALTER 11/2021 vom 17.03.2021 (S. 8)
Im Jahr 1995 debütierte der Schweizer Christian Kracht, damals 28, mit dem Roman „Faserland“. Er schickt seinen jungen Helden auf eine Deutschlandreise und brachte einen neuen Ton in die deutschsprachige Literatur: nicht cool, sondern teilnahmslos und voller Ennui. Hier war er, der gnadenlos oberflächliche Bret Easton Ellis für unsere Breiten.
Ein gutes Vierteljahrhundert später verfasst sein amerikanischer Bruder im Geiste immer noch Aufgüsse seiner frühen Romane. Kracht indes ist schon mit seinem zweiten Roman „1999“ aus der Schublade der Popliteratur ausgestiegen. Mit faszinierend-verstörenden Romanen gelang es ihm in der Folge, ein Geheimnis zu kultivieren – und zu bewahren.
Manche halten Kracht für einen der letzten Ästheten, andere für einen Zyniker oder einen Rechten auf den Spuren Ernst Jüngers. Den Autor selbst scheint all das wenig zu kümmern.
Die Ankündigung einer Fortsetzung von „Faserland“ sorgte allerdings für Verwunderung. Ging es bei Kracht nicht immer nur vorwärts? War nicht Nostalgie der Feind? Und hat er es notwendig, sich auf sein erfolgreiches Debüt zu beziehen? Immerhin war auch sein letzter Roman, „Imperium“, ein Bestseller und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.
Nach der Lektüre des neuen Romans beschleicht einen das Gefühl, dass es dem Verfasser ein dringendes Anliegen war, dieses Buch zu schreiben. „Eurotrash“ ist Krachts persönlichstes Werk. Was nicht heißen soll, dass die Sache einfach wäre, denn der Autor führt den Leser in ein Spiegelkabinett der Identitäten und treibt mit Fakten und Fiktion sein lustvoll-perfides Spiel.
Kracht nutzt den Erstling als Startrampe. Der Held ist älter geworden, weiser wirkt er nur bedingt. Aber wer ist hier überhaupt wer? Auf der ersten Seite behauptet Christian, der Ich-Erzähler von „Eurotrash“, er habe vor 25 Jahren das Buch „Faserland“ geschrieben.
Von kleinen Unstimmigkeiten abgesehen deckt sich sehr vieles mit dem, was von Krachts Familiengeschichte bekannt ist. Vater Kracht (1921–2011), er hieß ebenfalls Christian, stiegt nach dem Krieg aus einfachen Verhältnissen zur rechten Hand des Verlegers Axel Springer auf und brachte es zu einem beträchtlichen Vermögen, das auch ausgestellt und etwa in sündhaft teure Möbel investiert wurde.
In dieser Sphäre wuchs Christian Junior auf, umgeben von David Niven und anderen Vertretern der Reichen und Schönen. Die erste Hälfte des Romans ist eine bittere, vielleicht ein wenig selbstgerechte Abrechnung mit der eigenen Familie. Der Vater wird als kulturloser Parvenü gezeichnet; der Großvater als bis zum letzten Atemzug strammer Nazi, der sich nur in seiner SM-Kammer entspannen konnte, bevorzugt mit isländischen Au-pair-Mädchen.
Die zweite Hauptrolle in „Eurotrash“ spielt Christians Mutter. Mit über 80 dämmert sie, von Weißwein, Wodka und Medikamenten ordentlich sediert, ihrem Ende entgegen. Doch als der Sohn sie zu einem letzten Ausflug überredet, entpuppt sie sich als geistig höchst fit und schlagkräftig. Sie haut ihn raus, als es beim Besuch einer naziverseuchten Öko-Kommune brenzlig wird. Und sie liest ihm auch mal ordentlich die Leviten.
Die Witzchen und Selbstzitate im Buch sind etwas mau. Christian wird mit Daniel Kehlmann verwechselt – der am Buchrücken, wie auch Peter Handke, freundliche Worte beisteuert – und erinnert sich an betrunkene Ausfälle seines jüngeren Ichs. Ja, eh.
Aber die Familiengeschichte, ob nun erflunkert oder wahr, geht einem nahe. Der Erzähler durchläuft dabei eine extreme Entwicklung von der Selbstgerechtigkeit hin zur Selbstgeißelung. Gegen Ende gesteht er, im Grunde so wie sein Vater ein Angeber zu sein: „Der große Unterschied war dabei, dass mein Vater tatsächlich Geld gehabt hatte, ich aber keinen Funken Intellekt.“



