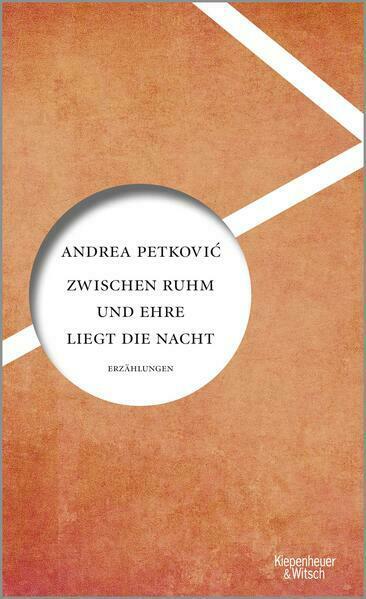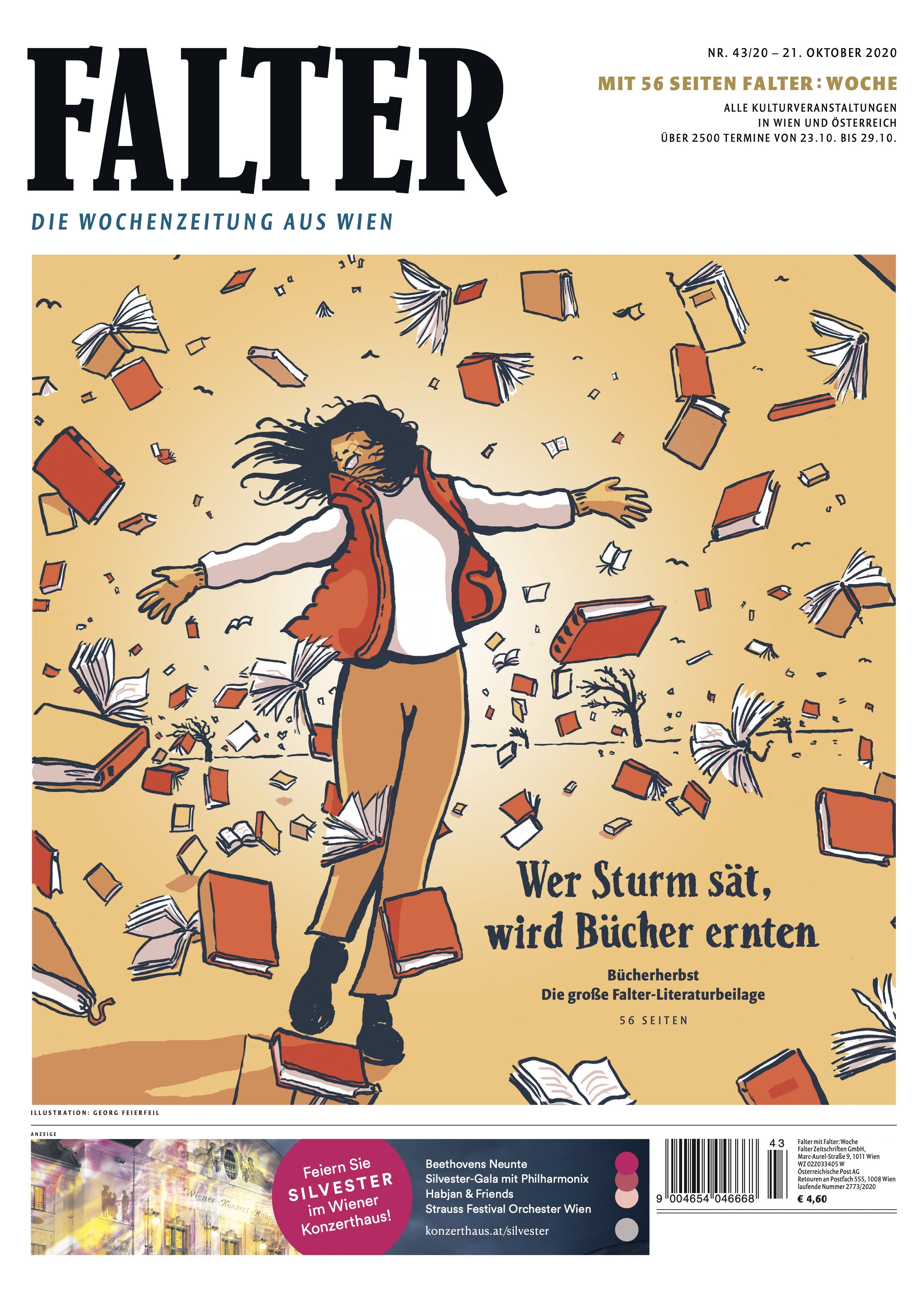
Im Eisbad mit Dostojewski
Sebastian Fasthuber in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 11)
Viele Leistungssportler schwören nach hoher Belastung auf ein Eisbad. Die Beine werden für einige Minuten ins auf zehn Grad heruntergekühlte Wasser getaucht, das fördert die Durchblutung und beschleunigt die Regeneration. Wie verbringen Tennisspielerinnen diese Zeit? Vielen wird das zuvor gespielte Match noch einmal durch den Kopf gehen, andere werden sich überlegen, wo sie danach noch etwas essen gehen.
Von Andrea Petković existiert ein Foto, das sie während der US Open 2016 im Eisbad sitzend zeigt. Sie liest ein Buch. Die deutsche Tennisspielerin, Tochter bosnisch-serbischer Eltern, gilt als die Intellektuelle auf der Tour. Sie hat in der Schule ein Jahr übersprungen und ihre Matura mit einem Notenschnitt von 1,2 absolviert. Erst danach entschied sie sich für den Profisport. Und sie war nie „nur“ Tennisspielerin. Sie schrieb jahrelang eine Kolumne für die Süddeutsche, betätigt sich heute als Reporterin für das ZDF und betreibt auf Instagram einen Lesezirkel („racquetbookclub“).
Petković ist Tenniskennern ein Begriff, aber kein Superstar. Zu ihrer erfolgreichsten Zeit – 2011/12 und noch einmal 2015 erreichte sie jeweils Platz neun der Damen-Weltrangliste. Derzeit liegt sie in etwa auf Rang 100. Ihr bestes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier war das Erreichen des Halbfinales der French Open 2014.
Heuer ist Petković in Paris bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Das mag zum Teil daran liegen, dass sie sich mit ihren 33 Jahren bereits im Spätherbst einer Tennislaufbahn befindet. Vielleicht hängt die Niederlage aber auch mit ihrem ersten eigenen Buch zusammen: „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“ ist ausgerechnet während des wichtigen Turniers erschienen, was für die Konzentration auf den Wettkampf vermutlich nicht unbedingt förderlich war.
Anderseits sind Niederlagen im Tennis selbst für eine sehr gute Spielerin keineswegs die Ausnahme, sondern – aufgrund des K.-o.-Systems – die Regel: „Ich habe in meiner 13 Jahre währenden Karriere sechs Turniertitel gewonnen, den Rest der nach Abzug von Urlaub und Trainingswochen über 500 Wochen also immer verloren“, schreibt Petković.
Und selbst dem Triumph ist immer schon die Niederlage eingeschrieben: „Als ich mein erstes Turnier auf der Profitour gewonnen hatte – nachdem ich fünf Matches in der Qualifikation und fünf Matches im Hauptfeld überstanden hatte –, saß ich auf der Bank mit dem Handtuch über dem Kopf, 16 Jahre alt, allein im Niemandsland der Türkei, und weinte. Es war Glück und Trauer zugleich. Ich hatte etwas gewonnen, das ich nicht für möglich gehalten hatte, aber vielleicht wusste ich schon damals unbewusst, dass ich auch etwas verloren hatte.“
Das ist doch mal ein sympathischer Gegensatz zum Heldenton, der in (Auto-)Biografien von Sportlern meist angeschlagen wird. Mit typischen „So habe ich es geschafft“- oder „Wie ich wieder auf die Beine gekommen bin“-Geschichten hat dieses Buch so gut wie nichts gemein. „Erzählungen“ hat der Verlag aufs Cover des Buchs drucken lassen, was aber auch bestenfalls die halbe Wahrheit ist, denn dafür befindet sich zu viel Reales darin. Das gerade sehr angesagte Genre Autofiktion trifft es vermutlich noch am besten.
„Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“ versammelt Episoden aus dem Leben einer Tennisspielerin. Sie werden in einem lockeren, anstrengungslos wirkenden Ton erzählt, wobei sich passagenweise immer wieder literarischer Anspruch manifestiert. Zum Glück ist er wohldosiert. Petković vermeidet es, ihr Idol David Foster Wallace übertrumpfen zu wollen. Der US-Autor hat großartige Essays über Tennis geschrieben. „Schönheit ist nicht das Ziel von Wettkampfsport, aber Spitzensport ist einer der bestgeeigneten Orte, menschliche Schönheit auszudrücken“, hielt er fest, nachdem er ein Match von Roger Federer gesehen hatte.
Wenn alles passt, dann ist Tennis tatsächlich Sport und Kunst in einem. Bis dahin ist es ein langer, steiniger Weg. Die ersten Kapitel des Buchs handeln davon, wie Petkovićs Vater seiner Familie als fleißiger Tennislehrer eine Schneise in den deutschen Mittelstand schlug. Immer im Schlepptau war seine Tochter, die nach der Schule jeden Nachmittag bis zum Einbruch der Dunkelheit auf dem Platz verbrachte. Ihre Pubertät versäumte sie dadurch komplett. Sie holte diese mit 18, während eine Verletzung sie vom Tennisspielen abhielt, im Schnelldurchlauf nach.
Andrea Petković findet schöne Sätze und Beobachtungen über diese großartigste aller Sportarten. „Vom ersten Aufschlag bis zum letzten Return: Ich bin allein, und – Spoilerwarnung – es wird keiner kommen, um mich zu retten“, heißt es über „die fundamentale Einsamkeit auf dem Platz“. Oder: „Mit dem ersten Grand Slam verhält es sich wie mit der ersten großen Liebe: Man vergisst sie nie, trotz oder gerade wegen der Schmerzen, die sie einem zufügt.“ Oder: „Die Australian Open und ich waren in einer dysfunktionalen Beziehung, bei der sich beide Partner liebten, aber nicht gut füreinander waren.“
Je weiter man kommt, umso weniger geht es um Tennis. Petković erzählt dann davon, wie sie vor Ängsten und Stress in die Literatur floh, von prägenden Lektüreerlebnissen (Dostojewski und Philip Roth zählen neben Foster Wallace zu ihren Favoriten, in Hotels checkt sie bisweilen unter dem Namen „Haruki Foster“ ein), von ihrem erwachenden Feminismus (inzwischen liest sie auch Sibylle Berg) und von Abstechern in ihre Lieblingsstadt New York.
Es ist die Coming-of-Age-Story einer Spitzensportlerin, die sich anschickt, erfolgreich das Metier zu wechseln. Nie mehr Eisbad? Sie wird es aushalten.