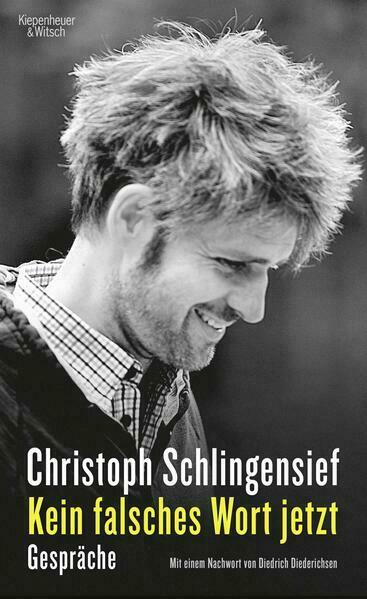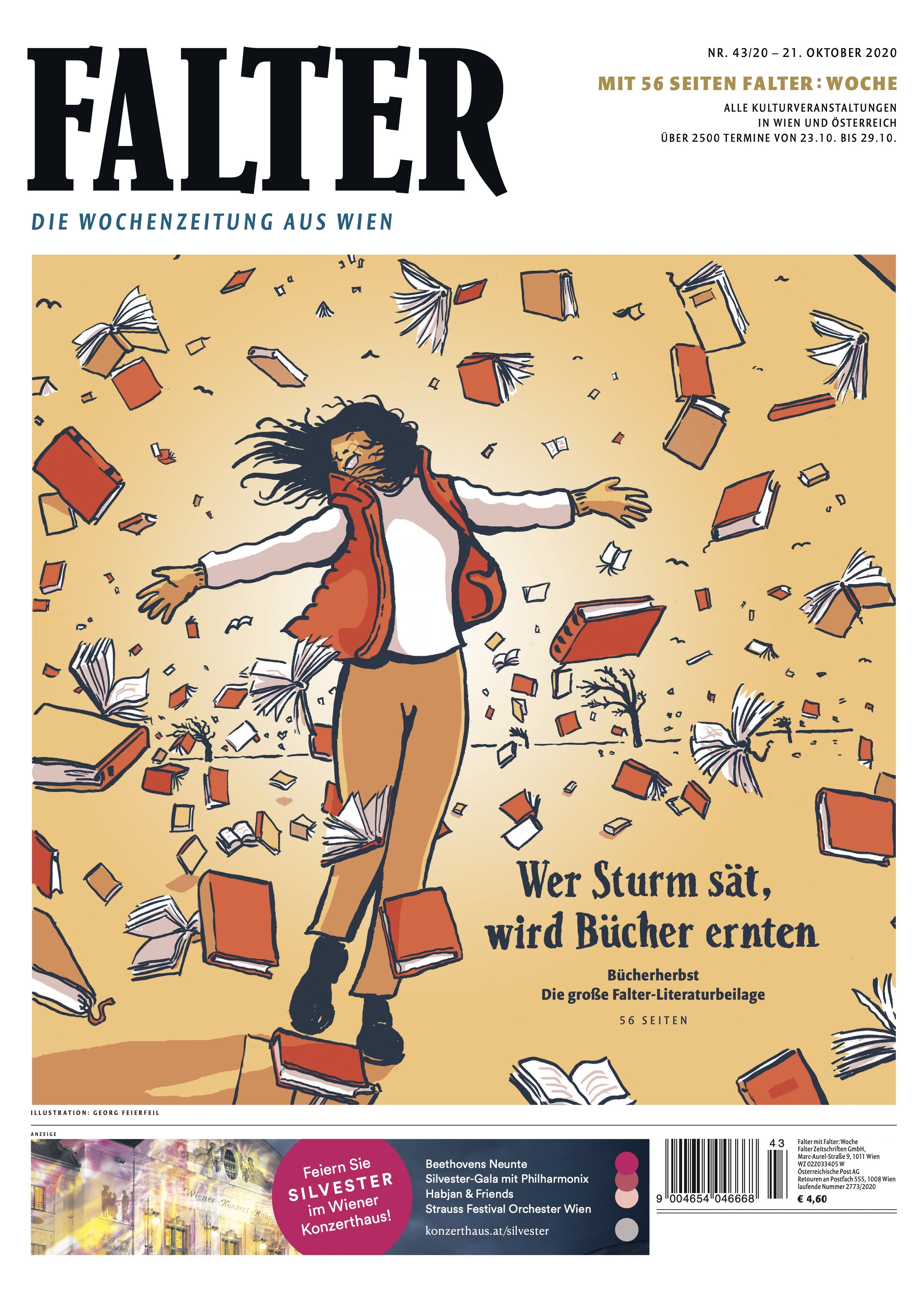
„Machen, machen, machen“
Wolfgang Kralicek in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 20)
Wie viele Interviews Christoph Schlingensief (1960–2010) in seinem Leben gegeben hat, ist nicht bekannt. Es waren jedenfalls viele, sehr viele. Der deutsche Filmemacher, Theaterregisseur und Aktionskünstler hatte nicht nur einen enormen Output, er war auch alles andere als medienscheu. Zu seinem zehnten Todestag liegt nun eine Auswahl von Interviews vor, die das Wirken und Denken des Künstlers in dessen eigenen Worten Revue passieren lassen.
Der Band „Kein falsches Wort jetzt“ wurde von Schlingensiefs Ehefrau und Mitarbeiterin Aino Laberenz herausgegeben, die seinen Nachlass verwaltet. Die 33 ausgewählten Gespräche sind in chronologischer Reihenfolge abgedruckt. Das erste wurde 1984 vom Mülheimer Stadtmagazin Ortszeit geführt, Anlass war das Frühwerk „Tunguska – die Kisten sind da“, und der junge Filmemacher eröffnete das Gespräch selbstbewusst: „Die Fragen müssen korrekt gestellt sein, ja?! Sonst sag’ ich hier gar nichts.“ Das letzte, ein Gespräch zum Thema Schreiben, ist kurz nach Schlingensiefs Tod im Popmagazin Spex erschienen.
Auch zwei Falter-Interviews, beide aus dem Jahr 2000, finden sich in der Auswahl. Christopher Wurmdobler sprach mit Schlingensief über die für MTV in der Berliner U-Bahn produzierte Talkshow „U3000 – Du bist die Katastrophe“; Karin Cerny bilanzierte im Gespräch mit dem Künstler dessen spektakuläre Festwochen-Aktion „Bitte liebt Österreich“, mit der Schlingensief eine Woche lang die Nation in Aufruhr versetzte.
Neben der Staatsoper hatte er ein kleines Containerdorf für Asylwerber errichten lassen; wie bei „Big Brother“ sollte das Publikum entscheiden, wer abgeschoben wird. Die FPÖ tobte, die Kronen Zeitung hetzte, aber auch die linken Demonstranten, die damals jeden Donnerstag gegen Schwarz-Blau auf die Straße gingen, fanden die Aktion nicht witzig – und stürmten den Container.
Letzteres war für Schlingensief der schönste Moment der Veranstaltung. „Ich habe einen totalen Lachanfall gekriegt. Ich wusste gar nicht mehr, was ist denn das jetzt? Also: völlige Verwirrung. Das war, glaube ich, das größte Glück. Es war faszinierend unklar.“ Dass eine subversive Aktion wie diese auch die Donnerstagsdemonstranten provozieren würde, war nicht abzusehen gewesen. Genau um solche „Fehler“ ging es Schlingensief in seiner Arbeit. Mehrmals erzählt er in den Interviews die Anekdote, wie sein Vater versehentlich zweimal denselben Film in die Super-8-Kamera gelegt hatte – und wie faszinierend er als Kind die dabei entstandene Doppelbelichtung fand.
Wer Fehler machen will, muss sich vor Perfektion hüten. Das ist sicher ein Grund dafür, warum es Christoph Schlingensief nie besonders lang in einem Genre ausgehalten hat. Nach Anfängen als Trash-Filmemacher („Das deutsche Kettensägenmassaker“) erfand er sich an Frank Castorfs Volksbühne als Theaterregisseur neu („Rocky Dutschke ’68“), inszenierte 2004 in Bayreuth Wagners „Parsifal“, entwickelte sich danach in Richtung bildende Kunst und arbeitete zuletzt daran, in Burkina Faso ein „Operndorf“ zu errichten. Dazwischen machte er Fernsehen („Talk 2000“) oder gründete eine Partei („Chance 2000“), mit der er 1998 tatsächlich zur Bundestagswahl antrat, die Fünf-Prozent-Hürde mit 0,058 Prozent der Stimmen aber doch recht deutlich verpasste.
„Nach dem Wien-Container hätte ich mich zur Ruhe setzen können“, meinte er Jahre später gegenüber der Zeitschrift Theater heute. „Da war ich Everybody’s Darling. Da hatte ich eine Partei, einen Staat zum Wackeln gebracht. Aber ich kann mich nach so etwas auf keinen Fall beruhigen.“ Außerdem: Es muss ja immer weitergehen! „Das ist eigentlich das Hauptmotiv: machen, machen, machen“, gab er in der Wochenzeitung Freitag zu Protokoll. Ein weiteres zentrales Motiv seines Schaffens offenbarte er im Berliner Stadtmagazin Tip, als er die Motivation für seinen Film „100 Jahre Adolf Hitler“ erklärte: „Ich hatte immer schon vor, etwas über Hitler zu machen, weil ich Hitler nur hinter Glas kennen gelernt hatte. Unter der Glasglocke wird alles bloß stilisiert, also raus damit.“
Seinen ersten Wiener Auftritt hatte Christoph Schlingensief 1996 mit der Performance „Begnadete Nazis“, die der damaligen Kulturstadträtin Ursula Pasterk (SPÖ) suspekt war. In einem Spiegel-Interview erzählt der Künstler, Pasterk habe ihm kurz vor der Premiere das österreichische Pornografiegesetz zugefaxt und um Bestätigung der Kenntnisnahme gebeten. „Da stehen so absurde Sachen drin wie beispielsweise, dass ein Mann, der nachts vor zwei jungen Mädchen in einer menschenleeren Straße masturbiert, sich nicht strafbar macht. Erst wenn jemand dazukommt, wird das Ganze offenbar öffentlich und damit strafbar. Da habe ich der Pasterk dazu geschrieben, wunderbar, sie solle einfach wegbleiben, denn dann wäre nach diesem Paragrafen ja alles okay.“
Wenn Diedrich Diederichsen in seinem Nachwort schreibt, Schlingensief habe es in den Interviews auch mit „nichtsahnenden Leuten, die von nichtsahnenden Redaktionen geschickt wurden“, zu tun gehabt, ist das nicht ganz nachvollziehbar. Die meisten Fragesteller sind mit Schlingensief und dessen Werk offenbar gut vertraut. Okay, wenn Joachim Kaiser, der Kritikerpapst der Süddeutschen Zeitung, mit Schlingensief über „Parsifal“ spricht, reden die beiden höflich aneinander vorbei. Aber aus der Reihe fällt eigentlich nur das Interview mit der Frauenzeitschrift Marie Claire – wobei sich Schlingensief auch im Promi-Wordrap durchaus wacker schlägt. Michael Schumacher? „Ich finde seinen Beruf absolut plemplem, und was er von sich gibt, ist das Allerletzte.“ Boris Becker? „Der hat was.“ Horst Tappert? „Ich möchte nicht wissen, wie der privat lebt.“ Kate Moss? „Erfüllt das Pädophilen-Schema.“ Audrey Hepburn? „Audrey Hepburn ist super. Nee, Katherine Hepburn ist super.“
Im Interview mit Sibylle Berg für das Zeit-Magazin sagt Schlingensief den schönen Satz „Am allerliebsten würde ich ein Stück mit sprechenden Tieren machen“. Noch besser ist das Gespräch, das Benjamin von Stuckrad-Barre 1998 für den Rolling Stone mit ihm führte. Der fragt den Regisseur, ob er nicht mal ein Musical machen wolle, da könne man die Menschen noch erreichen. „Man erreicht die Leute da auch nicht“, erwidert Schlingensief. „Du erreichst sie nur, wenn du im Flugzeug eine Lautsprecherdurchsage machst: ,Die Triebwerke sind ausgefallen, das war’s.‘“