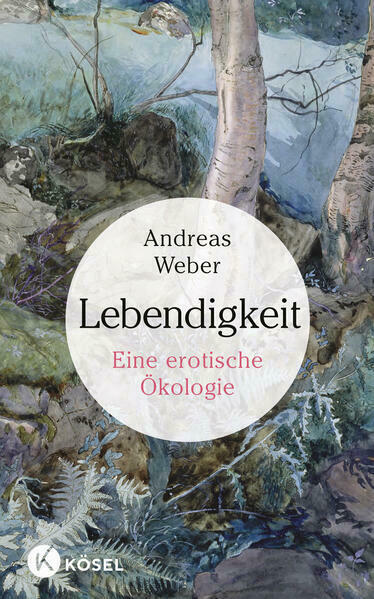Die Freude flügge gewordener Mauersegler im Himmel
Karin Chladek in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 45)
Ökologie: Andreas Weber hat ein poetisches Sachbuch über die Erotik und die Verbundenheit des Lebens geschrieben
Eine erotische Ökologie? Was soll das sein? Was zuerst seltsam klingt, wird klarer, wenn der Publizist Andreas Weber erklärt, dass es ihm vor allem um Verbundenheit geht, um ein umfassenderes Verständnis von Liebe, nämlich die Liebe zur Welt. Liebe und Erotik möchte er nicht als kitschiges Gefühl in einer Zweierbeziehung verstanden wissen, sondern als unbändige Kraft der Fülle und schöpferischen Energie. Seine Grundthese einer erotischen Ökologie lautet: "Sich selbst seine Lebendigkeit zu erlauben heißt: sich selbst zu lieben – und zugleich die schöpferische Welt, die ihrem Prinzip nach zutiefst lebendig ist."
Das klingt zunächst einmal ziemlich esoterisch. Anhand der vielen Beispiele von persönlichen Erlebnissen von Verbundenheit mit der Mitwelt, die Weber anführt, wird seine These jedoch um einiges nachvollziehbarer, wenn sie auch oft im Poetischen hängenbleibt.
Aber das ist ja durchaus legitim. Weber beruft sich etwa auf den deutschen Dichter Rainer Maria Rilke oder den US-amerikanischen Autor und Umweltaktivisten Gary Snyder. Und führt als Beispiel dieser Lebenserotik die für alle Anwesenden spürbare Freude von jungen, gerade flügge gewordenen Mauerseglern im Juli-Abendhimmel an – eine Art Rundumflow, ein intensives und offenbar auch zwischen den Spezies nachvollziehbares Erlebnis, von dem auch weniger philosophisch veranlagte Italienurlauber gerne berichten. Lebendigkeit und das Gefühl der Verbundenheit sieht Weber in engem Zusammenhang mit Spiel und Freude.
"Liebe ist kein angenehmes Gefühl, sondern das praktische Prinzip schöpferischer Lebendigkeit", stellt er fest. Es geht um Kooperation statt Konkurrenz, um die Zusammenarbeit verschiedener Organismen, beginnend bei Zellverbänden. Heutzutage gehört es zum biologischen Allgemeinwissen, dass der menschliche Körper ohne die Unzahl von Bakterien, die etwa den Magen-Darm-Trakt besiedeln, gar nicht funktionsfähig wäre.
Weber leugnet nie, dass es Konkurrenz und Tod in der Natur gibt, betont aber, diese Phänomene seien nur eine Seite der Medaille. Durch das "Wettrüsten" zwischen Jägern und potenziellen Beutetieren seien beide zunehmend aufeinander abgestimmt und auch voneinander abhängig. Ohne Tod kein Leben.
Weber ist Biologe und Philosoph. Ähnlich wie Jakob Johann von Uexküll oder Francisco Varela (beim dem er promovierte) setzt sich Weber in seiner publizistischen Tätigkeit (in literarischen Sachbüchern, aber auch in Medien wie GEO, National Geographic, mare, Die Zeit oder FAZ) für eine Überwindung der mechanistischen Interpretation von Lebensphänomenen ein. Nun ist der Gedanke, dass alles Lebendige miteinander verbunden sei, nicht neu – man denke nur an die Gaia-Theorie von James Lovelock oder an ursprüngliche Religionen.
Mit den Schilderungen seiner persönlichen Erlebnisse von Verbundenheit mit natürlicher, aber auch städtischer Umgebung (im italienischen Ligurien, wo Weber eine Zeitlang lebte, und in Berlin) macht Weber deutlich, was er meint. Vor allem die sinnlich überwältigende Erfahrung mediterraner Sommer und die ebenso beeindruckende Erfahrung des jahreszeitlich bedingten "Todes" der Natur haben ihn geprägt.
Andreas Weber hat ein ausgesprochen philosophisches Buch verfasst. Persönliche Erlebnisse gehören zu seinen Argumenten dazu und machen sie nachvollziehbar. Dem Zwang zur wissenschaftlichen "Objektivität" gibt er nicht nach, er würde auch sicher bestreiten, dass es diese "Objektivität" gibt.
Vielem, was er sagt, kann zugestimmt werden, vieles ist nicht gerade neu, einiges auch redundant. Dennoch wird sich eine interdisziplinäre, eher geisteswissenschaftlich orientierte Leserschaft, die dem Poetischen nicht abgeneigt ist, mit so einigem, was Weber beschreibt, identifizieren können.
Wer sich Fakten erwartet, wird enttäuscht sein. Aber Leser, die primär Interesse an Fakten und Zahlen haben, werden wohl kaum zu einem Buch mit dem Untertitel "Eine erotische Ökologie" greifen – einem Sachbuch, das sympathisch aus der Reihe tanzt.