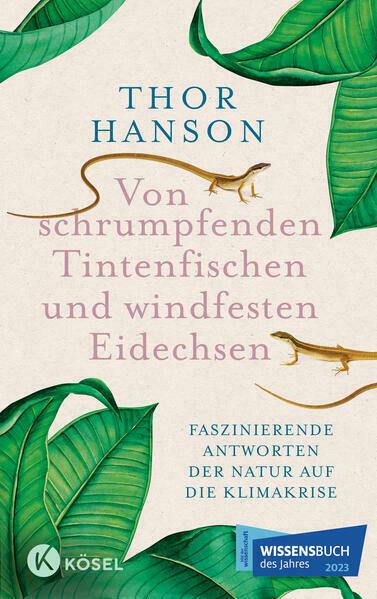Die heißeste Phase ihres Lebens
Benedikt Narodoslawsky in FALTER 5/2023 vom 01.02.2023 (S. 53)
In einem Hotelzimmer in der Karibik zielt der Evolutionsökologe Colin Donihue im Dienste der Wissenschaft mit einem Laubbläser auf eine Eidechse und schaltet das Gebläse ein. Erst huscht das Tier auf die windabgewandte Seite einer Stange, als der Wind stärker wird, klammert es sich fest. Bei 106 km/h verlieren die Hinterbeine den Halt, bei 135 km/h flattern sie in der Luft. Schließlich fliegt das Tier von der Stange und landet im Sicherheitsnetz.
Das Experiment hatte Donihue schnell zusammengeschustert. 2017 hatte er auf den karibischen Turks-und Caicosinseln Anolis-Eidechsen vermessen. Vier Tage nachdem er die Arbeit beendet hatte, fegte der Hurrikan Irma über die Karibik. Zwei Wochen später folgte Hurrikan Maria. In Zeiten der Klimakrise, in der die Zahl und die Intensität der Wirbelstürme zunehmen, stellte Donihue eine hochaktuelle Forschungsfrage: Kann ein Hurrikan die Evolution beeinflussen?
Also kehrte er auf die Inseln zurück und vermaß die Eidechsen erneut. Die überlebenden Exemplare hatten deutlich größere Haftpolster an den Zehen und längere Vorderbeine -damit konnten sie sich im Sturm besser halten. Die Hinterbeine waren hingegen kürzer, senkten damit im Wind die Zugkraft. Zwei weitere Messungen im Jahr darauf zeigten: Der Nachwuchs hatte die Merkmale der überlebenden Eltern übernommen.
Donihue stellte den Hurrikan nicht nur im Hotelzimmer nach. Er fand auch heraus, dass sich Eidechsen anderer Populationen ebenso verändert hatten, die dort lebten, wo Hurrikane häufig wüten. "Indem er eine evolutionäre Entwicklung in Reaktion auf das Wetter in Echtzeit gezeigt hatte, hatte er als einer der Ersten bewiesen, dass der Klimawandel nicht nur beeinflusst, wie sich Lebewesen verhalten, sondern auch, wie sie sind", schreibt der Naturschutzbiologe Thor Hanson in seinem neuen Buch "Von schrumpfenden Tintenfischen und windfesten Eidechsen".
Hanson hat für sein Buch eine Fülle an Studien ausgewertet und beschreibt die vielseitigen Auswirkungen, die die Klimakrise auf die Tierwelt hat: In Finnland tarnen sich Waldkäuze mit grauem Federkleid im Schnee besonders gut, aber weil die Schneedecke zurückgeht, nahm die Zahl der Waldkäuze mit rotbraunem Federkleid in vergangenen Jahren stark zu. In Alaska haben Grizzlys wiederum ihren Speiseplan angepasst. Sie naschen Holunderbeeren, die sich nun früher bilden, und müssen die Lachse verschmähen, die zeitgleich die Flüsse hinaufwandern. Darauf müssen sich auch die Aasfresser einstellen, die sich bislang von den Lachsabfällen der Bären ernährten.
Die Klimakrise löst im Kleinen wie im Großen eine gigantische Verschiebung aus - auch im wörtlichen Sinn. Weil der Mensch Kohle, Öl und Gas verbrennt und damit die Erde aufheizt, verlassen viele Arten ihre Heimat. Sie haben sich in Richtung der Pole bewegt, sind an Land in höhere Lagen gewandert oder noch tiefer in die Ozeane hinabgetaucht, sind also überall dorthin geflohen, wo es kühler ist. Diese Völkerwanderung ist kein Nischenphänomen, sie betrifft etwa die Hälfte aller weltweit untersuchten Arten, wie der neue Sachstandsbericht des Weltklimarates festhält, der im Vorjahr erschien.
Die große Wanderbewegung macht auch vor Österreich nicht halt. Vergangenen Mittwoch lag ein Goldschakal mit gebrochenem Genick neben einer Wiese am Straßenrand in Wien-Donaustadt. Er war überfahren worden. Pech für das Tier, Glück für die Forschung. Denn es handelt sich damit um den historisch ersten bestätigten Nachweis, dass der Beutegreifer sich nun auch in der Bundeshauptstadt breitmacht. Seit mehreren Jahren hatte Wildtierbiologin Jennifer Hatlauf, die an der Universität für Bodenkultur Wien ein Goldschakal-Projekt leitet, Fotos von vermeintlichen Nachweisen geschickt bekommen. Aber es handelte sich immer nur um Füchse.
Der Goldschakal fühlt sich eigentlich im warmen Südeuropa wohl. Warum er seit Jahren auch in Österreich umherstreift, ist noch nicht ganz klar und hat wohl mehrere Gründe, erklärt Hatlauf. Etwa dass die Bestände auf dem Balkan wachsen, ihm in Österreich Regionen mit extensiven Landwirtschaften zupasskommen und seine Konkurrenz -die Wölfe - hierzulande noch eher selten ist. Aber auch die Temperaturverschiebung gilt in der Forschung als Grund, warum sich der Beutegreifer im Norden Europas verbreitet. "Der Goldschakal gehört zu den Tieren, die von der Klimaveränderung eher profitieren", sagt Hatlauf.
Zu den Gewinnern des Klimawandels zählt auch so manch heimischer Vogel. Anfang Jänner organisierte die Umweltschutzorganisation Birdlife die Zählaktion "Stunde der Wintervögel". Alle, die in Österreich teilnehmen wollten, mussten innerhalb von drei Tagen eine Stunde lang Vögel beobachten. Sie notierten, wie viele Individuen einer Art sich vor ihrem Fenster, im Garten oder im Park tummelten. 24.532 Menschen machten mit. Das Ergebnis: Die Vogelbeobachter sahen weniger Vögel im Siedlungsgebiet als in den Jahren zuvor. Das ist kein schlechtes Zeichen. "Wenn die Winter hart und schneereich sind, sieht man mehr Vögel am Futterhäuschen, in milden Wintern kommen sie hingegen viel seltener", erklärt Birdlife-Geschäftsführer Gábor Wichmann. "Das hat damit zu tun, dass die Vögel ausreichend Futter außerhalb finden."
Heuer war wieder ein sogenanntes Mastjahr, diese treten in der jüngeren Vergangenheit immer öfter auf. Amsel und Tannenmeise mussten sich im milden Winter also nicht ins Siedlungsgebiet zu den Menschen vorwagen, weil Buchen, Eichen und Fichten sie im Wald ausreichend mit Früchten und Zapfen versorgten. Dazu kommt, dass Arten aus dem Norden wie Bergfink und Seidenschwanz im Winter nicht mehr ins südliche Österreich ziehen müssen. Sie können bleiben, wo sie sind, weil es zuhause warm genug ist.
Die große Mitmach-Vogelbeobachtung fand heuer zum 14. Mal statt, Birdlife kann aus den Zahlen der vergangenen Jahre mehrere große Trends ableiten. So spielen etwa die Gestaltung des Gartens oder die zunehmende Versiegelung eine Rolle, wie viele Vögel vor den Häusern im Winter herumschwirren. "Aber am meisten stechen das milde Wetter und der Klimafaktor heraus", sagt Wichmann. "Dass man in einem eigentlich kurzen Zeitraum schon diese massiven, schnellen Änderungen beobachten kann, ist erschreckend."
Österreichs Natur, die die Eltern als Kinder kennenlernten, unterscheidet sich mittlerweile stark von jener der heutigen Nachkommen. Auch auf der Wiese. Im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums erstellte der Ökologe und Heuschreckenspezialist Thomas Zuna-Kratky eine Studie darüber, wie sich hierzulande die Insektenwelt verändert hat. Mit seinem Team nahm er während der Corona-Pandemie rund 300 Flächen in ganz Österreich unter die Lupe, auf denen Insektenfreunde bereits in den 1990er-und 2000er-Jahren das Vorkommen von Insektenarten erhoben hatten. Zuna-Kratky wiederholte die Zählung mit derselben Methode wie damals. Die Studie stellte er Mitte Jänner gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) vor. Das Ergebnis hat den Ökologen überrascht: Während die Artenvielfalt fast gleich geblieben ist, hat sich die Zusammensetzung stark verändert. "Im Schnitt ist nach 30 Jahren ein Viertel der Arten, die ursprünglich erhoben worden sind, nicht mehr gefunden worden", resümiert Studienautor Zuna-Kratky, "dafür sind sie durch andere Arten ersetzt worden."
Ablesen kann man das etwa an der Liste der Heuschrecken. Arten, die damals schon selten waren, wie die Große Buntschrecke oder die Atlantische Bergschrecke, sind verschollen. Auch der Rotleibige Grashüpfer, der in den 1990ern noch regelmäßig entdeckt wurde, kam nur noch auf einer der untersuchten Testflächen vor. Aber nicht deshalb, weil es heißer geworden ist, sondern weil der Grashüpfer nährstoffarme Lebensräume sucht - und die Böden durch menschlichen Einfluss inzwischen zu nährstoffreich wurden.
Während Arten verschwunden sind, fand der Insektensuchtrupp neue wie die Nadelholz-Säbelschrecke und die Kleine Knarrschrecke. "Wir haben Zunahmen beobachtet, die gravierend sind. Sie betreffen all jene Arten, für die Österreich damals noch zu kühl war", sagt Zuna-Kratky.
Darunter fällt etwa die Lauchschrecke, die die Insektenforscher auf viermal so vielen Flächen fanden. Oder die Große Schiefkopfschrecke, die sich in weiten Teilen des Landes breitgemacht hat. "In den 1990ern war sie noch extrem selten und kam nur in warmen Feuchtgebieten vor. Mittlerweile singt sie an der Wiener Ringstraße auf den Blumenrabatten und ist zu einer Allerweltsart geworden", sagt Zuna-Kratky. Seine Prognose: Je stärker sich Österreich erwärmen wird, desto größer wird der Anteil der Landesfläche, die sich für wärmeliebende Insekten eignet.
Die große Verschiebung beeinflusst nicht nur die Zahl der Arten, sondern auch ihr Wesen selbst. Wie sich höhere Temperaturen auf das Temperament von Tieren auswirken können, illustriert eine druckfrische Ameisenstudie der Universität Innsbruck. Patrick Krapf vom Institut für Ökologie untersuchte darin mit seinen Kollegen acht Populationen hoch oben in den Alpen. Sie sammelten Ameisenarbeiterinnen aus vier Ländern, die zwischen 1600 und 2300 Meter Höhe vorkommen. Die Forscher brachten die Insekten ins Labor und beobachteten, was passiert, wenn Arbeiterinnen unterschiedlicher Kolonien aufeinandertreffen.
Die Ameisen reagierten unterschiedlich. Videos dokumentieren, wie sich zwei kurz beschnuppern und sich dann aus dem Weg gehen. Andere stürzen sich hingegen sofort in den Zweikampf. Und das lag -so resümieren die Forscher -zum einen am Stickstoffgehalt der Böden, zum anderen an der Temperatur. "Die Aggressivität der Ameisen aus den wärmeren Gebieten wie Italien und Frankreich war im Vergleich zu den kühleren Standorten in Österreich und der Schweiz um ein Vielfaches erhöht", erklärte Ameisenforscher Krapf bei der Präsentation der Studie. Er zweifelt hingegen daran, dass Aggression eine erfolgreiche Anpassungsstrategie ist -weil Kämpfe Energie und Zeit kosten, die langfristig für die Nahrungssuche fehlen können.
Altbewährt ist hingegen eine andere Anpassungsvariante: das Schrumpfen. Das zeigt eine Studie, die Konstantina Agiadi vom Institut für Paläontologie der Universität Wien vor zwei Wochen mit Kollegen veröffentlichte: Als sich der Ozean im mittleren Pleistozän -vor etwa 800.000 bis 700.000 Jahren -erwärmte, schrumpften Fische in der schwach durchleuchteten Dämmerzone tief im Meer um bis zu ein Drittel.
Für die meisten wechselwarmen Tiere -also Amphibien, Reptilien und Fische, deren Körpertemperatur von der Temperatur der Umwelt abhängt -werde erwartet, dass sie als Antwort auf den Klimawandel kleiner werden, erklärt Biologin Lisa Warnecke in ihrem Buch "Tierisch heiß"."Da eine Erwärmung die Stoffwechselrate erhöht, kann weniger Energie für das Wachstum bereitgestellt werden", schreibt sie. Als Beispiel führt Warnecke eine kleine Fischart namens Wüstenkärpfling an. Die Art reagierte auf die Temperaturveränderungen bereits damit, dass die Tiere innerhalb von sechs Jahren um ein Drittel weniger wogen und sich um sieben Prozent verkürzten.
Humboldt-Kalmare reagierten mit derselben Taktik, als sich der Golf von Kalifornien in den Jahren 2009 und 2010 stark erwärmt hatte. Fischer glaubten zunächst, sie seien verschwunden. "Sie wuchsen und vermehrten sich in der halben Zeit, ernährten sich anders und wurden nur halb so alt - mit dem Ergebnis, dass die ausgewachsenen Tiere nur noch den Bruchteil der früheren Größe erreichten und zu klein waren, um nach den Ködern zu schnappen, mit denen sie früher gefangen wurden", erzählt Thor Hanson in seinem Buch.
Die Antworten der Tiere auf die Klimakrise sind ebenso vielseitig wie faszinierend. Tiere verändern ihr Verhalten und ihre Körper, sie wandern und evolvieren. Doch nicht alle Arten werden sich schnell genug an die rasch fortschreitende Erwärmung anpassen können. Der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen (IPBES) zählt die Klimakrise nach der veränderten Land-und Meeresnutzung (etwa durch Entwaldung und Flächenraub) und der direkten Ausbeutung von Organismen (etwa durch Jagd und Fischfang) zum stärksten Treiber des Massensterbens. Es hat bereits eingesetzt. Laut IPBES sind eine Million Arten vom Aussterben bedroht.
Der neue Sachstandsbericht des Weltklimarates, der im Vorjahr erschien, erwähnt hunderte Tier-und Pflanzenarten, die ganze Populationen aufgrund der Klimakrise verloren haben. Etwa die weiße Subspezies des Lemuren-Ringbeutlers, die im australischen Queensland häufig vorkam. Die Hitzewellen im Jahr 2005 rafften sie dahin.
Die Grüne Meeresschildkröte gerät ebenfalls unter Druck. Denn ob Männchen oder Weibchen aus ihren Eiern schlüpfen, entscheidet die Temperatur. Eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigt, dass die Nistplätze der Grünen Meeresschildkröten im nördlichen Great Barrier Reef seit mehr als zwei Jahrzehnten hauptsächlich Weibchen hervorbringen, weil es dort so warm ist. Laut den Studienautoren drohe "die vollständige Feminisierung dieser Population in naher Zukunft".
Für die Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte ist das Spiel schon vorbei, sie wurde 2009 das letzte Mal gesehen. Neben dem Meeresspiegelanstieg dürfte auch die Zunahme an Sturmfluten die Art vernichtet haben, die auf einer Insel im Norden des Great Barrier Reef lebte.
Seit 2016 gilt der Nager offiziell als ausgestorben. Die Ratte ist das erste Säugetier, das die menschengemachte Klimakrise ausgerottet hat.