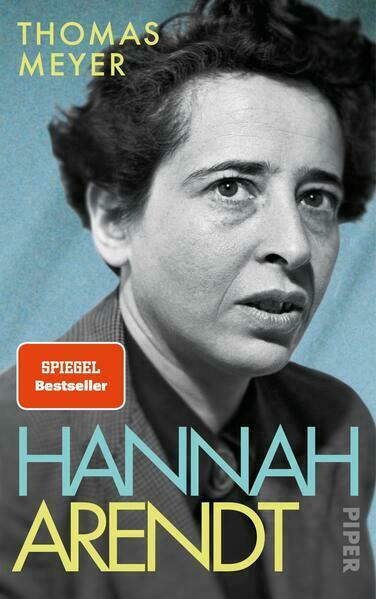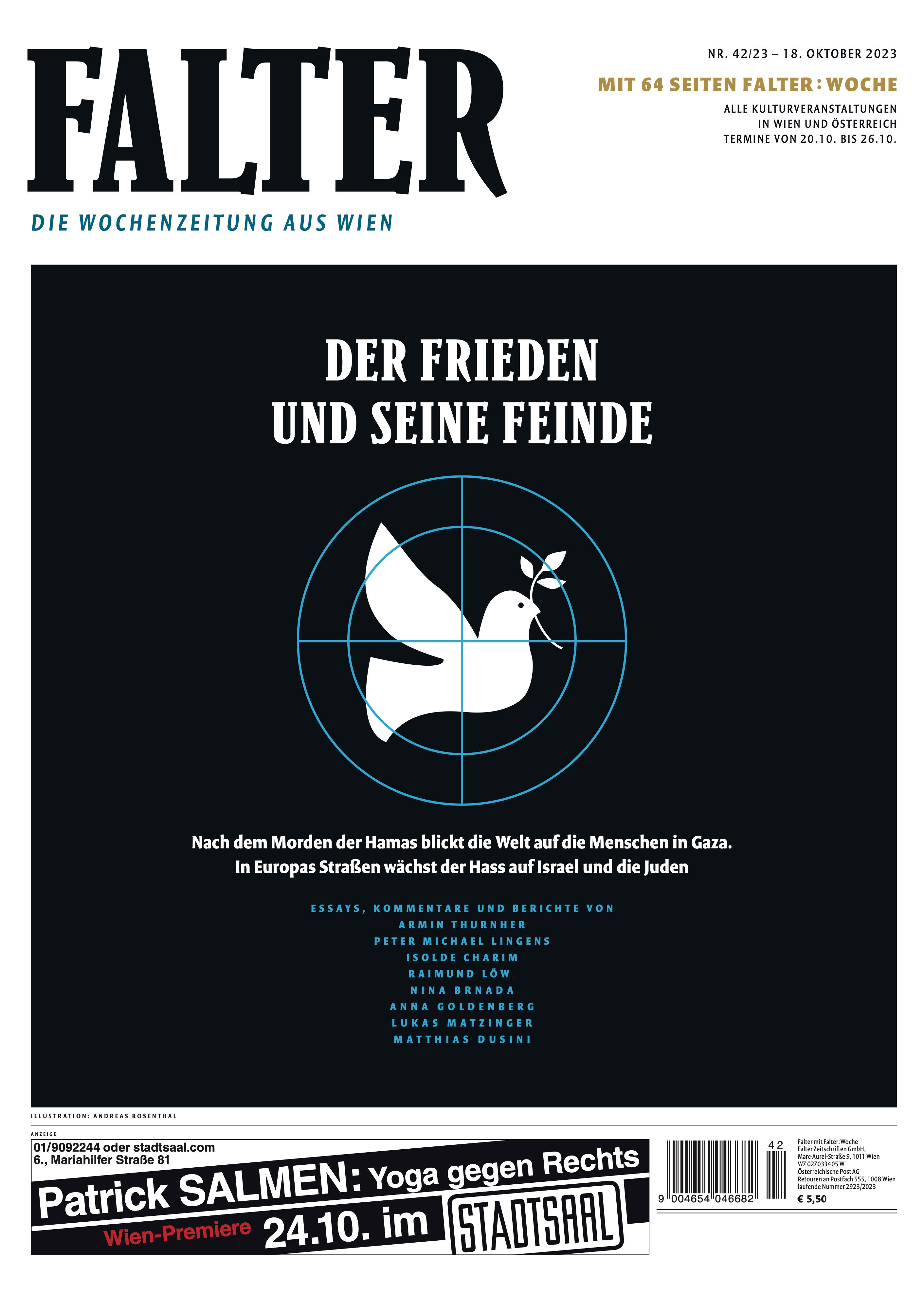
Von Königsberg nach New York
Thomas Leitner in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 35)
Hannah Arendt (1906–1975) war eine der bedeutendsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts und eine der ganz wenigen Frauen, denen man die Rolle einer öffentlichen Intellektuellen zugestand, in der BRD wie in den USA. Ihr Verlag Piper bereitet gerade eine zwölfbändige Studienausgabe vor. Der Leiter dieses Projekts, Thomas Meyer, Professor für Philosophie in München, hat begleitend dazu eine Biografie verfasst.
„Aristoteles wurde geboren, arbeitete und starb.“ Das genüge als Lebensbeschreibung, hat Arendts „Meister“ Martin Heidegger einmal verkündet. Es scheint, als wolle sich Meyer bei der Schilderung der privaten Arendt daran orientieren: Detailreich analysiert er den Entstehungsprozess und die hochkomplizierte Publikationsgeschichte der Werke, würdigt die oft aufsehenerregenden öffentlichen Auftritte und schildert das politische wie kulturelle Umfeld. Die Privatperson hingegen bekommt der Leser kaum zu fassen. Eine durchaus bewusste Prioritätensetzung: Meyer konzentriert sich auf das, was in der Fülle der bisherigen Publikationen unerwähnt blieb oder zu kurz gekommen ist. Vielleicht ist es daher ratsam, sich anderswo einen ersten Überblick zu verschaffen, um das hier sehr ausführlich dargelegte Material besser einordnen zu können.
Die Familienchronik der Arendts im ostpreußischen Königsberg schildert der Autor als Teil der später so brutal abgebrochenen Emanzipations- und Assimilationsgeschichte der deutschen Juden unter dem Zeichen der Aufklärung. Nach bescheidenen Anfängen war Hannahs Großvater zu Reichtum und Ansehen aufgestiegen, doch der frühe Tod des als Techniker und Erfinder hochbegabten, sozialistisch engagierten Vaters und der Erste Weltkrieg brachten die Erfolgsgeschichte der Familie zu einem frühen Ende. Der Autor lässt elegant anklingen, wie diese Formationsphase auf die Persönlichkeitsbildung einwirkte.
Einen seltsamen Kontrast dazu bilden die überbordenden Adressregister, in denen jeder Umzug festgehalten ist – hier empfiehlt sich die kapitelweise Lektüre oder die Nutzung als Archiv, um den Faden in der Datenfülle nicht zu verlieren, denn die Detailfreude geht bei den Studienjahren zwischen Marburg und Heidelberg weiter. Vorlesungen bei Philosophen wie Heidegger und Jaspers, Theologen wie Paul Tillich und vor allem dem Soziologen Karl Mannheim zeigen die weit gesteckten Interessen der Studentin und lassen ein dichtes Netzwerk an bedeutenden Kollegen entstehen (Walter Benjamin! Bert Brecht!).
Das jähe Ende der geistigen Blüte der Weimarer Republik führt ins Exil, zunächst nach Paris, zum Abbruch theoretischer Tätigkeit und zu sozialer Praxis. Meyer unterstreicht Arendts Engagement für die Jugend-Alijah (Flüchtlingshilfe zur Auswanderung jüdischer Kinder nach Palästina), auch um zu zeigen, dass ihre oft kritische Haltung Israel gegenüber nicht als antizionistisch zu werten ist. Neben der politischen Tätigkeit bleibt wenig Zeit für Publikationen und Privatleben. Den Übergang aus der Ehe mit dem Philosophen Günther Stern (der unter dem Namen Anders in der Nachkriegszeit zu einiger Berühmtheit gelangte) zu der mit Heinrich Blücher erwähnt Meyer nur so nebenbei, wie er überhaupt den Partnern wenig Platz gönnt. So ist diese Biografie vor allem eine Werk- und Wirkungsgeschichte. In der Schilderung der amerikanischen Emigrationsjahre, aus denen es keine Rückkehr gab, verstärkt sich das noch, da Arendts Publikationstätigkeit erst jetzt so richtig Fahrt aufnimmt und das öffentliche Interesse stetig wächst.
Einer der überzeugendsten Abschnitte des Buches gelingt in der Darstellung der überaus komplizierten Entstehungsgeschichte des bekanntesten Werkes der Denkerin: „The Origins of Totalitarianism“, „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“. Ein Textkonvolut, das jahrzehntelang verstreut veröffentlichte Vorarbeiten in drei thematisch recht divergierenden Blöcken zusammenfasst: die Geschichte der Assimilierung der deutschen Juden, den französischen Antisemitismus und den Charakter totalitärer Regime, worunter sie Nationalsozialismus und Kommunismus subsumiert. Auf die Kritik, die vor allem der dritte Abschnitt hervorrief, geht der Biograf wenig ein.
Auch bei anderen Kontroversen, wie etwa einem Artikel zur Rassentrennung („Reflections on Little Rock“), streift er die damals erhobenen Widersprüche nur: Arendt hatte darin für die strikte Trennung von privat und politisch argumentiert, was berechtigte Kritik hervorrief. In der Darstellung der heftigen Polemik anlässlich ihres Berichts vom Eichmann-Prozess bleibt manches unverständlich: Einerseits scheint der Begriff der „Banalität des Bösen“ angesichts der mediokren Befehlsvollstrecker plausibel und keineswegs verharmlosend, wie es Zeitgenossen Arendt vorwarfen. Andrerseits wirkte ihre Darstellung der Judenräte als Handlanger, wenn auch wider Willen, höchst unsensibel. Er wolle sich nicht auf ausgetretene Pfade der Diskussion einlassen, erklärt Meyer in seiner Einleitung – aber ein wenig mehr Stellungnahme hätte manchmal nicht geschadet.
Dafür läuft er dort zu großer Form auf, wo er Arendt mit leichter Ironie begegnet, etwa wenn er andeutet, dass sie in manchen Artikeln den Begriff „Essai“ (Versuch), allzu wörtlich nimmt und frisch von der Leber weg etwas behauptet. Oder wenn er die rhetorischen Tricks bei einer ihrer großen Feiertagsreden für den NS-verstrickten und auch sonst umstrittenen Heidegger entlarvt – Arendt bewunderte diesen nach einer Phase der kritischen Distanz unverständlicherweise wieder. Diese Treue kann auch Meyer nicht erklären. Gründet sie vielleicht im Pathos, das sie Philosophie als „Studium der entschlossenen Hungerleider“ bezeichnen lässt?