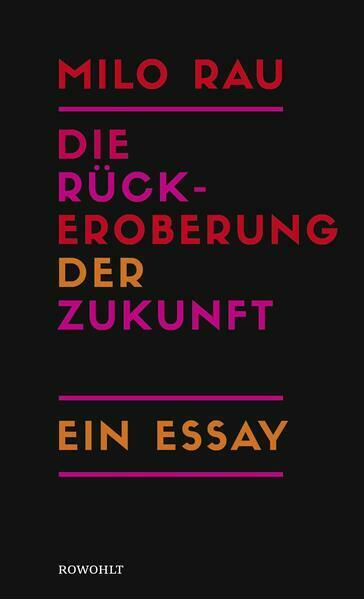Nur keine depressiven Goldfische im Aquarium
Robert Misik in FALTER 38/2023 vom 20.09.2023 (S. 20)
Kritiker haben ihn schon den "einflussreichsten" (Die Zeit) und den "kontroversesten" Theaterkünstler unserer Zeit genannt -den aus der Schweiz stammenden Autor und Regisseur Milo Rau. Anfang dieses Jahres wurde er in einem spektakulären Mutanfall der Verantwortlichen zum neuen Intendanten der Wiener Festwochen gekrönt, die vergangenen Jahre schuftete Rau als Leiter des Niederländischen Theaters in Gent. Seine "Antigone im Amazonas" riss bei den jüngsten Festwochen das Burgtheaterpublikum zu Ovationen auf die Beine. Im dichten Stakkato haut er auch Bücher und Großessays heraus. Eben wurde die "Rückeroberung der Zukunft" ausgeliefert.
"Die Rückeroberung der Zukunft", basiert auf den Zürcher Poetikvorlesungen des Vorjahres. Poetik legt er da gleich in voller Breite aus, als Poetik von Solidarität, von gemeinschaftlichen Erfahrungen, als Poetik des Kooperativen. "Die Poetik ist die Politik der Praxis". Erfahrungen, aus denen etwas ganz anderes entsteht, Seinsweisen realer Utopie.
Milo Rau ist all das: Künstler, Kämpfer, Denker. Seine Inszenierungen sind mal theatrale Aufstände, dann wieder "soziale Plastiken", die reale Konflikte in die künstlich-regelhaften Settings des Theaterraums bringen und zur Kenntlichkeit verfremden. Jede neue Unternehmung ein fragwürdiger Versuch. Gerne zitiert der 46-Jährige Pier Paolo Pasolinis Satz "Ich weiß, wie widersprüchlich man sein muss, um wirklich konsequent zu sein". In seiner Vorlesung fügt er hinzu: "Das sollte sich, finde ich, jede Künstlerin und jeder Künstler übers Bett hängen."
In unserer Zeit - der totalen Gegenwart ("Wie kann die Zeit rasen und zugleich so stillstehen? Warum macht uns das so verrückt?")- macht Rau fünf apokalyptische Reiter aus, und zwar die "Überinformiertheit", die "Kritik", die "Abgrenzung", den "Moralismus" und den "Realismus" im Sinne von eingebildeter Alternativlosigkeit, der Diskreditierung jedes Möglichkeitssinnes.
Wir können über jedes Thema so viel wissen, dass uns diese Tatsache handlungsunfähig macht. Kritik, an sich eine aufklärerische Tugend, schlägt um in den Narzissmus der kleinen Differenz. "Kluge Leute lieben es zu debattieren, oder mit anderen Worten: Recht zu behalten", formuliert Rau. "Wohl alle, die sich schon einmal engagiert haben, kennen diese Art des Streits: Er ist auf eine untergründige Weise boshafter, erbitterter, weniger auf Ausgleich aus, als man es bei Gleichgesinnten eigentlich annehmen könnte."
Rau appelliert an "unser aller Großzügigkeit", nicht zuletzt, weil die "Uneinigkeit der Wohlmeinenden" die herrschenden Verhältnisse stützt. "Es ist, als wären wir in einem Aquarium gefangen, nicht wahr? Ein Aquarium, in dem wir im Kreis schwimmen und gelegentlich nach einander schnappen, wie depressive Goldfische." An einer Stelle zitiert er das Urteil eines Weggefährten: "Milos Methode ist die Freundschaft."
Treffender kann man das kaum sagen. Der Menschenfischer Milo Rau geht nicht nur Kooperationen ein, mit Flüchtlingsaktivisten, Landbesetzern, Künstlern, Dissidenten und Aufdeckern, er schafft auch haltbare Netzwerke von Freundschaften. Man kann, wenn man boshaft wäre, das als "Aneignung" verunglimpfen. Aber es sind die "praktischen Solidaritäten" (anstelle falscher sektiererischer Abgrenzungen), die "reale Utopien" aufmachen. Auch das Denken von Milo Rau ist sein Denken und das der anderen. "Man kann nicht einsam denken", sagt er. Ein ehrliches, herrliches, selbstironisches und kluges Buch.