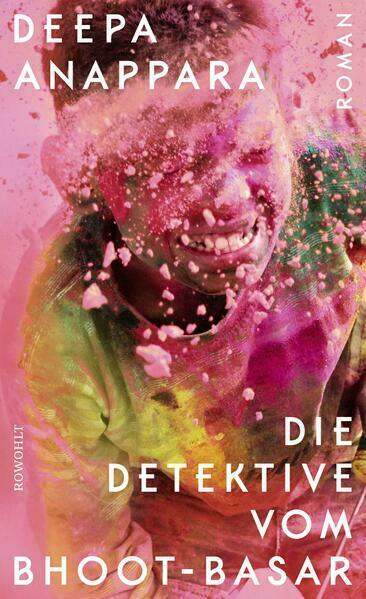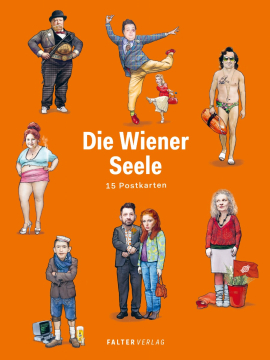Hoffen auf Detektive und Dschinne
Christina Dany in FALTER 11/2020 vom 11.03.2020 (S. 10)
In ihrem vielbeachteten Romandebüt widmet sich Deepa Anappara einem furchterregenden Phänomen
Es gibt Bücher, in die muss man sich erst über zwanzig, dreißig Seiten widerstrebend einlesen, bis man sich an die Sprache, den Rhythmus, den Tonfall gewöhnt hat. Die Gefahr besteht, dass man sie in dieser Warmlaufphase weglegt und erst wieder zur Hand nimmt, wenn man das bisher Gelesene schon wieder halb vergessen hat.
Und dann gibt es Bücher, da funktioniert gleich die erste Kapitelüberschrift wie eine Falltür zu einer abschüssigen Rampe, schon geht’s dahin ohne Halt mitten ins Geschehen, und man findet sich am Bahnhof einer indischen Metropole wieder, umgeben von Lärm, Hitze und Gestank, wo zerlumpte Kinder unter Lebensgefahr für ein paar Rupien Flaschen zwischen den Bahngleisen sammeln, beschützt vom Geist eines strengen Wohltäters, der denen zu Hilfe eilt, die ihn bei seinem wahren Namen rufen können. Ein starker Zauber. Und wenn man ein paar Stunden später verheult Nachwort und Danksagung liest, graut draußen der frühe Morgen.
Wie so eine Falltür-Kapitelüberschrift lautet? Zum Beispiel so: „Diese Geschichte wird euch das Leben retten.“
Das ist mal ein Anspruch an eine Story, die einem Respekt abnötigt.
Von 1997 bis 2008 arbeitete Deepa Anappara als Journalistin in Indien und beschäftigte sich vorwiegend mit den Themen Schule und Bildung sowie den Auswirkungen von Armut und religiöser Gewalt auf die kindliche Entwicklung. Tag für Tag sprach sie mit Lehrern, Schuldirektoren, Regierungsvertretern – und vor allem mit Schülern und Schülerinnen.
Anappara interviewte Kinder, die als Müllsammler arbeiteten, die an Straßenkreuzungen bettelten oder die wegen schwieriger sozialer Umstände kaum zu Hause lernen konnten oder die Schule ganz verlassen mussten. Dennoch wirkten die meisten von ihnen nicht wie Opfer und beeindruckten die junge Reporterin nachhaltig. Während dieser Zeit hörte die aber auch immer häufiger von vermissten Kindern aus armen Familien: Laut Statistik verschwinden in Indien jeden Tag etwa 180 Kinder spurlos.
Anappara ging nach London, wo sie Kreatives Schreiben studierte, und begann an einem Roman über diese Kinder zu arbeiten, „um daran zu erinnern, dass sich hinter den Zahlen Gesichter verbergen“. Im September vorigen Jahres hat sie ihn fertiggestellt, nun ist er bei Rowohlt auf Deutsch erschienen. „Die Detektive vom Bhoot-Basar“ ist ein eindrucksvolles Debüt, bereits mehrfach ausgezeichnet und binnen kürzester Zeit in 16 Sprachen übersetzt. Der Autorin ist der Sprung vom journalistischen Schreiben zur großen Literatur gelungen, ein Kunststück, an dem sich viele versuchen, das aber nur wenigen so überzeugend gelingt.
Wir folgen dem neunjährigen Jai, seiner großen Schwester Runu und deren Freunden Pari und Faiz durch die engen, schmutzigen Gassen einer Armensiedlung am Rande der Großstadt, wo die streng bewachten Hochhäuser der Wohlhabenden nur durch eine ausgedehnte Müllkippe von den schäbigen Hütten der Ärmsten getrennt sind. Die Eltern der beiden Protagonisten haben es noch relativ gut getroffen, die Mutter arbeitet als Hausmädchen bei einer reichen Madame, der Vater hat Arbeit am Bau.
Als Bahadur, ein Schulkollege von Jai und Runu, eines Tages spurlos verschwindet und die korrupte Polizei nicht daran denkt, etwas zu unternehmen, beschließen die Kinder, sich auf eigene Faust auf die Suche zu machen. Ein gefährliches Unterfangen, wie sich bald herausstellen wird.
Das Verschwinden des zehnjährigen Buben wird in der Nachbarschaft anfangs nicht besonders ernst genommen, man vermutet, dass dieser vor seinem ständig betrunkenen, gewalttätigen Vater weggelaufen ist und schon wieder auftauchen wird. Doch dann verschwinden weitere Kinder auf mysteriöse Weise. Unruhe macht sich breit, aber noch immer werden die verzweifelten Eltern auf der heruntergekommenen Polizeistation der kleinen Gemeinde vertröstet und abgewimmelt. Es kommt zu Spannungen, weil die Hindus die muslimische Minderheit zu Unrecht als Kindermörder verdächtigen.
Jais weitgehend fruchtlose Versuche, Verdächtige im Viertel auszumachen und unauffällig zu befragen, handeln ihm viel Ärger mit seinen Eltern ein. Aber er und seine Freunde lassen nicht locker, auch wenn sich lange kein rechter Fahndungserfolg einstellen will. „Tagsüber bin ich furchtlos, aber nachts verlässt mich der Mut. Ich glaube, der schläft dann“, konstatiert Jai verzagt.
Zu den anrührendsten und stärksten Passagen in Anapparas Roman zählen die Kapitel, die schlicht mit den Namen der verschwundenen Kinder überschrieben sind – sieben werden es am Ende sein – und in denen geschildert wird, wie sie ihrem Häscher in die Fänge geraten, ahnungslos bis zur letzten Sekunde.
Herausragend erzählt sind auch einige geschickt in den Handlungsverlauf eingearbeitete Geschichten, die von Bettlern erzählt werden und unter den Straßenkindern kursieren: von der Mutter eines vergewaltigten und getöteten Mädchens, die vor Kummer wahnsinnig wird; von dem verfallenen Palast der Dschinne, den die Menschen mit Zetteln besuchen, auf die sie Wünsche und Bitten geschrieben haben, in der Hoffnung, dass die Geister sie ihnen erfüllen mögen; und vom ehemaligen Straßenkind, das zum Beschützer anderer heranwuchs und auch nach seinem Tod noch über sie wacht.
„Diese Geschichte ist ein Talisman, sagte der Bettler im Rollstuhl. Drückt sie fest an eure Herzen.“