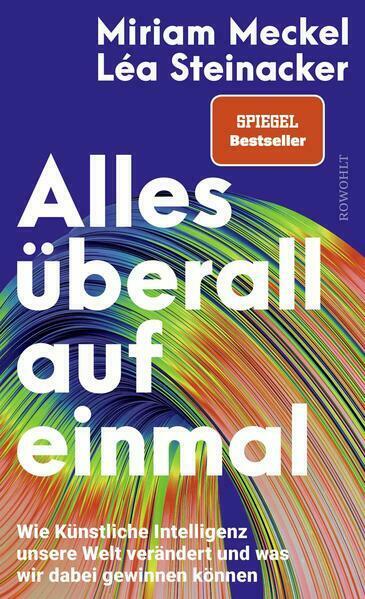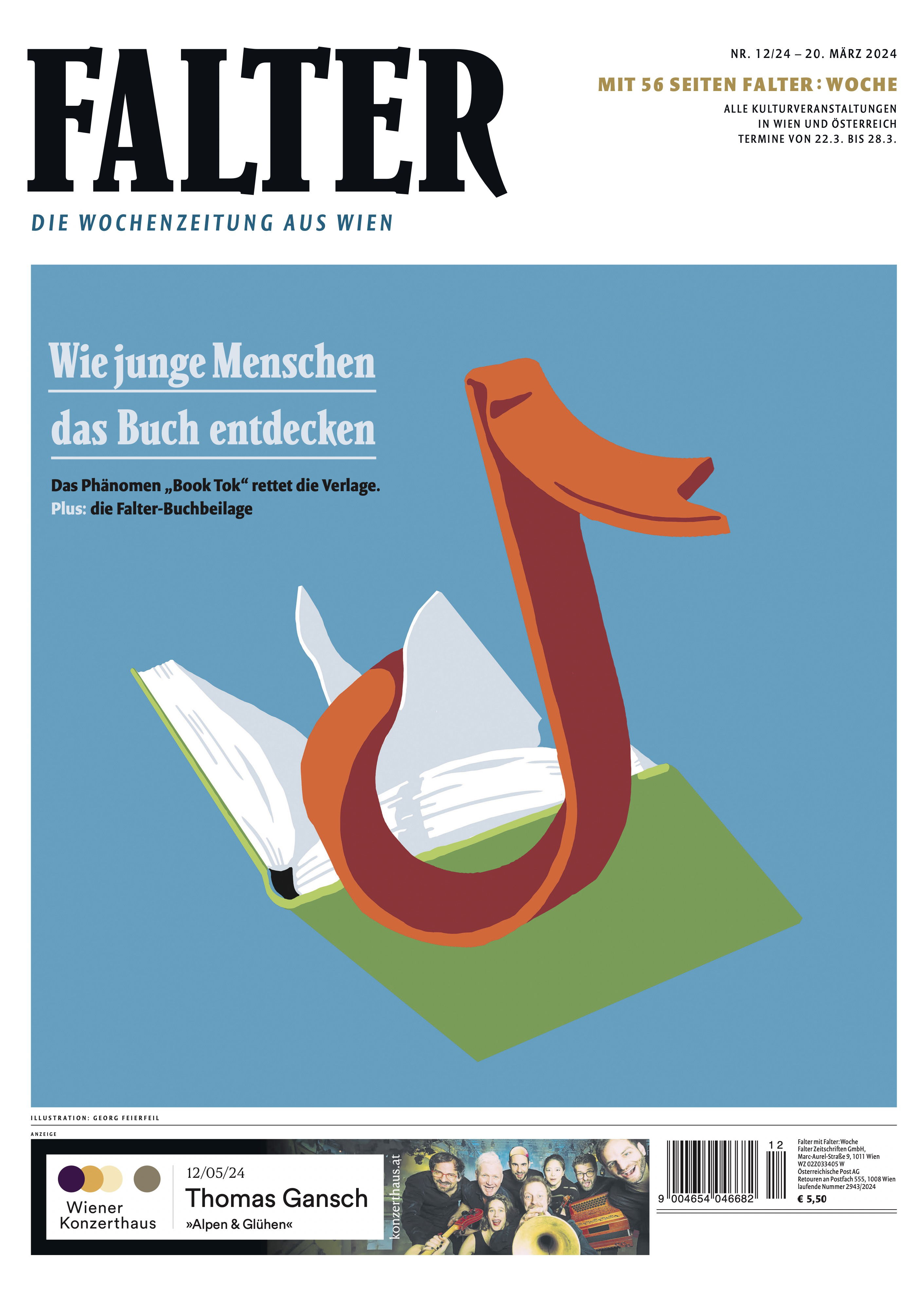
Werkzeug, Gefährtin – oder Beherrscherin?
Sebastian Kiefer in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 31)
Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig: zur Personalisierung von Suchmaschinen und Gesichtserkennung, zur Steuerung von Robotern, Verbesserung von Klimamodellen und für medizinische Diagnostik. Laien verwenden sie einfach; abstrakte Diskurse über eine eventuell überlegene Denkfähigkeit „intelligenter“ Maschinen und deren damit einhergehende Möglichkeit, Macht über Menschen zu erlangen, beschäftigen sie wenig.
Zumindest war das bis Ende 2022 so: Da ging das System namens ChatGPT wie ein Gespenst um die Welt und zwang auch das Laienpublikum, sich Fragen zu stellen wie: Können Maschinen nicht nur besser rechnen und Daten auswerten, sondern auch besser „denken“ als Menschen? Können sie irgendwann gar, so wie menschliches Bewusstsein, wirklich „intelligent“ und kreativ sein?
Erstmals ist KI für jeden verfügbar, und „alles verändert sich überall und auf einmal“, so Miriam Meckel und Léa Steinacker. Beide sind weder Technikerinnen noch Philosophinnen, sondern befassen sich praktisch wie theoretisch mit den möglichen Folgen der KI für Leben und Selbstverständnis des Einzelnen. Meckel, ehemalige Chefredakteurin der Wirtschaftswoche, ist Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen, Steinacker ist Sozialwissenschaftlerin und Unternehmerin. Das Buch der beiden eignet sich für ein Publikum, das sich wenig für technische Grundlagen interessiert oder für Reflexionen darüber, was KI uns über das Denken lehren kann, das jedoch verstehen will, welche Chancen und Gefahren die Durchdringung unserer Kultur mit KI mit sich bringt.
ChatGPT vermag sekundenschnell Texte nahezu beliebiger Art und Thematik so zu produzieren, dass sie erstaunlich menschlich, originell oder stilistisch gekonnt klingen: Beispielsweise kann das Tool ein im Stil Shakespeares gehaltenes Gedicht über das Dilemma der Digitalisierung schreiben. Einen Entwurf für eine Unternehmensstrategie bringt es ebenso zuwege wie Kalauer oder Antworten auf philosophische Fragen.
Systeme wie ChatGPT, die die Funktionsweise neuronaler Netzwerke imitieren, sind in Grenzen lernfähig: Sie werden nicht programmiert, sondern „trainiert“, indem sie meist selbstständig in riesigen Datenmassen Regeln (bzw. Wahrscheinlichkeiten) der Verknüpfung von Worten (oder sonstigen Daten) finden. Das reproduziert naturgemäß Stereotype und Klischees. Und weil solche Systeme (noch) nicht zwischen Fiktion und Fakten unterscheiden können und auch keine moralischen Bedenken kennen, ist entscheidend, welche Daten zum Trainieren eingespeist werden. Dass die meisten dies nicht offenlegen, ist daher Gegenstand juristischer und politischer Auseinandersetzungen. Darüber informiert das Buch wünschenswert leserfreundlich.
Die Neigung des Menschen, „intelligente“, ja sogar dialogfähige Maschinen wie seinesgleichen zu behandeln, ist für die Autorinnen lediglich ein psychologisches Problem. Ginge es nach ihnen, wäre KI nie mehr als ein komfortsteigerndes Werkzeug: „Jenseits von Untergangsszenarien und Techno-Utopien muss es stets darum gehen, den Menschen durch künstliche Intelligenz zu unterstützen, zu bestärken und besser zu machen, nicht aber sukzessive durch KI zu ersetzen. Wir haben zu Beginn argumentiert, dass ‚angereicherte Intelligenz‘ oder ‚maschinelle Nützlichkeit‘ bessere Begriffe wären für eine Technologie, die letztlich ein Werkzeug ist.“
Das ist allerdings keine Hypothese, sondern ein frommer Wunsch, der die erkenntnistheoretische Dimension einfach ausblendet. Wenn die Autorinnen am Ende ihr erhofftes Szenario der Zukunft mit KI skizzieren, ist diese denn auch so banal wie ein Werbefilm: KI-Roboter sind nützliche Helfer im Haushalt. KI hat Energie- und Rohstoffprobleme gelöst, sodass man unbelastet von ökologischen Bedenken um die Welt fliegen kann. KI macht, dass man, ohne aus dem Haus zu gehen, virtuell neue Kleider austesten kann. Kurz: Das Buch formuliert weniger eine Zukunftsutopie, als dass es den Konsumismus von heute träumt, der sich dank KI ungehemmt steigern lässt.