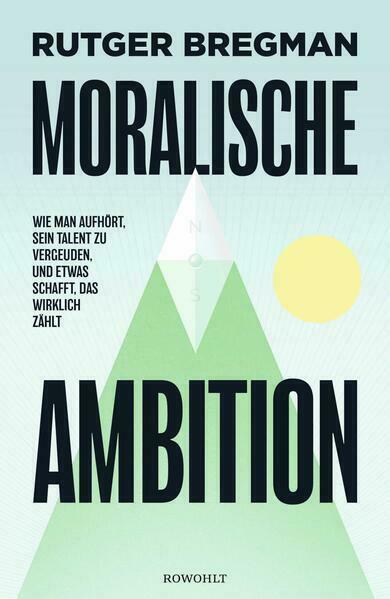"So wie Sie sind, sind Sie nicht gut"
Klaus Nüchtern in FALTER 10/2025 vom 05.03.2025 (S. 31)
Im Grunde ist Rutger Bregman ein Menschenfreund; einer von der Sorte, die hinsichtlich der Gattungsgenossen freundliche Ansichten hegt. In seinem Bestseller "Im Grunde gut" (2020) führt der niederländische Historiker und Aktivist zahlreiche Belege dafür an, dass Menschen auch in Ausnahmesituationen selbstloser handeln, als dystopische Fiktionen oder psychologische Experimente suggerieren.
Weil man darob aber nicht selbstgefällig zu werden braucht, richtet Bregman seinen Lesern gleich im ersten Kapitel seines jüngsten Buches aus: "Nein, so wie Sie sind, sind Sie nicht gut" - und schildert ihnen den Weg der "moralischen Ambition", den zu wandeln er uns anweist, mit Diagrammen, Tabellen und Statistiken, mit Warntafeln und lehrreichen Exempeln aus, die vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichen.
Wir begegnen der "moralischen Dampfmaschine" Thomas Clarkson (1760-1846), der entscheidenden Anteil an der Abschaffung der Sklaverei hatte; dem Dickkopf Arnold Douwes (1906-1999), der seine niederländischen Landsleute dazu anhielt, jüdische Mitbürger vor den deutschen Besatzern zu verstecken; der US-Bürgerrechtsikone Rosa Parks (1913-2005), die durch ihre standhafte Weigerung, ihren Sitzplatz einem Weißen zu überlassen, den legendären Busboykott von Montgomery auslöste; oder Rob Mather, der 2005 die Against Malaria Foundation gründete und durch die Bereitstellung von Millionen Moskitonetzen in Afrika hunderttausende Menschen vor einer womöglich tödlichen Infektion gerettet hat.
Die Botschaft, die durch dergleichen exemplarische Lebensläufe verkündet werden soll: Einzelne Menschen sind sehr wohl in der Lage, schier Unglaubliches zu leisten, vorausgesetzt, sie kriegen a) erst einmal den Arsch hoch und legen es b) schlau, sprich: ergebnisorientiert, an.
Für die Apologeten woker Awareness, die sich auf der richtigen Seite der Geschichte wissen, ohne echte Veränderungen anzustoßen, hat Bregman wenig mehr als Verachtung übrig: Sie zählen für ihn zum Typus der "noblen Verlierer".
Genuine moralische Ambition setze nämlich den Willen voraus, auch Menschen ins Boot zu holen, die einer anderen Weltansicht anhängen. "Moral Reframing" nennt sich die Strategie, mit der man sie dazu bringen kann, das Richtige aus den "falschen" Gründen tun. So erwies sich etwa der Hinweis des gewieften Thomas Clarkson, dass jeder fünfte der gegen Tropenkrankheiten besonders anfälligen britischen Matrosen die Fahrt auf den Sklavenschiffen nicht überlebte, als besonders wirksames Argument für die Abschaffung der Sklaverei. Eitelkeit und Egozentrik sind für moralisch Ambitionierte ein absolutes No-Go. Statt einem selbstergriffenen "Follow your passion"-Ethos zu folgen, möge man sich als "effektiver Altruist" kundig machen, was die Welt wirklich braucht und wofür es sich zu spenden lohnt. Non-Profit-Organisationen wie GiveWell helfen bei der Entscheidung.
Was einem auf die Nerven gehen kann an dieser Erbauungsliteratur 2.0, ist die lässig-launige Life-Coach-Prosa, mit der Bregman seine Leserschaft moralisch fit machen möchte. "Gefühle sind overrated" ruft er dieser zu oder verordnet ihr "ein infektiöses Mindset". Er schwärmt von den "Teslas der Wohltätigkeitsbranche" und lässt allen Ernstes Sätze vom Stapel wie: "Das Leben im Widerstand war Spitzensport."
Schon rein stilistisch lässt sich kaum ein größerer Gegensatz vorstellen als jener zur jüngsten Publikation des US-Philosophen Thomas Nagel. Der schmale, zwei Aufsätze enthaltende Band "Moralische Gefühle, moralische Wirklichkeit, moralischer Fortschritt" will keine Handlungsanleitung sein, sondern geht auf anspruchsvolle und akademisch-abstrakte Weise der Frage nach, welche Legitimität moralische Urteile beanspruchen können.
Die Philosophie des Utilitarismus betrachtet selbst "private Laster" als moralisch gerechtfertigte Handlungen, solange diese zum Wohle der Allgemeinheit beitragen. Nagel hingegen hält dafür, dass auch eine Form von Moral existiert, die unabhängig von ihren Konsequenzen in sich richtig ist. Das Verbot der Folter gelte eben absolut, auch wenn durch ihren Einsatz Menschenleben gerettet werden könnten. Der Respekt, der uneingeschränkt jedem Individuum zukomme, stelle ein "moralisches Minimum" dar: "Es gibt bestimmte Dinge, die keiner von uns dem anderen antun darf."
Was Nagel bei allem Unterschied zu Bregman mit diesem teilt, ist die Skepsis gegenüber all jenen, die sich der Vergangenheit gegenüber moralisch überlegen dünken. Gerade der Glaube an die ethische Erziehbarkeit des Menschengeschlechts lässt es als zwingend erscheinen, dass zukünftige Generationen über unsere moralischen Vorstellungen genauso empört die Nase rümpfen werden, wie wir Heutigen über die Standards von Sklavenhaltergesellschaften.
Für Nagel existieren moralische Prinzipien, die gleichsam immer schon wahr gewesen, und solche, die erst ab einem bestimmten Entwicklungsstand gesellschaftlichen Bewusstseins einsehbar geworden sind. So seien etwa die allgemeinen Menschenrechte, wie wir sie kennen, selbst historisch, weil sie auf einer Vorstellung von individuellen Rechten beruhten, die sich erst im Lauf der Moderne herausgebildet habe und in der Frühen Neuzeit, geschweige denn in der Antike buchstäblich nicht denkbar gewesen sei.
In ihrer Auffassung von moralischem Fortschritt berufen sich sowohl Nagel als auch Bregman auf den australischen Philosophen und Tierethiker Peter Singer und dessen Konzept der Expanding Circles. Dieses besagt, dass sich moralische Geltungssphären ausbreiten; sie beschränken sich zunächst nur auf einen kleinen Kreis Privilegierter und erfassen nach und nach Menschen anderen Geschlechts, anderer Klasse und Ethnie, schließlich auch nichthumane Geschöpfe.
Einen eklatanten und sehr rasch sich durchsetzenden moralischen Fortschritt macht Nagel in Hinblick auf die Diskriminierung von Homosexualität aus. Eine "Globalisierung der Gerechtigkeit", die in der Lage wäre, weltweite, durch den Klimawandel noch verstärkte Wohlstandsasymmetrien auszugleichen, hält er aufgrund unserer noch stark nationalstaatlich determinierten Vorstellungen vorerst für rein utopisch. Was zukünftige "moralische Revolutionen" anbelangt, gibt sich der Philosoph vorsichtig zuversichtlich: "Ich vermute, sie werden durchaus stattfinden."
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: