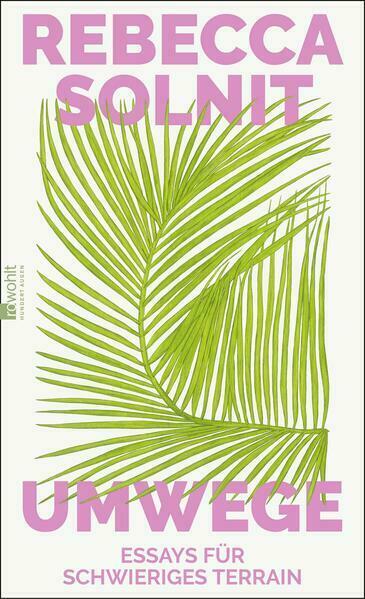Eine Schildkröte auf einer Party von Eintagsfliegen: Rebecca Solnits Plädoyer gegen das Vergessen
Klaus Nüchtern in FALTER 23/2025 vom 04.06.2025 (S. 29)
"Es war die beste Zeit, es war die schlechteste Zeit", zitiert Rebecca Solnit den Anfangssatz aus Charles Dickens' "politischstem Roman" -"A Tale of Two Cities" - und fügt hinzu: "So ist es meistens." Das Zitat findet sich in dem ursprünglich 2004 erschienenen und nun erstmals ins Deutsche übersetzten Buch "Hoffnung in der Dunkelheit", und wer es liest und auch den jüngsten Band "Umwege" zur Hand nimmt, wird die Kontinuität im Denken und Schreiben Solnits nicht übersehen. Sie ist ihren Themen -Klimawandel und Umweltschutz, Feminismus und toxische Männlichkeit, Defätismus und Aktivismus - treu geblieben, hinzugekommen ist das Gendersternchen, und statt "homosexuell" heißt es jetzt "queer".
Die US-Autorin, die demnächst ihren 64. Geburtstag begeht, schreibt beharrlich an gegen das binäre Denken, das nur zwischen dem endgültigen Sieg über das kapitalistische System und dessen finalen Triumph zu unterscheiden vermag; Pessimismus und Optimismus gelten ihr gleichermaßen als "Feinde der Hoffnung", indem beide vorgeben zu wissen, wie die Zukunft aussehen wird und so die Unvorhersehbarkeit historischer Verwerfungen - wie etwa den Fall der Berliner Mauer und das Zerbröseln der bipolaren Weltordnung -ignorieren.
Sie fühle sich mitunter wie eine Schildkröte auf einer Party von Eintagsfliegen, schreibt Solnit und verordnet gegen die grassierende Geschichtsvergessenheit einen Imperativ des Erinnerns, "damit wir wissen, dass es Besseres gibt als Chaos und Niedergang". Um Fortschritte als solche zu erkennen, müsse man diese bis zu ihren oft Jahrzehnte zurückliegenden Wurzeln verfolgen und auch das prozesshafte Wesen von Revolutionen begreifen. Ihren Anfang nehmen diese als Ideen in den Köpfen von Menschen, die vielfach als Phantasten und radikale Spinner abgetan werden, aber letztendlich in die Mitte der Gesellschaft vordringen. Sie sind dort zwar nicht vor Backlashes gefeit, aber gekommen, um zu bleiben. Der Sexualstraftäter und "Storykiller" Harvey Weinstein wird, wie Solnit trocken, aber wohl nicht ohne Genugtuung anmerkt, "aller Wahrscheinlichkeit nach im Gefängnis sterben"; und er wird dadurch tausenden Männern, die nun so "total verwirrt" sind wie der sich in Selbstmitleid suhlende Täter, als warnendes Beispiel dienen -und tausenden Frauen das Schicksal seiner Opfer ersparen.
Ihrer eigenen Maxime entsprechend, der zufolge man den Narrativen des Neoliberalismus andere Erzählungen entgegenhalten muss, erinnert Solnit an die Zapatistas des Subcomandante Marcos oder die Battle of Seattle gegen die Internationale der Konzerne von 1999. Sie würdigt Bewegungen der "radikalen Mitte", der es -abseits von Hierarchien, doktrinären Theorien und linkem Sektierertum -darum geht, durch unwahrscheinliche Allianzen eine Veränderung zum Positiven zu erreichen, anstatt ständig danach zu fragen, "wo jemand herkommt oder was für eine Art Hut sie oder er trägt". Solnits Essays sind auch ein potentes Remedium gegen den identitätspolitischen Puritanismus der Gegenwart.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: