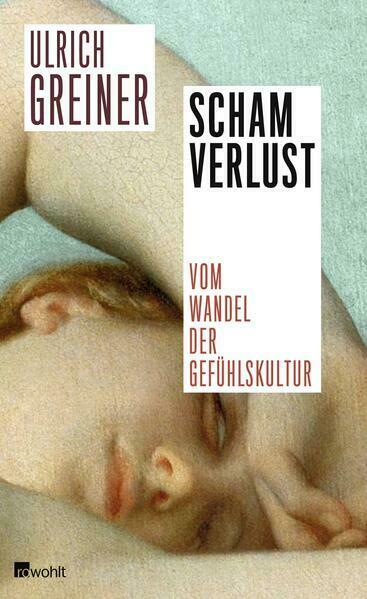Scham, Schuld, Peinlichkeitsfurcht und Puritanismus
Stephanie Doms in FALTER 11/2014 vom 14.03.2014 (S. 43)
Kulturgeschichte: Ulrich Greiner untersucht den Wandel der Gefühlskultur vom biblischen Sündenfall bis zu Lady Gaga
Von Lady Gagas Selbstinszenierung über den Dresscode der heutigen Jugend bis hin zu den sexuellen Eskapaden namhafter Politiker, die in aller Öffentlichkeit breitgetreten werden: Was dem einen die Schamesröte ins Gesicht treibt, lässt den anderen kalt; was gestern noch ein Verstoß gegen die Norm war, erregt heute nur mehr das gewohnte Maß medialen Aufsehens.
Wir scheinen in einer Zeit des kollektiven Schamverlusts zu leben. In diese Kerbe schlägt auch Ulrich Greiner, der mit seinem neuesten Werk den "Wandel der Gefühlskultur" rekonstruiert.
Scham, Schuld und Peinlichkeit - auf Basis dieser drei Begriffe arrangiert der 1945 geborene Greiner sein Buch. Das Alter des Autors ist in diesem Zusammenhang nicht ohne Bedeutung, denn besonders zu Beginn lässt er auch eigene Erfahrungen einfließen. Den Wandel des Schamverhaltens verortet der bekannte Journalist und Literaturkritiker Ende der 1960er-Jahre, als Nacktheit zunehmend enttabuisiert wurde.
Diese Veränderung führte nicht nur dazu, dass der Begriff des Normalen, des Angemessenen dehnbarer wurde. Ebendiese Flexibilität des Verhaltenskodexes erschuf gleichzeitig eine neue "Peinlichkeitsfurcht", die Angst, nicht zu genügen. Ob Selbstkasteiung durch Diäten oder 70-Stunden-Wochen: Greiner sieht darin eine neue Form des Puritanismus, die die heutige Gesellschaft prägt.
An dieser Stelle löst er sich von einer chronologischen Herangehensweise und sucht in Literatur, Philosophie und Sozialwissenschaft nach Beispielen dafür, wie Scham, Schuld und Peinlichkeit entstehen konnten und können bzw. in welchem menschlichen Verhalten sie sich äußern.
Dieser Teil macht den eigentlichen Kern des Buches aus. Während Kapitel zwei und drei eher oberflächlich bleiben, geht Greiner nun in die Tiefe und verwebt unterschiedliche Quellen - von Herodot über Thomas Mann bis hin zu Pierre Bourdieu und Jean-Paul Sartre - gekonnt miteinander.
Die Herleitung der Scham aus dem Sündenfall in der Bibel und die Verbindung mit dem Freiheitsgedanken gestaltet Greiner ebenso spannend wie die Abschnitte über Selbstreflexion und Fremdbeobachtung als Auslöser des Schamgefühls. Fragen der Macht spielen ebenso hinein wie Lust und Faszination.
Diese Mischung aus aktuellen Ereignissen und gesellschaftlichen Phänomenen, persönlichem Erleben, wissenschaftlichen Ansätzen und Beispielen aus der Literatur lässt einen Sog entstehen, der den Leser in die Thematik hineinzieht. Auf dem Weg ins Auge dieses Argumentationswirbels eröffnet Greiner immer wieder neue, spannende Perspektiven. Langatmig sind dabei maximal einige literarische Auszüge und Nacherzählungen, die den Lesefluss bremsen - insgesamt wenige Passagen, die dem Lesevergnügen insgesamt aber keinen Abbruch tun.
Es ist "nur" ein ambitionierter Versuch, Herkunft und Bedeutung von Scham zu charakterisieren und ihren Wandel im Laufe der Geschichte nachzuzeichnen, an dem Greiner uns teilhaben lässt. Denn dass das Feld der Schamgefühle endlos ist, wie der Autor anfänglich meint, wird mit jedem weiteren Absatz klarer.
Die Fülle an Interpretationen, die Greiner aufzeigt, ist groß; endgültige Begriffsdefinitionen gibt es nicht. Die meisten Darstellungen im Kontext der Scham und des Schamverlusts erscheinen schlüssig, nur manche Formulierung irritiert. Dass die Mutmaßungen und Meinungen des Autors stellenweise durchscheinen, sieht man dem Buch aber nach; auch deshalb, weil Greiner eingangs erwähnt, dass es keinen wissenschaftlichen Zweck erfüllen soll. So wird auch seine offenkundige und subjektive Faszination für das Thema, die man schon bald zu teilen beginnt, auf der Pro-Seite verbucht.
Am Ende schließt man ein Buch, das mindestens so viele Fragen aufwirft, wie es beantwortet, den Leser jedoch um zahlreiche Einsichten in menschliche Triebe und menschliches Treiben reicher macht - Medienberichte über die Schweißflecken der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Besuch der Bayreuther Festspiele eingeschlossen.