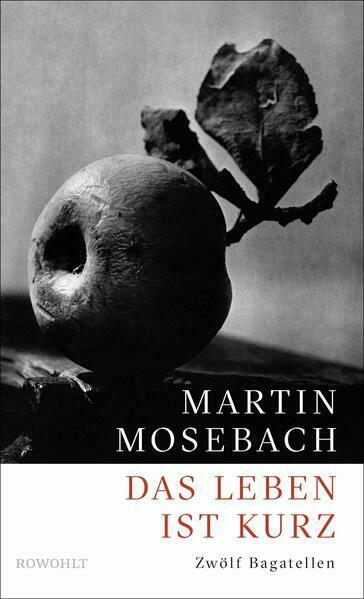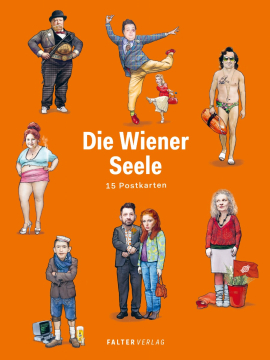Wenn Banker Kinderaugen machen
Jörg Magenau in FALTER 41/2016 vom 12.10.2016 (S. 26)
In „Mogador“ versetzt Martin Mosebach einen Düsseldorfer Banker zum Wohle aller an die afrikanische Atlantikküste
Mogador liegt an der marokkanischen Atlantikküste oder, wie es im Roman einmal heißt, am „Ende der Welt“. Mogador ist der alte Name des heutigen Essaouira, indem Martin Mosebach ihn gewählt hat, entrückt er seine Geschichte, die sehr wohl in der Gegenwart angesiedelt ist, zugleich in eine unbestimmte Zeitlosigkeit.
Der junge, in seiner Bank schon ziemlich hoch aufgestiegene Patrick Elff ist nach Mogador geflohen, weil gewisse „Unregelmäßigkeiten“ (wie das so schön heißt) in seiner Abteilung aufzufliegen drohen. Dort hofft er, den dubiosen Monsieur Pereira zu treffen, dem er beim Verschieben von Millionen geholfen hat und der ihm deshalb noch einen Gefallen schuldet. Seine Frau hat er ohne Benachrichtigung in Düsseldorf zurückgelassen, so schnell und spurlos musst er verschwinden.
Wie immer in seinem Leben ist er auch in diese Sache widerstandslos hineingeraten, hat die Schwarzgeldgeschäfte allenfalls ein wenig zu deutlich geduldet. „Was sich ergeben hatte, das war ein Ereignis, keine Tat“, resümiert Elff, der eigentlich Literaturwissenschaftler ist, so wie auch seine Frau Pilar, die nun Immobilien makelt.
Diese willenlos entgegengenommene Schicksalhaftigkeit ist seit eh und je das große Thema von Martin Mosebach und seiner Antihelden. Mit „Mogador“ tritt er den Beweis dafür an, indem er Patrick Elff in eine völlig andere Welt versetzt. Hat man im ersten der vier Teile noch den Eindruck, es handle sich um einen Kriminalroman übers Finanzmilieu, gerät der Held nun – ohne aber zu verstehen, wo er sich befindet – in ein exquisites und dezent operierendes Bordell. Die Chefin, Khadija, ist eine mächtige Frau, die im Unterschied zu ihm genau weiß, was sie tut. Zugleich ist sie – seit sie als Kind eine Katze in den Ofen geschleudert hat – mit einem feurigen Dämon verbündet, der ihr visionäre Kräfte verleiht. Jedenfalls glaubt sie selbst mit Erfolg daran. Sie ist die archaische, matriarchale Gegenfigur zu diesem westlichen Manager wider Willen, zu einem Macher, der nichts vom Machen versteht.
Vorübergehend hat Elff alle Brücken hinter sich abgebrochen und auch die SIM-Karte aus seinem Handy entfernt. Das liest sich wie ein ironischer Kommentar auf die Debatte um Mosebachs Roman „Das Blutbuchenfest“, als dem Autor vorgeworfen wurde, dass da im an sich noch handylosen Jahr 1991, in dem der Roman spielt, in Bosnien allzu wild mobiltelefoniert werde.
Wie schon in früheren Roman – ob diese nun in Indien, Bosnien oder der Türkei angesiedelt sind – läuft Mosebach immer dann, wenn es um die archaische Gegenwelt geht, zu großer Form auf. Wirkt seine Prosa zu Beginn noch ein wenig hölzern und ins Kostbare hochgestemmt, bekommt sie hier Saft und Kraft und Sinnlichkeit, die vom Kontrast zwischen äußerer Armut und dem Reichtum seiner immer ein wenig preziösen Sprache lebt.
Mosebach liefert eine grandiose, seitenlange Schilderung der Meeresbrandung; und mit präzisem Blick erfasst er die Ökonomie einer Gesellschaft, in der die Bettler und die korrupte Polizei für die nötige Umverteilung des Geldes sorgen – auch ökonomisch ist Mogador eine Gegenwelt zum Düsseldorfer Bankermilieu. Die Geburt eines Kalbes wird so zum Ereignis, in dem das Rätsel des Lebens aufleuchtet. Wie aus einer anderen Welt gefallen blickt das Neugeborene mit glänzenden, reinen Augen in den dreckigen Stall.
Am Ende flieht Patrick Elff erneut, diesmal zurück nach Deutschland und in sein altes Leben, das aber so nicht mehr existiert. „Jede Flucht“, das war ihm zuvor klar geworden, „ist eine Bewegung auf den Untergang zu.“
Mosebach gewinnt dieser Bewegung intensive Momente ab, gerade da, wo alles Planen und Handeln zum Stillstand kommt. Wenn zeitgleich mit „Mogador“ auch der Bagatellen-Band „Das Leben ist kurz“ erscheint, hat das allenfalls die Funktion, die Fallhöhe von großer Literatur zu publizistischer Gelegenheitsprosa zu markieren. Vielleicht war es auch ein Begrüßungsgeschenk für den von Hanser zu Rowohlt gewechselten Büchnerpreisträger. Ansonsten hätte es diesen Begleitband nicht gebraucht.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: