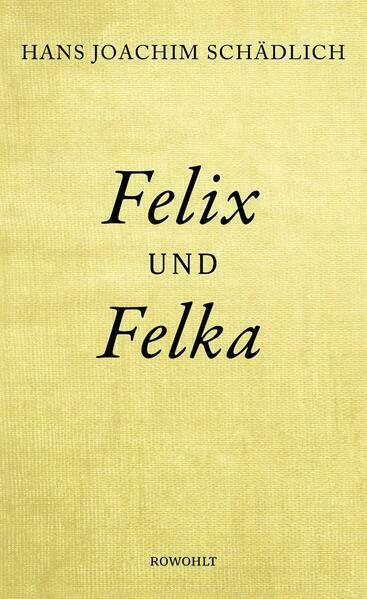Graupensuppe mit Glacéhandschuhen
Sigrid Löffler in FALTER 11/2018 vom 14.03.2018 (S. 22)
Hans Pleschinski und Hans Joachim Schädlich erzählen von zwei Künstlerschicksalen in der NS-Zeit
Zwei Romane, die den gleichen Stoff verhandeln. In beiden wird erzählt, wie das Hitler-Regime berühmte Künstler zugrunde richtet. Und doch könnten die beiden Künstlerromane gar nicht verschiedener sein. Zweierlei extrem unterschiedliche Künstlerleben werden thematisiert: hier der zwischen Wegducken und Aufmucken schwankende Nutznießer und zaudernde Vorzeigekünstler des „Dritten Reichs“; dort das jüdische Opfer des Regimes auf der vergeblichen Flucht, verfolgt von Hitlers Schergen und gehetzt von Exilort zu Exilort.
Hier Hans Pleschinski, der in seiner Romanbiografie „Wiesenstein“ die letzten Lebensmonate des Dramatikers und Erzählers Gerhart Hauptmann in dessen fürstlicher Dichterresidenz im schlesischen Riesengebirge in eine große Wortoper verwandelt, indem er sie als opulentes Ausstattungsepos erzählt – stilprunkend, in üppiger historischer Kulisse und mit viel Statisterie.
Dort Hans Joachim Schädlich, der in „Felix und Felka“ von Flucht, Verfolgung und Ermordung des jüdischen Malerehepaares Felix und Felka Nussbaum in extremer lakonischer Verknappung berichtet, reduziert bis zum absolut Unumgänglichen in seiner wortkargen Nüchternheit, die sich jegliche Ausschmückung verbietet und das herzzerreißende Elend ins Nichtgesagte zwischen den Zeilen verlagert.
Opulenz gegen Lakonie, Wortprunk gegen Sachlichkeit, Prahlhans Pleschinski gegen Schmalhans Schädlich. Wobei eines schon klar ist: Der in Reichtum und Ruhm vergreisende Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann, der in seiner pompösen Villa Wiesenstein in Agnetendorf bis zuletzt fürstlich Hof hält, diensteifrig umwuselt von Domestiken und Bewunderern, erfordert einen anderen Erzählton als der verfolgte, verstört durch Europa flüchtende und in italienischen und belgischen Exilorten herumirrende Maler Felix Nussbaum, der mit seiner ostjüdischen Ehefrau Felka Platek in immer größere Angst und immer verzweifeltere Not gerät, je unerbittlicher alle Flucht-und Lebenschancen schwinden, bis schließlich ein Gestapo-Spitzel die untergetauchten Eheleute in ihrem Brüsseler Mansardenversteck aufspürt und nach Auschwitz in den Tod schickt.
Es beginnt im Mai 1933 in der Villa Massimo in Rom, wo die Stipendiaten Felix Nussbaum und Arno Breker noch als Ateliernachbarn arbeiten können. Bis Blut fließt. Ein Maler namens Hanns Hubertus Graf von Merveldt attackiert Nussbaum aus schierem Judenhass und schlägt ihm die Nase blutig. „Es ist nichts Ernstes. Sie können unbesorgt sein“, meint der Arzt. Abgründige Worte. Sie hallen nach im Leser, der das Ende ahnt. Dem Direktor der Villa Massimo bleibt nichts übrig, als beide Kontrahenten zu entlassen.
So beginnt die elfjährige Odyssee von Felix und Felka, die in die völlige Ausweglosigkeit führen wird. Hans Joachim Schädlich beschließt sein Komprimat des Unglücks der Familien Nussbaum und Platek mit einem Memento, das in seiner lapidaren Dürre umso beklemmender wirkt. Er führt zehn Namen von Familienmitgliedern auf, mit Geburts- und Todesdatum: „Ermordet 1944 in Auschwitz.“ „Ermordet 1944 in Stutthof.“ Oder, wie im Falle von Felkas Eltern: „Verschollen.“
Hans Pleschinski seinerseits konzentriert sich in „Wiesenstein“ auf die letzten 15 Lebensmonate Gerhart Hauptmanns. Der Roman beginnt mit dem Untergang Dresdens im Feuersturm vom Februar 1945, den Hauptmann und seine Entourage am Rande miterleben. Und er endet mit dem Tod des 83-jährigen Großdichters und „Volkskönigs“ (so Thomas Manns spöttisches Etikett) im Juni 1946, mit der Enteignung der Villa Wiesenstein und der Vertreibung ihrer Bewohner durch die Polen.
Erzählt wird im Rückblick der Nachglanz eines zusehends unzeitgemäß fürstlichen Dichterlebens, während es in der grandiosen Kulisse des Wiesenstein-Haushalts und unter der Assistenz von einem Dutzend Domestiken seine eigene Theatralik noch einmal nachzuspielen sucht, in zunehmender Weltfremdheit der eigenen Schwäche und Schäbigkeit trotzend. Diese große Allüre inmitten der allgemeinen Auflösung, während sich draußen vor der Haustür die Welt gerade katastrophisch umstülpt, wirkt tapfer und wehmütig, aber auch ein wenig lächerlich in ihrem hohlen Gepränge.
Die im Neorenaissancestil errichtete Villa Wiesenstein ist nicht bloß der Schauplatz, sondern der heimliche Protagonist des Romans. Auf dieser großen Bühne inszeniert Pleschinksi seine Geschichte eines mehrfachen Untergangs: Das Lebensende des Dichters und das Ende der Dichtervilla Wiesenstein fallen zusammen mit dem chaotischen Kriegsende, dem Untergang des „Dritten Reiches“ und der Vertreibung der Deutschen aus Schlesien.
In den besten Momenten des Romans kann der Autor diesen tragikomischen Stimmungsmix aus Imposanz und Zerfall gut in Schwebe halten. Auf Wiesenstein versammelt man sich trotz Hunger und Not, Kälte und Strommangel immer noch in Abendgarderobe und im Kerzenschein zum Dinner. Dieses besteht zwar nur aus Graupensuppe und Brennnesselauflauf, wird aber vom livrierten Butler in Glacéhandschuhen serviert. Und eine sowjetisch-ostdeutsche Besucherdelegation mit Johannes R. Becher an der Spitze wird vom Butler und einem Dienstmädchen mit Häubchen und weißer Schmuckschürze begrüßt, der mutmaßlich „letzten Zofe zwischen Eisernem Vorhang und Wladiwostok“.
Pleschinski zeigt einen Hausherrn, der geistig und körperlich immer mehr verfällt, während er angstvoll seine lebenslangen inneren Widersprüche zu harmonisieren sucht, quasi letzter Hand. Sein inkohärentes Gestammel, über das sich schon Thomas Mann im „Zauberberg“ lustig gemacht hatte, als er den Kollegen Hauptmann in der Gestalt des trunken schwadronierenden Mijnheer Peeperkorn karikierte, wird immer unverständlicher und verliert sich in Gebrabbel und mystischem Geraune, das von seinem Eckermann, dem Chronisten Gerhart Pohl, gleichwohl getreulich festgehalten und überliefert wird.
Pleschinskis Hauptaugenmerk gilt den Unstimmigkeiten und Ambivalenzen in Hauptmanns Denken und Werken, vor allem auch dessen uneindeutiger Haltung gegenüber dem NS-Regime, schwankend zwischen Anpassung, Ausweichen und leisem Widerstand. Nach seinen radikalen naturalistischen Anfängen, die mit sozialkritischen Werken wie „Die Weber“ oder „Bahnwärter Thiel“ seinen Weltruhm begründeten und ihn als „Gewerkschaftsgoethe“ abstempelten, vollzog Hauptmann eine Wendung zum Mystizismus und entwirft märchenhafte Gegenwelten voller Kobolde und Feen. Bei Pleschinski stilisiert sich der greise Dichter zum „überbordenden Allgeist“, sich selbst ein stolzes Rätsel und erhaben über subalterne logische Widersprüche. Die Flucht in Traumreiche verteidigt Hauptmann als Bemühen, das Unvereinbare zu vereinen: „Ich bin für Kompromisse, weil ich die äußere Bequemlichkeit brauche, um mich meinen inneren Gegensätzen widmen zu können.“
Leider hat Pleschinski den Ehrgeiz, Hauptmanns vergessene Werke zu reanimieren, in der Meinung, sie seien reif für die Wiederentdeckung. Zum Beleg zitiert er erschöpfend aus Hauptmanns zu Recht versunkenen Hexameter-Versepen und dem bombastischen Wortschwall seiner lyrischen Jamben. Mehr noch: Hauptmanns Schwulst scheint ansteckend zu wirken und infiltriert bedenklich auch Pleschinskis eigene Erzählprosa mit leerem Wortgeklingel. Weingläser trumpfen da als „funkelnder Kristall“ auf und ein geheiztes Zimmer ist „Labsal, Manna, höchster Genuss“. Ungewollt bestätigt Pleschinski mit solchen Formulierungen die Antiquiertheit in Schreibe und Denke, die den antimodernen Großteil von Hauptmanns Œuvre der verdienten Vergessenheit hat anheimfallen lassen.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: