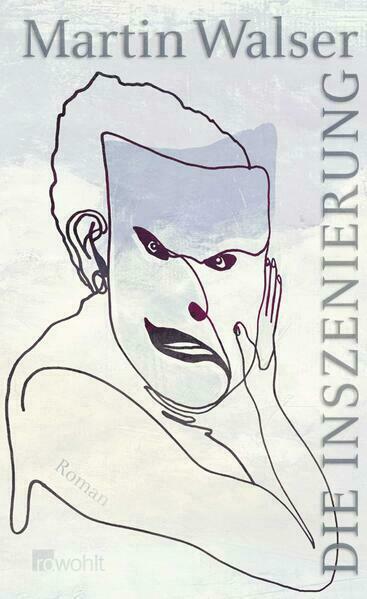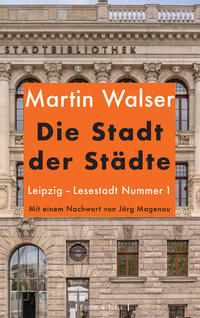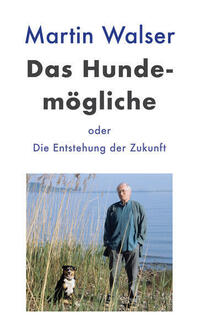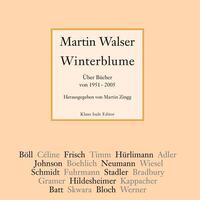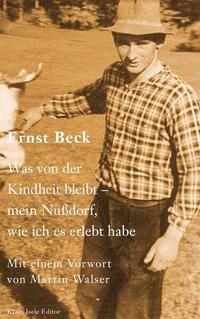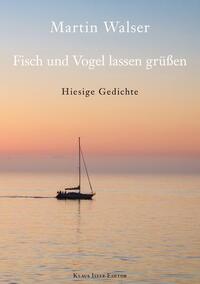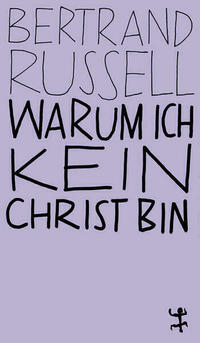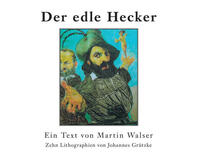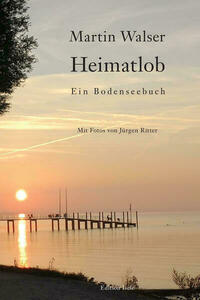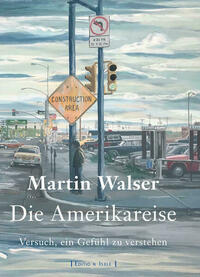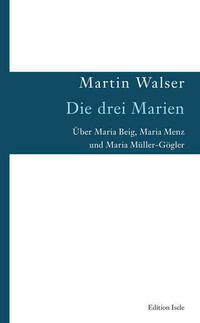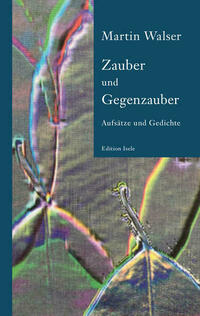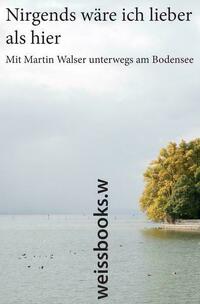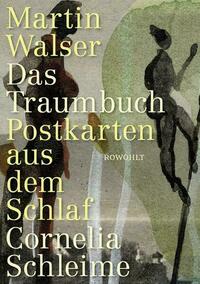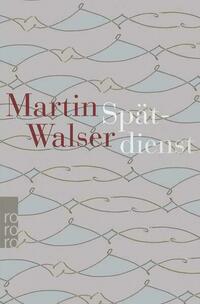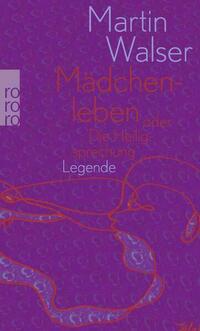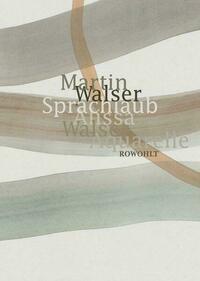Die erotische Dreifaltigkeit erprobter Unmöglichkeiten
Jörg Magenau in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 22)
In "Die Inszenierung" kommt Martin Walser diesmal ohne Erzähler aus: Der Roman ist eigentlich ein Theaterstück
Ein Krankenhauszimmer als Theaterbühne. Mehr braucht Martin Walser nicht für seine Inszenierung großer Gefühle. Der Regisseur Augustus Baum ist während der Proben für Tschechows "Möwe" zusammengebrochen und wird nun im Krankenhaus von seiner Geliebten, der Nachtschwester Ute-Marie, und seiner Ehefrau, der Ärztin Gerda, versorgt – von der einen mit Leidenschaft und sexueller Hingabe, von der anderen mit Müsli und unersetzlicher Vertrautheit.
Das ist trivial und darf es auch sein, denn schließlich ist alles, was geschieht, Teil einer Inszenierung. Mit beiden Frauen verbindet Augustus ein Verhältnis, das in seiner Unterschiedlichkeit mit dem Begriff "Liebe" nur ungenau beschrieben wäre. "Liebe gibt es eben in Tonarten, die miteinander nicht verwandt sind", sagt der gar nicht so krank wirkende Regisseur.
Die verschiedenen Tonarten neben- und miteinander erklingen zu lassen, sodass sie sich weniger stören als stützen, das ist fast so etwas wie das Lebensthema des Erzählers Martin Walser, von seinen frühen Romanen der Anselm-Kristlein-Trilogie bis hin zu seinem Spätwerk seit "Der Augenblick der Liebe" (2004).
Immer wieder variiert er seither die erotische Dreifaltigkeit als Utopie, um nach Lösungsmöglichkeiten für diese konfliktreiche Grundkonstellation zu suchen. Zuletzt, in "Das dreizehnte Kapitel" (2012), geschah das in Form eines Briefwechsels. Jetzt, in "Die Inszenierung", ist es ein Theaterstück, jedenfalls ein Roman in Dialogform.
Es ist, als ob Walser die Romanform zu eng geworden wäre, als ob er nicht mehr bereit wäre, die Allwissenheitsillusion einer souveränen Erzählerstimme herzustellen. Stattdessen soll jede der auftretenden Figuren ungebrochen und ungefiltert zur Sprache kommen.
Ein philosophisch orientierter Freund des darniederliegenden Regisseurs, der sich brieflich zu Wort meldet, nennt ein mögliches Vorbild: "Platon hat als erster Schluss gemacht mit dem Darüberschreiben. Direkte Rede! Rede und Widerrede! Spruch und Widerspruch! Anstatt die Tonart des jeden Widerspruch erstickenden, monologisch-monomanen Behauptens fortzusetzen!" Es ist klar, dass diese Einsicht Konsequenzen hat. Der konventionelle Roman ist damit obsolet geworden. Walser hebt ihn auf im Theater. Es wäre allerdings schon bedauerlich, wenn es der endgültige Abschied des Erzählers vom Erzählen wäre.
"Die Inszenierung" handelt von einer (scheiternden) Tschechow-Inszenierung, doch auch im Krankenzimmer, wo die Besucher(innen) sich die Klinke in die Hand geben, wird nichts als Theater gespielt. Vielleicht, so eine mögliche Lesart dieses Kammerspiels, ist Liebe nichts anderes als eine Inszenierung, die die Bereitschaft voraussetzt, an die selbst hervorgebrachten Illusionen zu glauben.
Augustus weiß, dass auch der Regisseur
den Regisseur immer nur spielt – dass er also Teil seiner theatralischen Versuchsanordnung ist. Das ändert aber nichts daran, dass das, was so entsteht, echt ist und die Gefühle unerbittlich Wirklichkeit beanspruchen.
Ehefrau Gerda ist diejenige, die das am genauesten verstanden hat. Sie publiziert ein Buch mit dem Titel "Abhängigkeit, Wahn und Wirklichkeit", in dem sie Abhängigkeit als Ursache aller Krankheiten bezeichnet. Ihr Gatte bietet ihr dafür genügend Anschauungsmaterial.
Martin Walser vergrößert und übersteigert die gegenseitigen Idealisierungen und Spiegelungen der Liebenden im Krankenhaus geradezu genüsslich, um sie bis in den Schmerz des Verzichtenmüssens hinein auszukosten. Das Walser'sche "Unglücksglück" ist schließlich das einzig mögliche, das "alles enthaltende, alles spendende, alles wendende Glück". Wenn es am Ende zur großen Versöhnung kommt und zum utopischen Hände-Ineinanderlegen der beiden gegensätzlichen Frauen an Augustus' Bett, dann ist das reine Inszenierung, Wunschtraum und nichts als Theater. Nur hier, auf der Bühne der erprobten Unmöglichkeiten, kann gelingen, was das Leben nicht vorsieht. Martin Walser beweist das mit diesem radikalen, auf mildernde Umstände ganz und gar verzichtenden Stück.