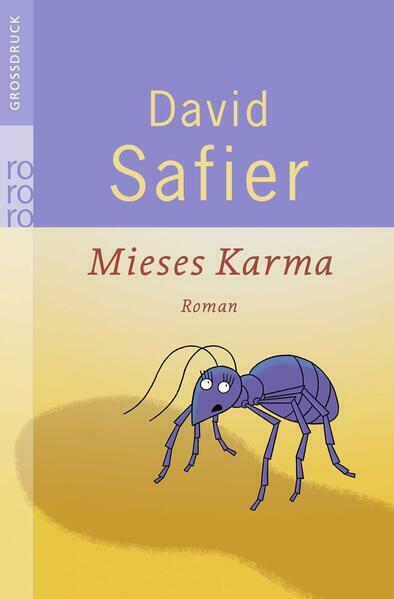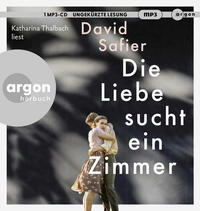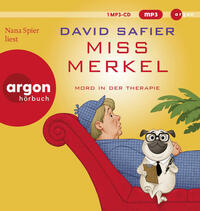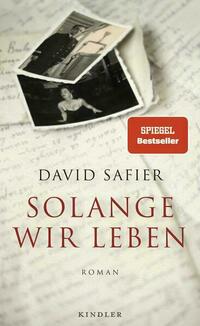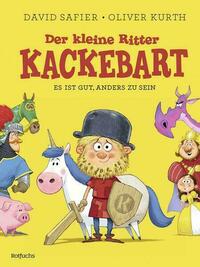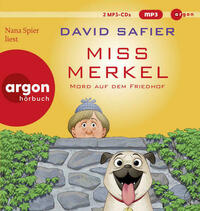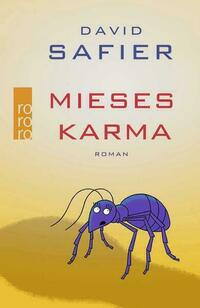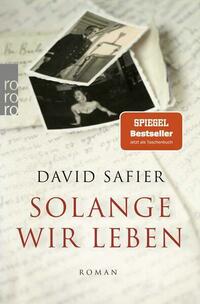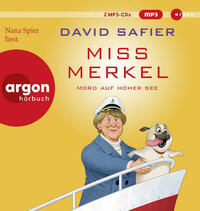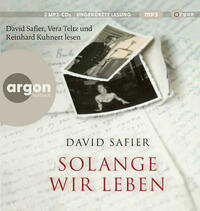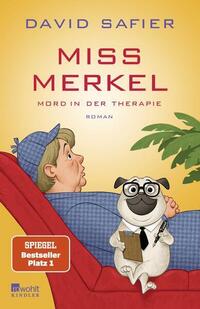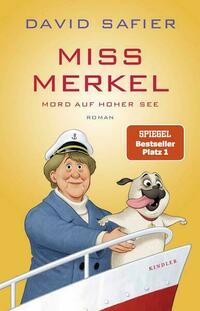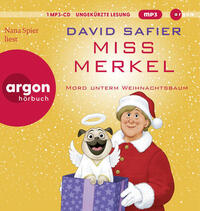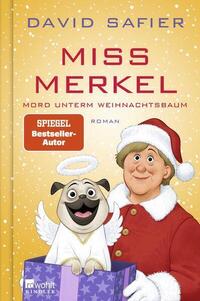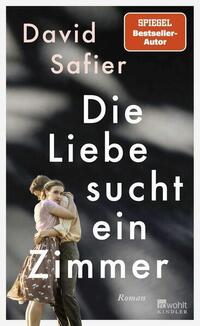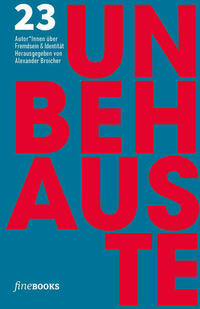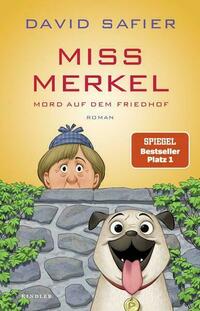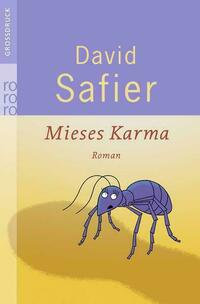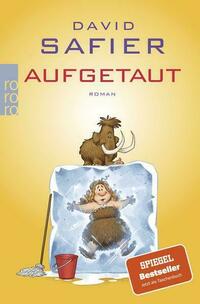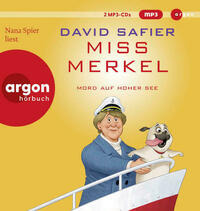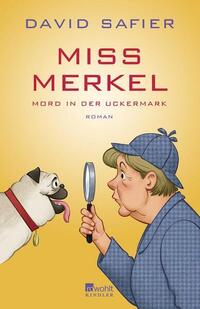„Der Krebs ist ein Workaholic“
Eva Konzett in FALTER 46/2016 vom 16.11.2016 (S. 42)
Die Tumorbiologin und Nachwuchsforscherin Sibylle Madlener über gedopte Krebszellen, Sitzbäder in Guatemala und warum das Leben als Laborratte mit Lichttagen belohnt wird
Kurz vor der Station Michelbeuern AKH wird der vollgestopfte Wagen der U6 unruhig. Wie ein einziger träger Körper schieben sich die Menschen gesammelt zum Ausgang. Patienten, Angehörige und Spitalspersonal strömen vom Bahnsteig in Richtung des rostbraunen Kolosses. Sibylle Madlener wartet vor der Kinderklinik, rechts vom Haupteingang.
Falter: Frau Madlener, in Österreich stirbt fast jeder Zweite an Herz- und Kreislauferkrankungen, rund ein Viertel an Krebs. Trotzdem hat jeder Angst vor der Krebsdiagnose und weit weniger vor dem Herzinfarkt. Können Sie das verstehen?
Sibylle Madlener: Bei einer Krebsdiagnose bricht erst einmal die Welt zusammen, egal, in welchem Stadium der Krebs ist. Der Patient hat das Gefühl, ausgeliefert zu sein, nichts machen zu können. Er weiß, dass das bisherige Leben vorbei ist. Bei Herz- und Kreislauferkrankungen gibt es chirurgische Hilfsmittel wie Stents, Bypässe oder Herzschrittmacher, die dem Patienten rasch helfen. Beim Krebs hat man immer die schlimmen Nebenwirkungen der früheren Chemotherapien vor Augen, als man den Körper flächenmäßig mit Chemie vollgepumpt hat. Dass die Nebenwirkungen aufgrund der verbesserten Therapieansätze heute schwächer sind, tut nichts zur Sache. Die Assoziationen sind die alten geblieben.
Der Krebs ist Ihr langjähriger Begleiter. Nicht als Krankheit, sondern als Forschungsobjekt.
Madlener: Ja. Angefangen habe ich mit Leukämie bei Erwachsenen, mit Brustkrebs, mit Kolonkarzinomen, also Dickdarmkrebs. Nun bin ich bei den kindlichen Gehirntumoren angelangt. Hier in der Kinderklinik des AKH in der Abteilung für Neuroonkologie versuchen wir unter anderem Biomarker zu identifizieren, die ein Rezidiv bei Gehirntumoren, etwa beim Medulloblastom, anzeigen. Also dass der Tumor streut oder metastasiert. Wir wollen das Rezidiv früh und ohne aufwendige, schmerzhafte Methoden für das Kind bemerken. Das Ziel ist eine Art Schnelltest mit Biomarkern mittels einer Blutabnahme, als würde man Zucker messen. Wir wollen diesen vor allem bei den Kleinkindern mit Tumoren anwenden. 40 bis 70 Prozent der Kinder mit embryonalen Tumoren entwickeln einen Sekundärtumor, und dieser ist besonders aggressiv. Man muss ihn also rechtzeitig finden, um die Heilungschancen zu verbessern und um einer geistigen Retardierung vorzubeugen. Wir betreiben hier Forschung zu Hirntumoren, bei Kindern die zweithäufigste Tumorart. Sollte unsere Forschung zu neuen Therapieansätzen beitragen, können wir dadurch wirklich Lebensläufe verändern. Manche Kinder entwickeln schon mit sechs Monaten einen Tumor. Das ist schon hart.
Wenn man Wissenschaftler über die Motive ihrer Spezialisierungswahl befragt, antworten viele mit dem Zufall. Hat auch der Krebs Sie gefunden?
Madlener: Das kann man so sagen. Während des Studiums habe ich ein Seminar am Krebsforschungsinstitut in der Borschkegasse im neunten Bezirk gemacht. Ich bin damals raus aus der Lehrveranstaltung und wusste: Ja, das ist, was ich machen möchte, was Sinn hat. Mit der Diplomarbeit hat es begonnen, dann kamen die Dissertation – „Einfluss von physiologischen und pharmakologischen Stressfaktoren auf die Zellzyklus-Regulation“ – und Forschungsreisen nach Guatemala. Inzwischen arbeite ich seit knapp acht Jahren an der Kinderklinik des AKH.
Was sucht eine Krebsforscherin im guatemaltekischen Dschungel?
Madlener: Ich habe im Rahmen meiner Dissertation auch das ethnobotanische Feld kennengelernt, also die Idee, pflanzliche Wirkstoffe für die Therapien heranzuziehen. Deshalb bin ich mit Kollegen nach Guatemala gefahren. Wir haben immer die Vorstellung, dass Medikamente als Pillen daherkommen müssen, aber auch die indigene Bevölkerung hat Rezepturen. Zudem sind auch die herkömmlichen Medikamente oft pflanzlichen Ursprungs oder gehen auf andere natürliche Substanzen zurück, die dann meist synthetisiert und chemisch verändert wurden. Denken Sie an Penicillin. Für die Pharmaindustrie ist dieser Schritt wichtig, weil man das Medikament sonst nicht patentieren kann. Pflanzen allein kann man nicht patentieren. Die Mayas in Guatemala haben uns gezeigt, welche Pflanzen sie bei „cancero“, also bei Geschwüren allgemein, verwenden und wie sie sie aufbereiten, das war extrem spannend. Sie arbeiten vor allem mit Sitzbädern und mit Teeaufgüssen. Wir haben die vielversprechendsten Pflanzen mit nach Wien genommen, diese extrahiert und die einzelnen Fraktionen auf unsere Krebszellen im Labor losgelassen, durchaus mit Erfolg.
Aus dem alten Ägypten weiß man von Verhütungsmethoden mit Krokodildung, der die Spermien abtötete. Das heißt, dass auch die Stoffe aus Guatemala wirksam waren, wenn auch nicht in der angewendeten Konzentration?
Madlener: Ja. Die Pflanzen hatten zum Teil tatsächlich eine entzündungs- und wachstumshemmende Wirkung. Sie haben teils die Viren-DNA inhibiert, also gehemmt und zerstört. Tumoren wie der Gebärmutterhalskrebs können ja über Viren ausgelöst werden. Die Mayas wenden oft Sitzbäder an. Bei der Behandlung solcher Zervixkarzinome könnten die Wirkstoffe also tatsächlich bis zur Gebärmutter gelangen. Das ist nicht alles Hokuspokus, wobei ich natürlich niemals ein Pflänzchen gegen eine Krebstherapie eintauschen würde. Bei einem Bauchspeicheldrüsenkarzinom bringt mir ein Sitzbad oder ein Tee herzlich wenig. Der Input aber war wichtig. Wir haben auch einiges darüber publiziert und werden bis heute zitiert.
Magenkrebs, Darmkrebs, Hautkrebs – es gibt kein Organ, das nicht davon befallen werden kann. Was aber ist der Krebs genau?
Madlener: In normalen Zellen werden die Wachstumsphasen durch verschiedene Regulationsmechanismen kontrolliert. Diese Pathways regulieren und aktivieren Gene, um der Zelle Aufträge zu erteilen: Teile dich! Beweg dich! Stirb! Bei Tumoren sind diese Signalwege durch Veränderungen oder Mutationen disreguliert. Mutationen in Genen können jederzeit auftreten, sei es durch genetische oder äußere Faktoren, meist werden sie aber durch verschiedene Reparaturmechanismen wieder korrigiert und unschädlich gemacht. Je nach Alter der Zelle kann es aber zu Fehlern in den Reparaturwegen der DNA kommen, dann bleibt die Mutation in der DNA erhalten und wird bei der Zellteilung weitergegeben. Das ist der Ursprung des Krebses, weil daraus Onkogene, also Krebsgene, entstehen können. Das muss nicht sein, wenn aber diese Onkogene ins Spiel kommen, beginnt die Tumorzelle sich zu vermehren und verdrängt dabei die anderen Zellen. Die gesunden Zellen sagen irgendwann: Der neben uns ist so ein Workaholic, da müssen wir nichts mehr tun! Sie schränken ihr Wachstum ein und verbleiben in einem Ruhezustand und überlassen den Tumorzellen das Feld.
Weil sie gegen die arbeitswütigen Tumorzellen nicht ankommen?
Madlener: Die Mutation bringt der Tumorzelle im Vergleich zu den anderen einen Vorteil. Das ist wie Doping. Der Vorteil kann darin bestehen, dass sie nicht mehr abstirbt. Normalerweise unterliegen Zellen einer Art inneren Uhr, diese induziert nach einer bestimmten Anzahl an Zellteilungen einen Ruhezustand bzw. geregelten Zelltod. Die Tumorzelle hat diese Uhr ausgeschaltet bzw. hat die Fähigkeit, diese zu umgehen. Sie stirbt einfach nicht. Sie ist unendlich. Zum Beispiel die HeLa-Zellen, das sind Tumorzellen einer Amerikanerin, die in den 1950er-Jahren an einem Zervixkarzinom erkrankte und starb. Man kultiviert diese Zellen bis heute weltweit in den Laboren. Das sind eins zu eins die Tumorzellen von Frau Henrietta Lacks. Sie sind so hochaggressiv, dass sie bis heute wachsen. Ein anderer Vorteil kann sein, dass im Zellzyklus der Tumorzellen die Checkpoints ausgesetzt werden. Bei einer normalen Zelle sind diese als Kontrollen im Zellzyklus eingebaut. Erst wenn alle Faktoren signalisieren, dass sie bereit sind, geht die Zellphase ins nächste Stadium, so wie wenn man bei der Raststation auf alle wartet, bevor man weiterfährt. Bei der Tumorzelle schreit ein Onkogen aber ständig: Alles in Ordnung, weiter! Und die anderen Faktoren haben keine Zeit zu kontrollieren, ob wirklich alles passt. Das Radl rennt dann einfach durch, und die Zellen mit fehlerhafter DNA vermehren sich. Fasziniert hat mich immer, dass – überspitzt gesagt – die Krebszelle eigentlich nur eine topmotivierte Zelle ist, die einfach viel arbeitet. Dabei richtet sie solchen Schaden an. Das Krasse ist, dass man aggressive Tumorzellen im Grunde mit allem Möglichen behandeln kann. Am Schluss wird fast immer eine überleben, die dann möglicherweise auch noch Resistenzen gegen das Medikament entwickelt hat.
Wie die Schabe, die nach dem Atombombenangriff weiterkrabbelt?
Madlener: Ja. Es ist unfassbar. Wir haben unsere Tumorzellen im Labor mit verschiedenen Chemotherapeutika behandelt, nur um zu erkennen, dass manche nach der Absetzung der Behandlung noch aggressiver waren bzw. Resistenzen entwickelt hatten. Man kann es sich so vorstellen: Die Krebszellen sitzen dir gegenüber im Schützengraben und du feuerst ohne Pause in ihre Richtung. Alles, was du hast. Und in dem Moment, wo du deine Munition verpulvert hast, steht die Tumorzelle aus dem Schützengraben auf und feuert einfach alles zurück. Nicht jeder Tumor ist so, aber Hirntumoren beispielsweise sind besonders aggressiv. Ich denke etwa an das Glioblastom, einen Hirntumor beim Erwachsenen.
★
Nur noch knapp 60 Prozent des wissenschaftlichen Personals haben hierzulande eine unbefristete Anstellung, 2005 waren es noch 74 Prozent. Der Nachwuchs arbeitet fast durchgehend mit befristeten Verträgen. Auch Madlener gehört dazu. Abgesehen von Professuren haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kaum langfristige Karriereperspektiven. Eine besondere Falle beinhaltet die sogenannte Kettenvertragsregelung: Weil nach zwei befristeten Perioden automatisch eine Festanstellung folgen müsste, werden die Mitarbeiter nicht mehr weiterbeschäftigt. „Manche gehen dann in die Privatwirtschaft und nehmen in Kauf, dass ihnen ihre Forschung vorgegeben wird. Dass man davor jahrelang mit Steuergeldern in diese Leute investiert hat, kommt dann der Allgemeinheit nicht mehr zugute“, sagt Madlener. Besonders betroffen sind Frauen. Und wer als Frau trotzdem in der Wissenschaft bleibt, tut das oft auf Kosten der eigenen Reproduktion. Die Fertilitätsrate bei Wissenschaftlerinnen in Österreich liegt bei 0,9 Kindern, zeigt eine rezente Studie des Instituts für Familienforschung an der Universität Wien.
★
Wie sieht ein Leben im Labor aus?
Madlener: Zeitmanagement ist alles. Sonst geht man unter. Man muss gut verschachtelt arbeiten können, wenn viel gleichzeitig zu tun ist. Natürlich bin ich während meiner Diplomarbeit und während der Dissertation oft am Wochenende oder in der Nacht im Labor gesessen, wenn wir auf dringende Ergebnisse gewartet haben oder ein Experiment eben sieben Tage durchgehend gelaufen ist. Man kann es ja nicht abschalten und den Krebszellen sagen, ich mach jetzt Feierabend.
Was treibt Sie gegen diesen hartnäckigen Gegner Krebs an?
Madlener: In der Krebsforschung muss man mit Frustration umgehen können. Man muss davon ausgehen, dass 90 Prozent der Tätigkeit von Misserfolg gekrönt sein werden. Mit zehn Prozent Erfolg muss ich meine Motivation aufrechterhalten. Umso größer ist das Erfolgserlebnis, wenn die aufgestellte Hypothese sich nach einiger Zeit belegen lässt. Unser Ziel ist es, den Krebs beherrschbar zu machen, hier setzt auch die Forschung derzeit an: Unter dem Stichwort Gentherapie wird versucht, zielgerecht die Onkogene anzugreifen und wieder in den Griff zu bekommen. Dann wächst im besten Fall der Tumor nicht mehr. Bei manchen Tumorarten gibt es dank jahrelanger intensiver Forschung bei rechtzeitiger Früherkennung bereits sehr gute Heilungschancen, das beste Beispiel ist hier wohl der Brustkrebs.
Spüren Sie in Ihrer Forschung den Druck, wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse zu liefern?
Madlener: Forschung, die der Industrie neue Perspektiven bietet, wird im Vergleich
zur klinischen und vor allem zur Grundlagenforschung besser gefördert, das stimmt. Ich versuche die Zweige zu verbinden. Über die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG und den österreichischen Wissenschaftsfonds FWF habe ich Geld für eine Kooperation mit der Technischen Universität Freiburg und der FH Vorarlberg bekommen. Ziel dieses internationalen Projektes ist es, einen Chip mit verschiedenen Markern zu versehen, um, wie schon erwähnt, schnell, einfach, kostengünstig und ohne Vorbehandlung der Probe eine rasche Diagnose bei kindlichen Tumorpatienten stellen zu können. Wenn dieses Projekt Erfolg hat, kann dieser Chip später als diagnostisches Tool in der Klinik angewandt werden.
Die eigentliche Währung im Forscherleben ist aber die Publikation, oder nicht?
Madlener: Die Publikation, ja, und da der sogenannte Impact-Faktor, der die Zitierungen misst. Wichtig sind auch die Gelder, die man akquiriert hat, die man also einbringen kann. Für Studenten geht es aber vorrangig um die Publikationen. Egal, wo man sich bewirbt, als Post-Doc oder in der Privatwirtschaft, überall wird der sogenannte „publication track“ als Leistungsnachweis gefordert. Da sollten auch bekanntere Journale dabei sein. Erst später kommen dann Parameter wie die Lehre dazu.
Eine berufliche Zukunft in der Wissenschaft ist trotz hervorragender Leistungen nicht garantiert. Der Österreichische Wissenschaftsrat hat schon 2013 festgehalten, dass es ein Gebot der Fairness sei, für den wissenschaftlichen Nachwuchs „rechtzeitig Klarheit über die möglichen Perspektiven und Chancen zu schaffen“. Geht das auf?
Madlener: Na ja. Schauen Sie sich nur die Gender-Frage an. Hier bei uns in der Kinderklinik stehen zwei Frauen als Vorstände an der Spitze. Das ist aber die Ausnahme. Wenn man sich umschaut, sind die meisten Klinik- und Gruppenleiter männlich.
Laut Statistik geht die Schere ungefähr mit 30 auseinander. Bis dahin halten sich bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern Männer und Frauen die Waage.
Madlener: Das ist das Alter, in dem die Frauen entweder aus der Forschung aussteigen oder Kinder bekommen. In der Forschung musst du immer dabei sein, pausieren geht nicht. Ich schaue fast täglich in das PubMed-System, eine Art Google, das weltweit Beiträge zu medizinischen Forschungsgebieten listet. In meinem Bereich der kindlichen Hirntumoren kommen da jede Woche meist mehr als zehn neue Beiträge hinzu. Nach zwei Jahren ist die Welt in deinem Bereich auf den Kopf gestellt. Ich kenne kaum jemanden aus dem Forschungsbereich, der mit Kind geblieben ist. Als Mütter sind die Kolleginnen allesamt ausgestiegen.
Zum Thema Krebs hat jeder was zu erzählen. Über die Forschung wissen die wenigsten Bescheid. Wie erklären Sie anderen, was Sie machen?
Madlener: Ich sage immer: Ich bin eine Laborratte. Da hat jeder sofort das Bild eines Labors mit weißem Mantel vor Augen, irgendwo im Kabäuschen, im Keller. Wir arbeiten tatsächlich in fensterlosen Räumen. Das wird hier am AKH aber mit Lichttagen kompensiert.