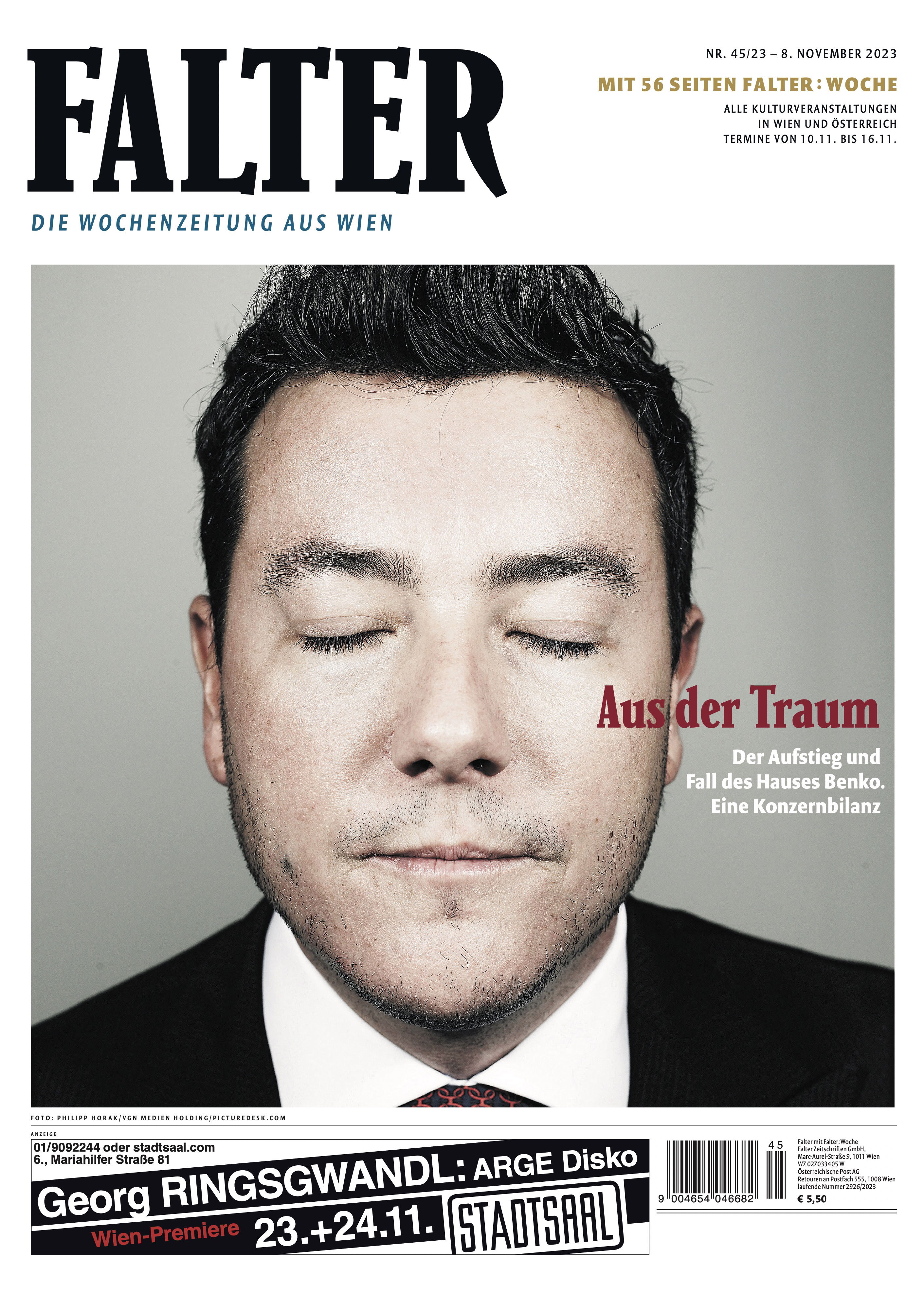
Vom Dromedar zum Kamel
Sieglide Rosenberger in FALTER 45/2023 vom 08.11.2023 (S. 23)
Angefeuert von Diskursimporten aus den USA haben viele Menschen auch hier das Gefühl, dass die Positionierung zu zentralen Problemen sozial gespalten, ja weltanschaulich polarisiert sei. Das Buch "Triggerpunkte" von Steffen Mau u.a. stellt das Masternarrativ der polarisierten Gesellschaft infrage. Konzeptionell clustern die Autoren besonders akute Konfliktfelder in vier Ungleichheitsarenen: sozio-ökonomisches Oben-Unten, territoriales Innen-Außen, identitätspolitisches Wir-Sie und umweltpolitisches Heute-Morgen. Die Längsschnittdiagnose kommt über diese Differenzierungen zum Resümee, dass die Entwicklung von integrierten einhöckrigen Dromedar-Gesellschaften (normalverteilte Meinungen in der Mitte) in gespaltene zweihöckrige Kamelgesellschaften (Lager) für Deutschland nicht zutreffe, zumindest nicht so uneingeschränkt wie Wahrnehmung und wissenschaftliche Debatten es suggerieren würden. Vielmehr gäbe es stabile Meinungen auf die Frage "Wem steht was zu?". Und, besonders wichtig, die unterschiedlichen Meinungen werden noch lose, situativ geäußert, sind also noch nicht in politischen Organisationen verfestigt.
In der Identifizierung von Triggerpunkten liegt die Stärke des Buches. Als solche gelten Ereignisse, bei denen gesellschaftlicher Konsens in Dissens umschlägt. Um diese Dynamiken zu erkennen, gibt das Buch ein nützliches analytisches Instrumentarium an die Hand. Die empirische Diagnose vermag angesichts der aktuellen Konflikte und Kriege etwas zu beruhigen. Auch in Österreich.
Gleichzeitig lässt das Buch erahnen, dass der Übergang vom Dromedar zum Kamel im Gange ist: Denn die am rechten Rand verorteten Parteien mit ihren lautstarken Meinungen zu Kriegen, zu Klimawandel, Gendern, Corona-Maßnahmen etc. rücken zunehmend in die Mitte vor. Diese Parteien verbinden Schwarz-Weiß-Meinungen, verknüpfen Freund-Feind-Positionen und geben einem polarisierten Grundkonsens eine mächtige politische Organisationsform.



