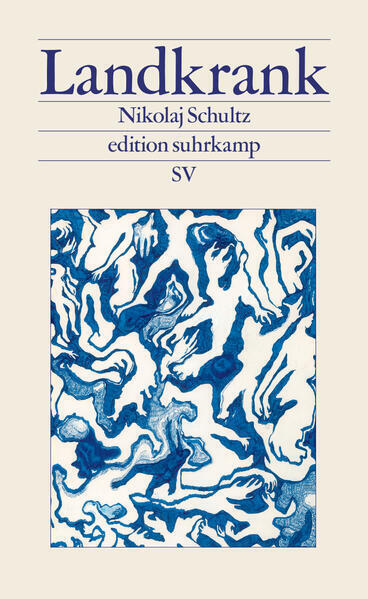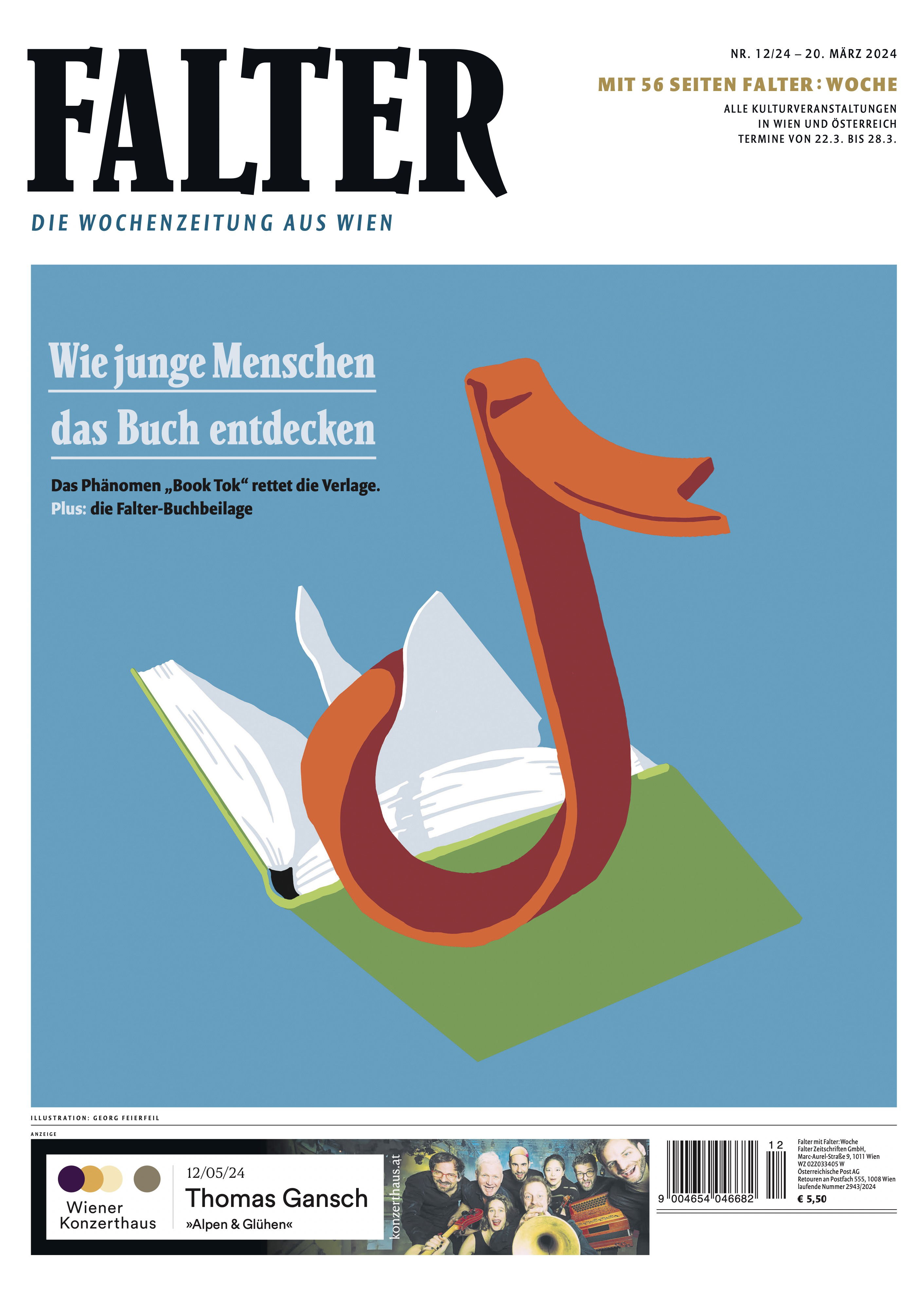
„Es schläft sich nicht gut im Anthropozän“
Gerlinde Pölsler in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 30)
Er gilt als große Hoffnung der Soziologie, und über sein Erstlingswerk sagte der Philosoph Slavoj Žižek: „Wenn uns ein Buch zum dringend notwendigen ökologischen Engagement mobilisieren kann, dann dieses.“ Nikolaj Schultz, 34, gebürtiger Däne, stürmte nach Paris, nachdem er die Werke des Soziologen und Philosophen Bruno Latour gelesen hatte, der sich schon lange mit dem Klimawandel befasste: Sie hatten ihn elektrisiert. Die beiden freundeten sich an, Latour schrieb sogar sein letztes Buch kurz vor seinem Tod im Herbst 2022 zusammen mit seinem jungen Compagnon: „Zur Entstehung einer ökologischen Klasse. Ein Memorandum.“ Die Frankfurter Rundschau nannte es „Ein Manifest für die ,Letzte Generation‘“. Die These: So wie einst die Arbeiterklasse sozialen Fortschritt erkämpfte, so müsse nun eine ökologische Klasse die Führung übernehmen.
In Schultz’ Solo-Werk „Landkrank“ beschreibt der Autor mit den strubbeligen Haaren das Lebensgefühl jener Menschen, denen bewusst ist, dass wir mit der Klimakrise gerade in eine neue Epoche eintreten und dass zumindest jeder im Wohlstand lebende Mensch sie befeuert, ob er will oder nicht. Bewusst liefert Schultz in seinem literarischen Essay keine Klimadaten, solche füllen seiner Meinung nach schon genug Papier. Er setzt konsequent auf das Ich.
Zu Beginn wälzt Schultz’ Alter Ego sich schlaflos in seiner Pariser Wohnung: Eine Hitzewelle drückt auf die Stadt. Doch womit er sich auch helfen will, überall flüstert ihm entgegen: Du selbst bist das Problem. „Der Ventilator, ohne den ich nicht schlafen kann, treibt meinen Energieverbrauch massiv in die Höhe und sorgt für noch mehr CO2 in der Atmosphäre [...] Die Abkühlung meines Körpers hat ihren Preis – den wahrscheinlich zuerst und am heftigsten jemand anderes zahlen wird, am ehesten irgendwo im globalen Süden.“ Auch als er seinen Koffer packt, um der Einladung eines Freundes auf die Insel Porquerolles zu folgen und für kurze Zeit allem zu entfliehen, blicken ihm nur Vorwürfe entgegen. Für jedes T-Shirt seien 2700 Liter Wasser draufgegangen, für die Jeans noch mehr. Es komme ihm vor, als „existierte ich von anderen und ernährte mich wie eine Spinne im Netz, indem ich die anderen finge und fräße“.
Nun segelt er also übers Meer, Wasser, so weit er schaut. Die inneren Stimmen geben aber weiter keine Ruhe. Ein halbes Jahrhundert kreuzt das Boot der Familie schon über den Ozean, erzählt der Freund, und schon rattert es in Schultzens Kopf: In dieser Zeit verlor das Mittelmeer die Hälfte seiner Säugetierpopulation und ein Drittel seiner Fischarten. Die Bootsfahrten gaben auch den Anstoß zum Buchtitel: „Landkrank“ nennt man den Zustand, wenn jemand nach einiger Zeit auf dem Wasser wieder festen Boden unter den Füßen hat, doch dieser zu schwanken scheint. Am Sandstrand, denkt der Autor, makellos und weit weg von allem, wird er sich endlich entspannen.
Doch auch daraus wird nichts. Gleich fragt ihn eine alte Frau, ob er bitte weggehen könne. Sie wohne schon ihr ganzes Leben auf der Insel, doch finde sie wegen der vielen Touristen keinen Platz mehr.
Es gibt also keinen Fluchtpunkt mehr auf dieser Erde, wohin man auch rennt, die Umweltkrise ist schon da. Im Gegenteil: Die Reise verschärft die Schuldgefühle des Autors. Tankschiffe bringen Trinkwasser auf die Insel, weil das immer wieder knapp wird. Ein Insulaner, den Schultz kennenlernt – Laurent –, zeigt ihm den meistbesuchten Strand: Plage d’argent, Silberstrand, den die Einheimischen allerdings nur noch „Staphylokokkenstrand“ nennen, wegen der zur Hochsaison gefährlich hohen Bakterienkonzentration. Schultz kommt an einer Schlange von Touristen vorbei, die auf die Fähre warten. „Wie ich sind sie für einen Augenblick geflohen, und nun müssen sie heimkehren, doch ihre Fußabdrücke werden von Dauer sein. […] Selbst nach ihrer Abfahrt hat die Insel ihr Gewicht zu tragen.“
Und was jetzt, Herr Schultz?
Auch in diesem Essay greift der Autor Ideen aus dem Buch über die ökologische Klasse auf: etwa, dass das Bild vom autonomen Individuum in Scherben liegt. Auch sieht er in den Inselbewohnern eine mögliche neue („geosoziale“) Klasse. Deren Basis liege „nicht in ihrer ökonomischen, sondern ihrer territorialen Stellung. Das führt zu ungewöhnlichen Allianzen.“ Laurent und die alte Frau „mögen jeweils einen ganz unterschiedlichen ökonomischen Status haben, […] doch hinsichtlich der territorialen Zugehörigkeit sind sie Verbündete.“
Manches bleibt vage: Wie hängen geosoziale und ökologische Klasse zusammen? Wer gehört wozu? Die alte Insulanerin zählt Schultz zur neuen geosozialen Klasse, zur eigenen Großmutter heißt es dagegen: „Individuell ist auch sie Opfer einer planetarischen Metastase. Kollektiv gebe ich ihr und ihrer Generation die Schuld daran.“ Aber ist es so einfach? Viele aus der Nachkriegsgeneration verursach(t)en dank bescheidenem Lebensstil wohl viel weniger Emissionen, als manche von Schultz’ Altersgenossen dies heute tun. Und was ist mit der Elterngeneration? Auch was die neuen Klassen nun tun sollen, bleibt offen.
Dennoch ist „Landkrank“ anregender Lesestoff: Beschreibt es doch ein Lebensgefühl, das immer mehr Menschen spüren und das wohl noch vor zehn Jahren kaum existierte. Und dies in einer poetischen Sprache, die die schwere Kost (v)erträglich macht.
Vielleicht braucht es auch einfach einmal das Innehalten, die Trauer über das Verschwundene und Verschwindende. Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die das Vorwort beisteuert, schreibt: „Man kann ,Landkrank‘ als ein trauriges Buch lesen, aber ich finde es radikal hoffnungsvoll. Dort, in der Dunkelheit, [...], dort werden wir ehrlich. […] Und von dort aus, von der echten Dunkelheit aus, kann es nur heller werden. Was für ein Versprechen.“