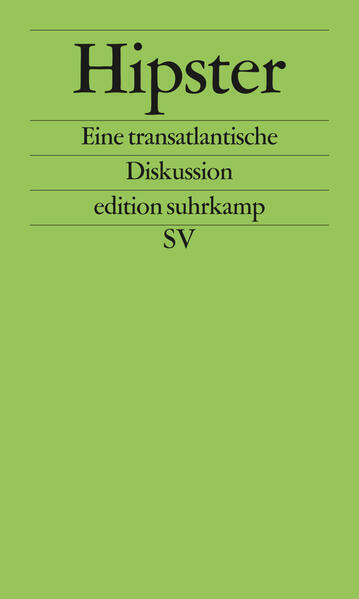Truckerkappe, Feinrippunterhemd und Skinny Jeans
Nikolaus Stenitzer in FALTER 11/2012 vom 14.03.2012 (S. 35)
Lifestyle: Ein Essayband versucht Zeitgenossen von diesseits und jenseits des Atlantik festzumachen: die Hipster
Hipster. Eine transatlantische Diskussion": Der Titel ist gut gewählt. Am Ende ist es tatsächlich die "transatlantische Diskussion", um die der Suhrkamp Verlag seine Übersetzung des 2010 in New York erschienenen Bandes erweitert hat, die für Originalität sorgt. Um den ursprünglichen Titel "What Was the Hipster?" ist es trotzdem schade.
Denn mit diesem war es gelungen, die beiden wichtigsten Bestandteile der Beiträge in einem Satz zusammenzufassen. Nämlich den grimmigen Wunsch, das untersuchte Phänomen möge bereits vom Erdboden verschwunden sein, und die drängende Frage: Worüber reden wir hier eigentlich? Das New Yorker Magazin n+1 machte diese Frage 2009 zum Thema einer Tagung. Das Buch gibt die Ergebnisse, erweitert durch ergänzende Essays, wieder.
Die äußeren Merkmale dessen, was "Hipster" heißt, zählen dabei nicht zu den Ergebnissen, sondern sind der Ausgangspunkt. Ausführlich wird beschrieben und besprochen, woran man den Hipster erkennt: Er ist jung, weiß, männlich und dünn; er trägt die Insignien der amerikanischen Provinz an sich, Truckerkappe und Feinrippunterhemd, außerdem gerne einen Bart, hautenge (skinny) Jeans und umgibt sich überhaupt mit einer gewissen "Softporno-Ästhetik" (Mark Greif).
Seine kulturellen Vorlieben sind wenig aufregend – als mögliche Beispiele einer Hipsterkultur werden das Frühwerk von Dave Eggers und Filme von Wes Anderson genannt. In einigen Beiträgen wird außerdem die Unproduktivität der Gattung moniert: Hipster bringen nichts hervor, sondern konsumieren nur; sie sind "quasi per definitionem keine Künstler" (Dayna Tortorici).
Die Frage ist nun: Warum sich mit einem so hinfälligen Phänomen auseinandersetzen? Wenn Hipster Leute sind, die sich gerne mit Mode beschäftigen, hauptsächlich konsumieren und sich sonst nicht um viel kümmern und also so ähnlich funktionieren wie die meisten anderen Menschen auch – warum sollte man ihnen Konferenzen und Bücher widmen?
Mit dieser Frage und mit dem erstaunlich verbreiteten Hass auf den Hipster im Allgemeinen befasst sich der interessanteste Beitrag des Bandes, geschrieben von Jens-Christian Rabe. Rabes Text hat den Vorteil der Distanz, der es möglich macht, das grassierende Anti-Hipster-Gegeifere – sinngemäß – als Abwehr des Ähnlichen zu beschreiben.
Diese Distanz fehlt leider vielen der anderen Texte, und so pendeln die Beiträge oft zwischen Tirade und Anekdote. Gute Gedanken finden sich dabei auch: Jennifer Baumgardner schlägt etwa vor, den Hipster-Hass als homophobes Ressentiment gegenüber Männern zu deuten, die sich gerne um ihr Äußeres kümmern, während Patrice Evans empfiehlt, sich lieber gleich mit Hip-Hop statt mit Hipsters zu befassen, weil das interessanter sei.
Mit mehr Ernst geht n+1-Mitherausgeber Mark Greif vor: Seiner Ansicht nach beziehen sich Auftreten und Interessen des Hipster der Jahre nach 1999 auf eine "suburbane Form der Weißheit", die entsprechend leicht in eine reaktionäre Tendenz kippen könne – oder diese ohnehin schon enthalte.
Dazu passt die Beobachtung, dass sich in Metropolen regelmäßig klein- und vorstädtische Strukturen bilden, die ihre Bewohner an ihre Kindheit (oder die ihrer Eltern) erinnern und so Geborgenheit vermitteln. Leider geht Greif dem Gedanken nicht weiter nach, sondern ergibt sich seiner eigenen Sentimentalität und geißelt die Hipster-Gentrifizierung, die die Lower East Side seiner Kindheit zerstört hat, als die schlechtere Art der Stadtteilkolonisierung (gegenüber jener durch Künstler).
Betroffenheit war noch nie eine gute Grundlage für Kritik. Wenn sich keine andere findet, dann lohnt meistens der Gegenstand die Aufregung nicht. Zum Glück wissen das auch einige der Autorinnen und Autoren des Bandes, was die Lektüre stellenweise durchaus vergnüglich macht. Thomas Meinecke und Eckhard Schumacher etwa geben sich in ihrem Dialog über Pop, Sexualität und Stilbewusstsein eher erlebnis- denn erkenntnisorientiert und sind dabei ausgesprochen unterhaltsam.