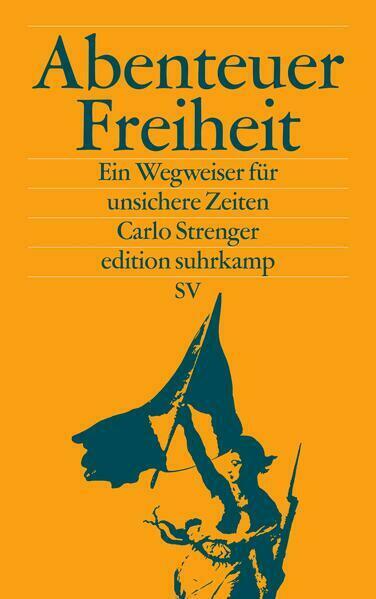Freiheit ist keine Wohlfühlzone
Kirstin Breitenfellner in FALTER 8/2017 vom 22.02.2017 (S. 18)
Demokratie gibt es nicht ohne Disziplin. Carlo Strenger schreibt ein flammendes Plädoyer für eine Kulturleistung
Vor knapp zwei Jahren erschien Carlo Strengers Buch „Zivilisierte Verachtung“ mit dem Untertitel „Eine Anleitung zur Verteidigung der Freiheit“. Es nahm jene bedingungslose Toleranz aufs Korn, die sich der Intoleranz der anderen ausliefert. Als Therapie für diese Schwäche schlug er das titelgebende Konzept der zivilisierten Verachtung vor.
Das neue Buch des Professors für Psychologie und Philosophie an der Universität von Tel Aviv und Mitglieds einer internationalen Studiengruppe zur Erforschung der Motivation fundamentalistischer Terroristen hebt den Begriff der Freiheit gleich in den Titel. Es heißt „Abenteuer Freiheit. Ein Wegweiser für unsichere Zeiten“.
Zentrales Thema ist auch dieses Mal nicht die Bedrohung des westlichen Konzepts der Freiheit von außen, sondern von innen. Von Michel Houellebecq über David Foster Wallace bis zu Thilo Sarrazin mehren sich kritische Stimmen, die nicht nur unsere Freiheit, sondern unsere ganze Lebensweise als dem Untergang geweiht ansehen, sei es durch eine ökologische Katastrophe oder durch einen Sieg des Terrors. Strenger fragt, ob das überhaupt stimmt, und wenn ja, was man dagegen tun kann.
Dass die Freiheit verstärkt aus dem Inneren unserer Gesellschaft bedroht ist, lässt sich für Carlo Strenger nicht von der Hand weisen. Als Ursache dafür macht er eine zunehmende Verwöhn- und Konsummentalität aus. Diese setze Freiheit als gegeben voraus und definiere Wohlstand als etwas, worauf jeder ein Geburtsrecht besitze.
Erlösungsfantasien als Ausweg
Für Strenger ein gefährlicher Denkfehler, dessen Wurzeln er bei Jean-Jacques Rousseau ortet, nach dem der Mensch mit einem guten, harmonischen und wahren Selbst auf die Welt kommt, das erst von Elternhaus und Gesellschaft verdorben werde. Dieses Freiheitskonzept hat zur Folge, dass der Einzelne sich immer öfter als Opfer sieht.
Ein großer Teil der Bürger der freien Welt, konstatiert Strenger, nimmt seine Freiheit nicht mehr ernst und ist nicht bereit, für sie zu kämpfen. Stattdessen flüchtet er sich in Trost- und Erlösungsfantasien, die Passivität und Anspruchsdenken fördern: etwa die von Strenger „psychologische Heilslehren“ genannten Methoden von Donald Winnicott, Heinz Kohut oder Alice Miller, die versprechen, das Selbst zu befreien und damit alle Probleme zu lösen. Dagegen führt Strenger Sigmund Freuds Diktum ins Feld, eine Therapie sei dann gelungen, wenn sie hysterisches Leid in alltägliches Unglücklichsein umgewandelt habe.
Auch die großen Religionen haben den Menschen immer schon als fehlerhaftes, unvollkommenes Wesen angesehen. Leider bieten sie zuallermeist Lösungen an, die nicht auf dieses Leben zielen. Strengers Ansatz hingegen kommt ganz ohne Jenseits aus. Er betrachtet den Menschen als das „unmögliche Tier“ mit einem Körper, der altert und stirbt, und einem Geist, der dazu verdammt ist, in diesem Bewusstsein zu leben, kurz: eine tragische Gestalt, die sich nicht eingestehen will, dass ihr Dasein wesentlich von unlösbaren Konflikten und Spannungen geprägt ist.
Illusion der Unsterblichkeit
„Meine Grundthese lautet, dass die Berechtigungsmentalität, die sich im Westen breitgemacht hat, die Einsicht verhindert, dass es ein schwerwiegender, fast metaphysischer Fehler ist, zu glauben, es gebe für alle Probleme eine technische Lösung und alle Schwierigkeiten könnten letztlich von irgendeiner Instanz beseitigt werden.“
Brauchbarere, weil weltliche Menschenbilder findet Strenger bei Künstlern der Moderne wie Charles Baudelaire, Gustav Klimt und Egon Schiele, aber auch bei Filmregisseuren wie Martin Scorsese und Paul Thomas Anderson und bei Denkern wie Isaiah Berlin, Martin Heidegger oder Jean-Paul Sartre. Sie alle hätten sich von der Möglichkeit faszinieren lassen, sich einem Leben ohne jede Illusion der Unsterblichkeit hinzugeben.
Freiheit versteht Strenger nicht als ein Recht, sondern als eine Kulturleistung, die auch dem Westen nicht in den Schoß gefallen sei und für deren Erhalt man kämpfen müsse. Da man ein gutes Leben aber nicht ohne Ausdauer und Anstrengungen erreichen könne, flüchteten viele in eine „mit fanatischer Ideologie verbrämte Destruktivität“. Damit meint Strenger nicht nur religiöse Fanatismen, sondern auch politische Religionen wie Nationalsozialismus und Kommunismus. Der Aufstieg der radikalen Rechten in Europa und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten bewiesen, dass auch liberale Demokratien gegen die bewusste Verzerrung der Realität nicht gefeit seien.
Gegen diese Bedrohungen helfe nur eine Bildung, die junge Menschen nicht nur auf die Karriere vorbereite, sondern auch ihre staatsbürgerliche Erziehung übernehme. Nur so könne unsere Lebensweise die „Stresstests“ unserer Gegenwart bestehen.
Mit seinem nur gut 100 Seiten langen Text, den man getrost schon jetzt unter die Bücher des Jahres reihen darf, beweist Strenger erneut, dass man große Themen auch essayistisch anpacken kann.
Seine Botschaft ist auch dieses Mal nicht einfach: Freiheit ist keine Wohlfühlzone, sondern eine Disziplin. Für diese braucht es außer Ausdauer und Mut zum Risiko die Fähigkeit, den Schmerz der Freiheit auszuhalten, sowie die Einsicht, dass die menschliche Psyche nicht für dauerhaftes Glück geschaffen ist. Der Einzelne muss sich damit abfinden, nicht alles zu erreichen, was er sich wünscht, ja genau genommen relativ machtlos zu sein.
„Die Entwicklung der freiheitlichen Ordnung darf also keinesfalls im Stil einer Hagiografie verkündet werden; stattdessen muss sie als das Abenteuer des fortwährenden Versuchs erzählt werden, mit der komplexen menschlichen Existenz sinnvoll, gerecht und rational umzugehen.“