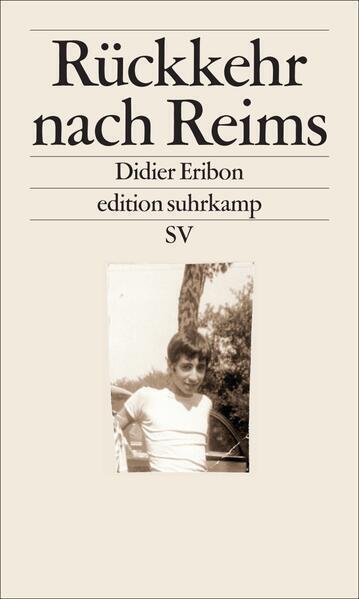Ein wichtiger Beitrag zur Deutung des Rechtsrucks
Emmerich Tálos in FALTER 40/2017 vom 04.10.2017 (S. 60)
Mit dem autobiografischen Rückblick auf seine Kindheit erweckte der Soziologe Didier Eribon Interesse in ganz Europa
Der autobiografische Rückblick des Autors auf seine eigene soziale, politische und intellektuelle Entwicklung fokussiert zum einen auf seine Flucht aus dem Herkunftsmilieu, dem Arbeitermilieu, zum anderen auf die Brüche mit linken politischen Traditionen in diesem Milieu.
Eribon stammt aus einer armen Arbeiterfamilie in Reims. Die Geschichte seiner Großeltern und Eltern ließe sich mit „wenig Bildung, sehr viel harte Arbeit“ umschreiben. Im Unterschied zu seinen Geschwistern besuchte er Gymnasium und Universität. Zwischen seiner intellektuellen, glorifizierenden Sicht der Arbeiterklasse und den realen Erfahrungen seiner Eltern bestand eine deutliche Diskrepanz. Er floh von der Familie mit ihren permanenten Streitigkeiten und aus diesem Milieu in die Großstadt Paris, um allein und selbstbestimmt (als Homosexueller) zu leben. Ungeachtet seiner Bildungskarriere prägte das Herkunftsmilieu seinen weiteren sozialen Aufstieg und die sozialen Beziehungen. Sein Lebensweg war damit durch die Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen Welten gekennzeichnet. Er empfand soziale „Herkunftsscham“, wenn er Menschen aus einem ganz anderen sozialen Milieu kennenlernte. Seinen Vater, der für ihn all das verkörperte, womit Eribon brechen wollte, mochte er nicht, mit ihm verband ihn nichts. Die eingefleischte Homophobie seines Vaters und des familiären Umfeldes hatte Eribon als Homosexuellen schwer getroffen und bildete einen Grund für seine Flucht und Distanz zum Herkunftsmilieu. Erst nach dem Tod seines Vaters kehrte er zurück, indem er wieder Kontakt zu seiner Mutter aufnahm. Die Aussöhnung mit ihr bildete die Ausgangsbasis für seine autobiografische Rückbesinnung.
Eribons Werk erweckt vor allem aufgrund einschneidender Änderungen traditioneller politischer Einstellungen bei Teilen der französischen Arbeiterschaft großes Interesse. Der feststellbare Rechtsruck ist kein ausschließlich französisches Phänomen. Allerdings zeichnet sich hier der Wechsel von linken Parteien zu einer rechtsextremen Partei, dem Front national, in besonders drastischer Weise ab.
War in seiner Kindheit noch die ganze Familie kommunistisch orientiert, so fand der politische Wandel auch dort Eingang: Seine beiden jüngeren Brüder wählen rechts und werden Anhänger des Front national. Vor diesem Hintergrund stellt sich der Autor die Frage, wie es dazu kommen konnte und welchen Anteil an dieser Entwicklung die offizielle Linke hatte. Nach Eribon wurde dem rechten Denken mit dem Versuch Vorschub geleistet, das Wesens- und Gründungsmerkmal der Linken vergessen zu machen, das seit dem 19. Jahrhundert darin bestehe, soziale Antagonismen und Unterdrückungsmechanismen zu thematisieren und den Beherrschten eine Stimme zu geben. Nach dem Sieg der Linken und angesichts der Regierungsbeteiligung der Kommunisten fühlten sich Arbeiter von den Gewählten vernachlässigt, nicht länger repräsentiert oder sogar verraten. Die sozialistische Linke habe sich einem radikalen Wandel unterzogen und sich auf neokonservative Intellektuelle eingelassen. Die Idee der Unterdrückung der Beherrschten sei aus dem Diskurs der offiziellen Linken verschwunden, die Grenze zwischen rechts und links für aufgehoben erklärt und der Rückbau des Wohlfahrtsstaates legitimiert worden. Die linken Parteien hätten nicht mehr die Sprache der Regierten, sondern jene der Regierenden gesprochen.
Große Teile der Unterprivilegierten hätten sich daher jener Partei zugewandt, die einen Diskurs anbot, der ihrer Lebensrealität wieder einen Sinn zu verleihen schien, und die sich nunmehr als Einzige um sie zu kümmern schien.
Was heißt das für die Linke? Wenn sie ihren eigenen Niedergang verstehen und aufhalten will, muss sie sich nach Eribon nicht nur von ihren neoliberalen Auswüchsen lösen. Es bedarf vermittelnder Theorien, mit denen Parteien und soziale Bewegungen eine bestimmte Sichtweise auf die Welt anbieten. „Jene, die keine Stimme haben, können nur sprechen, wenn sie von jemandem vertreten werden, wenn jemand für sie, in ihrem Namen und in ihrem Interesse spricht“ (S. 145).
Auch wenn die Länge vieler Sätze den Nachvollzug der Argumentation nicht erleichtert und eher nur angedeutet wird, inwiefern es dem Front national besser gelingt, der Lebensrealität von Arbeitern Sinn zu verleihen: Mit der Reflexion seiner persönlichen Erfahrungen leistet der Autor einen wichtigen Beitrag zur Deutung des Rechtsrucks bei Teilen der Arbeiterschaft. Sein Buch ist daher auch für Entwicklungen in anderen Ländern von Interesse.
Zurück zum Proletariat von Reims
Norbert Mappes-Niediek in FALTER 18/2017 vom 03.05.2017 (S. 20)
Nach dem Tod seines Vaters, eines „dummen und gewalttätigen Mannes“, kehrt Didier Eribon nach langen Jahren zum ersten Mal zurück nach Reims, in die Stadt, in der er aufgewachsen ist. In den 1970er-Jahren, als der junge Arbeitersohn als Student nach Paris ging, hat er eine kommunistische Familie hinter sich gelassen. Jetzt wird hier rechts gewählt. Eribon, der in Frankreich als Denker der Schwulenbewegung bekannt wurde, nutzt seine persönliche Lebensgeschichte und sein Instrumentarium als Soziologe, um die Wandlung seines Herkunftsmilieus zu erklären. Um aus einem linken Milieu ein rechtes zu machen, findet er, musste nichts Neues hinzukommen. Antiintellektualismus, Frauenfeindlichkeit, rassistische Hetze, Forderungen nach Todesstrafe, nach Vorrang für Franzosen bei Sozialleistungen: das gab es alles schon, als hier alle noch die KP wählten. Im Unterschied zu damals fehlt jetzt aber etwas: die Solidarität, die sozialen Kämpfe, die verbindende Praxis.
Die linken Parteien können die verlorenen Anhänger aber zurückholen. „Zumindest teilweise“ sei die Zustimmung zum Front national „eine Art politische Notwehr der unteren Schichten. Sie verteidigten eine Würde, die seit jeher mit Füßen getreten worden ist und nun sogar von jenen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt hatten.“ Ob sie außer ihrer Würde nicht auch handfeste Interessen verteidigen, fragt sich Eribon nicht. Das wäre Ökonomie, nicht mehr Soziologie.
Lesen Sie das, Herr Bundeskanzler!
Norbert Mappes-Niediek in FALTER 40/2016 vom 05.10.2016 (S. 19)
Didier Eribon weiß, wie aus den französischen Arbeitern frustrierte Rechtswähler wurden – und wie man sie zurückgewinnen kann
Nach dem Tod seines Vaters, eines „dummen und gewalttätigen Mannes“, kehrt Didier Eribon nach langen Jahren zum ersten Mal zurück nach Reims, in die Stadt, in der er aufgewachsen ist. In den 1970er-Jahren, als der junge Arbeitersohn als Student nach Paris ging, hat er eine kommunistische Familie hinter sich gelassen. Jetzt wird hier rechts gewählt. Mindestens einmal hat sie dem Front National ihre Stimme gegeben, gibt die Mutter verschämt zu, und seine beiden jüngeren Brüder sind rechte Stammwähler. Früher, erinnert sich Eribon, haben Vater und Mutter stets böse Verwünschungen ausgestoßen, wenn sich eine Figur der Rechten auf der Mattscheibe zeigte. Was ist da geschehen?
Jetzt, da auch Deutschland seine Rechtspartei hat und ihr Pendant in Österreich auf dem Sprung an die Macht ist, kommt die deutsche Übersetzung des Buches gerade zur rechten Zeit. In Frankreich – wie in Österreich – bekommen die Rechten in den Arbeiterbezirken die meisten Stimmen. Was hat die Linke falsch gemacht? Was kann sie noch richtig machen? Didier Eribon, der in Frankreich als Denker der Schwulenbewegung bekannt wurde und der Michel Foucault und Pierre Bourdieu zu seinen Freunden zählte, nutzt seine persönliche Lebensgeschichte und sein Instrumentarium als Soziologe, um die Wandlung seines Herkunftsmilieus zu erklären.
Die frühe und gründliche Scheidung von der Familie erscheint spontan plausibel: Er, der Sohn, war schwul und der kommunistische Vater war – wie auch das ganze Umfeld – manifest homophob. Aber dass es die sexuelle Orientierung war, die ihn aus dem Elternhaus trieb, hält Eribon im Rückblick nur noch für die halbe Wahrheit. Der Bruch ging vielmehr einher mit einem „existenziellen Verrat“ an seiner Herkunft.
Mythos Arbeiterklasse
In Paris vermied es der Student, seinen linken Freunden zu offenbaren, woher er kam. Die Arbeiterklasse war für die Szene in den Zeiten marxistischer Hegemonie – Eribon ist Jahrgang 1953 – eine „mythische Entität“, deren reale Vertreter man nicht kennenlernen wollte. Es sei ihm leichter gefallen, „über sexuelle Scham zu schreiben als über soziale“, befindet der Autor nach der Rückkehr nach Reims über seine frühen Texte.
Statt sich nun wegen seines Verrats zu schämen, macht Eribon seine Erfahrung analytisch fruchtbar. Um aus einem linken Milieu ein rechtes zu machen, findet er, musste nichts Neues hinzukommen. Antiintellektualismus, Frauenfeindlichkeit, rassistische Hetze gegen die „crouilles“ und die „bougnoules“, Forderungen nach Todesstrafe, nach Vorrang für Franzosen bei Sozialleistungen: Das gab es alles schon, als hier alle noch die KP wählten. „Hätte man aus dem, was tagtäglich in meiner Familie gesprochen wurde, ein politisches Programm stricken wollen, es wäre dem der Rechtsextremen wohl ziemlich nahegekommen.“
Damit die Linken rechts wurden, kam nichts neu hinzu. Es fiel aber etwas weg, so Eribon: die Solidarität, die sozialen Kämpfe, die verbindende Praxis. Die KP mochte sich in früheren Zeiten den rechten Stimmungen in der Wählerschaft opportunistisch angepasst haben. Aber ihr eigentliches Thema war das alles nicht. Für sie stand die soziale Frage im Vordergrund. Bei einem Streik etwa spielte das Ressentiment gegen die Algerier einfach keine Rolle.
Der Niedergang der sozialen Frage
Mit der Präsidentschaft François Mitterrands 1981, so Eribon, beginnen Begriffe wie Klasse oder Unterdrückung aus dem politischen Diskurs der Linken zu verschwinden. Statt von Ausbeutung und Widerstand sei von „Zusammenleben“ und „Eigenverantwortung“ die Rede gewesen. In den Ohren der Arbeiter von Reims muss das zynisch geklungen haben. An seiner Familie und auch an seiner eigenen Biografie zeigt der Autor anschaulich auf, wie gering die Spielräume jemandes aus seinem Milieu in Wirklichkeit waren.
Das Argument hebt die Erfahrung auf die politische Ebene: Die linken Parteien können die verlorenen Anhänger zurückholen. Eribon glaubt nicht, dass die Arbeiterklasse heute so fest zur Rechten hält wie sie früher zur KP von Georges Marchais hielt. „Zumindest teilweise“ sei die Zustimmung zum Front National „eine Art politischer Notwehr der unteren Schichten“. Man erhofft sich mit der Stimme für Marine Le Pen keine Besserung, macht sich aber immerhin bemerkbar. „Sie verteidigten eine Würde, die seit je mit Füßen getreten worden ist und nun sogar von denen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt hatten.“ Ob sie außer ihrer Würde nicht auch handfeste Interessen verteidigen, fragt sich Eribon nicht. Das wäre Ökonomie, nicht mehr Soziologie.
Eribon sucht die „Aussöhnung mit mir selbst“ oder, genauer, mit dessen proletarischem Teil, „den ich verweigert, verworfen, verneint hatte“. Er hat nicht vor, nun künftig den anderen Teil seines Selbst zu verneinen. Eine Rückkehr zu den Zeiten der KP, als der Kampf der Arbeiterklasse allem voranging und alles andere bloß „Nebenwiderspruch“ war, schwebt dem bekennenden Linken und bekennenden Schwulen erklärtermaßen nicht vor. „Warum sollten wir zwischen verschiedenen Kämpfen gegen verschiedene Formen der Unterdrückung wählen müssen?“, fragt er.
Eine gute Frage. Seit 2009, als das Buch in Frankreich erschienen ist, hat sich eine neomarxistische Szene herausgebildet, die genau das tut: sich wieder auf die Klassenkämpfe stürzen und die „sexuellen, rassischen und anderen Formen der Unterwerfung“, die Eribon nicht minder umtreiben, fröhlich missachten. In Österreich könnte so aus der Rückkehr der sozialen Frage eine Basis für eine rot-blaue Koalition werden. Eribons Buch ist auch eine Mahnung, dem neuen Bundeskanzler in Österreich sehr genau zuzuhören.