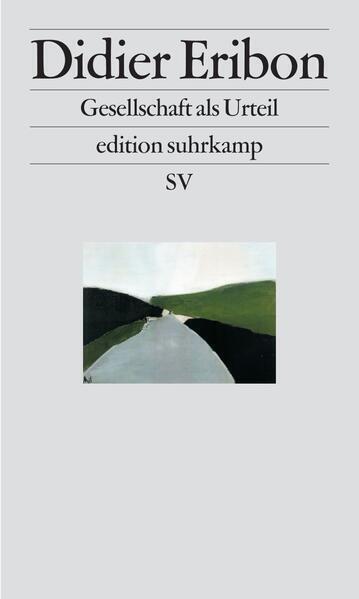"Ich glaube an den Klassenkampf"
Matthias Dusini in FALTER 40/2017 vom 04.10.2017 (S. 26)
Der französische Autor Didier Eribon über seinen Bestseller "Rückkehr nach Reims", den Rechtsruck des Proletariats und seine Liebe zum Klassenfeind
Es tue ihm wirklich leid, dass für das Interview eine so weite Anreise nötig war. Didier Eribon, 64, begrüßt den Wiener Gast Mitte September in Bologna, wo der französische Autor den September verbrachte. Eribon entspricht nicht dem Klischee des eitlen Pariser Intellektuellen. Schüchtern lächelnd und in sich gekehrt, spricht er über den Erfolg seines Buches "Rückkehr nach Reims", das 2016 in einer Nebenreihe des Suhrkamp Verlags erschien und sich bisher über 100.000 Mal verkaufte. Ende September feierte eine Bühnenfassung mit Nina Hoss in der Hauptrolle in Berlin Premiere.
Die Geschichte über einen schwulen Intellektuellen, der durch den Tod seines Vaters mit seiner proletarischen Herkunft konfrontiert wird, war das Buch der Stunde. Es erinnert das linksliberale Establishment an die Arbeiterschaft, die einst die Hoffnung des Marxismus war und heute den Front national oder die FPÖ wählt.
Anfang Oktober sollte Eribon nach Wien kommen, um an der Akademie der bildenden Künste sein neues Buch "Gesellschaft als Urteil"(siehe auch Kasten) vorzustellen. Im letzten Moment sagte er ab. Als Treffpunkt hatte Eribon ein Café in der Innenstadt von Bologna ausgewählt, wir unterhalten uns auf Englisch. Es sei zwar laut in den italienischen Städten, aber wegen dieser Lebendigkeit liebe er das Land. Just in diesem Augenblick kracht eine Ladung Geschirr auf den Boden. Mon Dieu!
Falter: Herr Eribon, was machen Sie in Bologna?
Didier Eribon: Ich musste zuerst ein paar Leute in Mailand treffen, weil "Rückkehr nach Reims" gerade eben in der italienischen Übersetzung bei Bompiani erschienen ist. Dann bin ich hierher gefahren, um mich ein bisschen zu erholen, denn es war ein stressiges Jahr. Spanien war mir zu heiß, und ich liege auch nicht gern am Strand. Deswegen Bologna.
Warum war das Jahr so stressig?
Eribon: Wegen Leuten wie Ihnen. Als "Rückkehr nach Reims" im Mai 2016 auf Deutsch erschien, ist es bei mir drunter und drüber gegangen. Ich bin zu Vorträgen unter anderem nach Berlin, Hamburg, München, Zürich und Wien gefahren, habe viele Interviews gegeben. Nicht, dass ich mich darüber beklagen würde, aber die meiste Zeit war ich auf Reisen. Ich kam nicht zum Schreiben. Jetzt brauch ich wieder Ruhe.
Woran arbeiten Sie gerade?
Eribon: An einem Text über das Verhältnis zwischen Macht, Politik und Subjekt. Außerdem habe ich mit einer Abhandlung darüber begonnen, was es heißt, aus einem bestimmten sozialen Background zu kommen und in einem anderen zu leben. Dabei verwende ich dieselbe autoanalytische Methode wie in "Rückkehr nach Reims". Als dieses Buch herausgekommen ist, haben einige Freunde gesagt, schade, dass es genau dann aufhört, als du nach Paris gegangen bist. Nach ein paar Jahren bin ich damals in die Intellektuellenszene geraten und habe mich mit Michel Foucault und Pierre Bourdieu angefreundet. Vorläufig heißt das Buch "Ankunft in Paris".
Sie arbeiten auch mit dem Theaterregisseur Thomas Ostermeier zusammen.
Eribon: Ja, er hat "Rückkehr nach Reims" als Stück an der Berliner Schaubühne adaptiert. Die Deutschlandpremiere mit der Schauspielerin Nina Hoss wird am 24. September sein. Der Hauptteil der Dramatisierung ist ein Film, den Ostermeier mit mir an den Orten meiner Kindheit gedreht hat. Als ich das Buch geschrieben habe, war ich ja nicht dort, daher war es das erste Mal, dass ich wieder das Elternhaus und die Schule besucht habe. Hier, ich kann Ihnen einige Bilder zeigen. (Eribon holt sein Handy heraus und zeigt Fotos von seiner Reise mit Thomas Ostermeier, etwa von dem Häuschen ohne Badezimmer, in dem er die ersten Jahre verbrachte.)
Was hat sich verändert?
Eribon: Nicht viel, unter der weißen Farbe schimmert das ursprüngliche Grau durch. Ich kann Ihnen auch ein Foto der Fabrik zeigen, in der meine Mutter gearbeitet hat. Von 1700 Arbeitern waren 500 Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaft CGT. Da gab es große Streiks, einer der Aktivisten wurde 1978 von einem Rechtsradikalen ermordet. Dieses hässliche Gebäude gibt es immer noch, allerdings steht es jetzt leer.
Wie hat sich die politische Landschaft verändert?
Eribon: Der Norden Frankreichs war im 19. Jahrhundert die Wiege der Arbeiterbewegung, jetzt ist die Linke hier beinahe völlig verschwunden. Bei Parlamentswahlen wurden die linken Kandidaten bis in die 80er-Jahre hinein oft in der ersten Runde gewählt, das heißt, sie bekamen über 50 Prozent. Jetzt schaffen sie es oft nicht einmal mehr in die zweite Runde, weil die rechten Kandidaten viel mehr Stimmen haben. Die Landkarte war rot, jetzt ist sie schwarz. Zuvor war die Region kommunistisch, jetzt ist sie total nationalistisch.
Wann hat die Linke die Arbeiterklasse verloren?
Eribon: Dafür gibt es kein bestimmtes Datum, sondern das war ein langer Prozess. Es gab einen Backlash gegenüber dem Aufstand von 1968. Die Bourgeoisie hat mit einer intellektuellen Gegenrevolution reagiert, die von Thinktanks ausging, die von der Wirtschaft finanziert wurden. Auch die Sozialistische Partei driftete nach rechts. Als François Mitterrand im Jahr 1981 an die Macht kam, dachten viele, das sei die Vollendung von 1968. Aber sobald die Wahlen vorbei waren, setzte die Enttäuschung ein. Mitterrand war keineswegs links und seine Mitarbeiter kamen von Eliteunis, die ich die Schulen der Macht nenne, etwa die École nationale d'administration oder das Institut d'études politiques. Hier werden die Bürgerkinder zu Technokraten erzogen, dazu, wie man soziale Probleme mit ein paar Zahlen auf einem Blatt Papier löst. Emmanuel Macron ist das monströse Resultat dieser Geschichte der Linken, an deren Ende eine Regierung steht, die vorgibt, weder rechts noch links zu sein. Und das heißt, wie wir täglich sehen, offensiv rechts.
Die Soziologen Luc Boltanskis und Ève Chiapello beschäftigten sich in ihrem Buch "Der neue Geist des Kapitalismus" mit den Idealen von 1968. Eine ihrer Thesen lautet, dass die Ideale von damals, Freiheit und Eigenverantwortung, den Kapitalismus verändert haben. Was sagen Sie dazu?
Eribon: Boltanksi ist ein rechter Katholik, der ein hässliches Buch gegen Abtreibung geschrieben und gegen die juristische Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften anagitiert hat. Er wollte, dass in der Soziologie wieder religiöse Werte berücksichtigt werden, um nichts anderes geht es ihm. Auch "Der neue Geist des Kapitalismus" ist ein total reaktionäres Buch.
Warum?
Eribon: Weil Technokraten mit dem Denken von Unternehmern das genaue Gegenteil eines linken Ideals von Emanzipation sind. Denken Sie an den Feminismus, die LGBT-Bewegung und die Ökobewegung, dabei geht es um individuelle Befreiung durch kollektive Kämpfe. Diese Form des politischen Liberalismus ist etwas ganz anderes als der ökonomische Neoliberalismus. Ich weiß, dass es in Deutschland und Frankreich jetzt Stimmen gibt, die diese Gegensätze vermischen. Sie sagen, wenn du dich für die Rechte von Homosexuellen einsetzt, bis du mitverantwortlich für den Erfolg des Neoliberalismus.
Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Eribon: Das ist diskursive Gewalt. Haben Sie Margaret Thatcher oder Ronald Reagan jemals für die Rechte von Schwulen und Lesben kämpfen sehen? Auch Donald Trump steht für eine liberale Agenda, aber nur, was die Wirtschaft betrifft, und nicht die Rechte von Frauen und Migranten. Der konservative Backlash nach 68 hat der Linken vorgeworfen, die traditionellen Werte von Nation und Familie zu zersetzen. Diesen Backlash gibt es jetzt von links: Sie werfen dem Individualismus vor, die Gemeinschaft zu zerstören. Für mich ist dieses Zugehörigkeitsgefühl aber genau das, wovon ich ausgeschlossen wurde. Als Jugendlicher habe ich Peter Fleischmanns Film "Jagdszenen aus Oberbayern" mit Martin Sperr in der Hauptrolle gesehen. Dieser Film, in dem ein schwuler Mann von den Dorfbewohnern gejagt wird, hat mich traumatisiert. Wenn beklagt wird, dass Ort und Gemeinschaft erodieren und man wieder das Dorfgasthaus braucht, wo man bei einem Bier gemeinsame Werte teilt, dann denke ich an den Film von Fleischmann.
Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie "Rückkehr nach Reims" geschrieben haben?
Eribon: Die Idee kam mir, als mir meine Mutter gestanden hat, dass sie einmal den Front national gewählt hat. Mein Bruder hat mich gefragt, warum ich so überrascht sei, für ihn war das normal. Da habe ich darüber nachgedacht, wie sich unsere Gespräche verändert haben. In den 70er-Jahren haben wir noch ganz anders geredet.
In dem Buch erzählen Sie die Geschichte eines Aufsteigers, der den Sprung vom Proletariat in die bessere Gesellschaft schafft. Manchmal hat man den Eindruck, als wäre man im 19. Jahrhundert.
Eribon: Das ist nicht 19. Jahrhundert, sondern sehr zeitgenössisch. Mein Schüler und Freund Édouard Louis schreibt nun selbst Romane, in denen er ähnliche Geschichten erzählt. Und er ist erst 25. Sein erster Roman, "Das Ende von Eddy", handelt ebenfalls von einem schwulen Jungen in einem proletarischen Milieu und was die Kultur für eine Anziehungskraft auf ihn hat.
In Ihrem neuen Buch "Gesellschaft als Urteil" schreiben Sie viel über die Liebe zur Literatur und Oper. Haben Sie sich in die Kultur des bürgerlichen Feindes verliebt?
Eribon: Als Teenager musste ich mich neu erfinden. Ich war anders, und daher wollte ich mich auch bewusst von den anderen unterscheiden. Damals war es total wichtig, dass sich Intellektuelle und Künstler in die Politik eingemischt haben: Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Margaret Duras, später auch Pierre Bourdieu und Michel Foucault. Für mich als jungen Trotzkisten war das ein Schlüsselerlebnis. Durch die Politik bin ich zu den Büchern gekommen. Für Homosexuelle war Kultur immer eine Möglichkeit, eine eigene Identität zu finden.
War die Rezeption Ihres Buches in Frankreich anders als in Deutschland?
Eribon: Gar nicht so, auch in Frankreich war es ein Bestseller. Nur in den Medien war es nicht so erfolgreich, was mit mir zu tun hat. Ich mag unsere Medien nicht.
Warum nicht?
Eribon: Vielleicht finden Sie das jetzt unbescheiden, aber die französischen Kritiker waren nicht fähig zu erkennen, was das Neue an meinem Buch war. Ich habe versucht, meine persönliche Geschichte in einen soziologischen Rahmen zu stellen. Auch die linken Medien sind da so konformistisch und konnten nicht akzeptieren, dass "Rückkehr nach Reims" nicht nur eine Autobiografie und nicht nur ein politischer Essay ist, sondern beides zusammen.
Wie erklären Sie sich diesen Unterschied?
Eribon: In deutschen Feuilletons sind noch immer lange Artikel über Bücher zu finden, etwas, was es in Frankreich nicht mehr gibt. Die Literaturseiten etwa dienen nur mehr der Werbung. Außerdem fiel die Veröffentlichung in Deutschland mit einer wichtigen politischen Veränderung zusammen. In der ehemaligen DDR haben Menschen aus der Arbeiterklasse rechtsextreme Parteien gewählt und alle haben sich gefragt, wie das möglich sein kann. Mein Buch hat keine direkte Erklärung dafür geliefert, aber einige Denkanstöße.
Zu welcher Erkenntnis sind Sie gekommen?
Eribon: Ich habe mich gefragt, ob es nicht möglich wäre, das Konzept der sozialen Klasse wiederzubeleben, weil der Begriff fast vollständig aus der politischen Debatte verschwunden ist. Einige Kritiker haben mir vorgeworfen, ein altmodischer Marxist zu sein, was ich ja überhaupt nicht bin. In der marxistischen Definition treffen zwei Blöcke aufeinander und am Ende gewinnt der eine und der andere verschwindet. Dennoch plädiere ich dafür, am Begriff der Klasse festzuhalten.
Wie definieren Sie Klasse?
Eribon: Immer ist ganz vage von Ungleichheiten die Rede, aber nicht davon, wie sie zustande kommen und reproduziert werden. Entscheidend bei der Aufspaltung der Gesellschaft in soziale Klassen ist meiner Ansicht nach das Schulsystem. In Frankreich und Großbritannien ist das offensichtlich, aber ist es nicht auch in Deutschland und Österreich so, dass ein Arbeiterkind eher in einer Fabrik landet als Anwalt oder Banker zu werden? Die Funktion des Schulsystems scheint darin zu liegen, die Klassen zu erhalten, wie sie sind. Nie war die Kluft zwischen Grandes écoles sowie bürgerlichen Privatschulen auf der einen und den Massenuniversitäten auf der anderen Seite größer als heute.
Sie sprechen von Arbeiterklasse und Klassenkampf, obwohl gar nicht mehr so klar ist, was das überhaupt ist.
Eribon: Vielleicht sollten wir die Definition von Klasse ändern, um zu verstehen, was Klassenkampf heute ist. Denken Sie an eine Kassiererin im Supermarkt, die das ganze Jahr über dieselben Handbewegungen macht. Auch wenn sie nicht mehr in einer Fabrik steht, arbeitet sie wie an einem Fließband. Außerdem war der Begriff immer schon unscharf. Zur Arbeiterklasse gehörten Bergarbeiter ebenso wie Eisenbahner, mithin Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation der kapitalistischen Enteignung befunden haben.
Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen verwirrt. Sie wollen zurück zur Arbeiterklasse, aber Ihr Buch ist voller Abscheu gegenüber diesem Milieu.
Eribon: Ich habe immer an den Klassenkampf geglaubt, auch wenn ich von meiner Familie davongelaufen bin. Und ich habe immer links gewählt und mich als linker Intellektueller verstanden, auch wenn ich versucht habe, der Armut und diesem homophoben Milieu zu entkommen. Ich versuche auch gar nicht, diesen Widerspruch aufzulösen, sondern ihn zum Thema zu machen. Was ich über mich zu sagen habe, ist kompliziert, und das ist es auch für Sie als Leser. Allerdings sind Sie jemand, der solche Bücher liest. Meine Eltern und Brüder tun das nicht.
Sie sind ein Uniprofessor und Teil des Pariser Establishments. Welche Verbindung haben Sie denn überhaupt noch zum Proletariat?
Eribon: Nein, nein, ich bin nicht Arbeiterklasse. Aber ich bin immer noch in ihr verankert. Das merke ich auch im Alltag. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Meine Mutter ist jetzt in einem Pflegeheim auf dem Land untergebracht, 30 Kilometer von Reims entfernt. Um sie zu besuchen, muss ich von Paris nach Reims und den öffentlichen Bus nehmen. Wir können uns kein Altersheim im Zentrum leisten. Als ich sie letzte Woche besucht habe und im Bus gesessen bin, um mich herum lauter Arbeiter, wurde mir bewusst, dass sich zumindest teilweise die Dinge für mich nicht wirklich geändert haben. Wir können unserem Käfig nicht entkommen. Soziale Klassen haben sich einem eingeschrieben, in jedem Wort, das wir sprechen, in jeder Bewegung, die wir machen. Die soziale Klasse sind wie Schmutzreste, die hängen bleiben.
Ihre Eltern haben soziale Unterdrückung erlebt, Sie haben sexuelle Diskriminierung am eigenen Leib erfahren. Gibt es einen Unterschied zwischen sexueller und sozialer Ausgrenzung?
Eribon: Einige Kritiker haben "Rückkehr nach Reims" so interpretiert, dass wir die Identitätspolitik zugunsten des Klassenkampfes aufgeben sollten. So habe ich das überhaupt nicht gemeint. Dass soziale Klassen einen politischen Rahmen bilden, heißt ja nicht, dass es nur einen Kampf gibt. Es gibt genauso den Geschlechterkampf, den Rassenkampf etc. Wir sind das, was wir bereits waren, bevor wir geboren wurden. Die Kategorien der Gesellschaft sind hier, man betritt sie nur.
Wie meinen Sie das?
Eribon: Die französische Schriftstellerin Violett Leduc hat ein Buch darüber geschrieben, was es früher hieß, ein uneheliches Kind zu sein. Es war wie ein Fluch. Man hat ihr auf der Straße "Bankert" nachgerufen, Anfang des 20. Jahrhunderts, und sie hat ihre Mutter gefragt, was das ist. Statt sie zu trösten, hat ihre Mutter sie angebrüllt. Sie hat ihr zum Vorwurf gemacht, überhaupt auf der Welt zu sein. Der Begriff bâtard ist mit einer Geschichte der Geschlechter verknüpft. Leducs Mutter war Dienstmädchen, ihr Vater ein Sohn des Hauses, der von seinem Kind nichts wissen wollte. Wie dieses Mädchen und wie auch ihre Mutter werden wir in Kategorien hineingeboren. Unsere Umwelt gibt uns zu verstehen, wer wir sind.
Trifft das auch auf jemand zu, der homosexuell ist?
Eribon: Auch die Kategorie Schwuchtel hat bereits existiert. Man muss sich darüber klar werden, woher diese Werturteile und sozialen Definitionen kommen und welche Macht sie besitzen. Mein Buch "Gesellschaft als Urteil" ist eine Referenz auf Franz Kafkas Roman "Der Prozess". Du wirst von einem Gericht verurteilt und hast nicht die Möglichkeit zu fragen, warum du verurteilt worden bist. Die Gesellschaft bricht den Stab über dich, indem sie dich Bankert, Schwuchtel oder Neger nennt. Damit musst du klarkommen und hier beginnt auch der Kampf.
Was wäre dann ein soziales Urteil?
Eribon: Eines der Urteile ist die Herkunft. Dass mein Vater in eine Arbeiterfamilie hineingeboren wurde, war ein Verdikt. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als mit 13 Jahren in die Fabrik zu gehen und dort zu schuften bis zur Pensionierung. Es gibt diese soziale Gewalt, die beklemmend ist und aus der es kein Entkommen gibt. Der Vater meines Vaters war ein Arbeiter, seine Mutter eine Putzfrau. Mein Vater wurde Arbeiter, meine Mutter war Putzfrau und wechselte dann in die Fabrik.
Nach der Wahl von Donald Trump gab es Kritiker, die gesagt haben, hört auf mit der Political Correctness und kümmert euch wieder um die wirklichen Probleme. Ist der Kampf gegen den Sexismus ein Luxusproblem?
Eribon: Darauf möchte ich wieder mit einer Geschichte antworten. Meine Großmutter arbeitete zu Hause, hat gekocht und die Kinder großgezogen. Sie hatte zwölf Kinder, einige sind außerdem im Wochenbett gestorben. Einmal musste sie ins Gefängnis, weil sie abgetrieben hatte. Aber Sie können auch als Schwarzer auf offener Straße rassistisch beschimpft werden, obwohl Sie reich sind. Oder als schwuler Mann von Migrantenkids, verbal oder tätlich, angegriffen werden. Verstehen Sie, was ich meine: Es gibt nicht nur die eine Diskriminierung, die eine Unterdrückung, die eine Form von Herrschaft.
Was sind Sie mehr, Klassenkämpfer oder Schwulenaktivist?
Eribon: Wir alle haben nicht nur einen biologischen, sondern auch einen politischen Geburtstag. Die algerische Schriftstellerin Assia Djebar, Jahrgang 1936, behauptet in ihrer Autobiografie, dass sie im Jahr 1842 geboren wurde: dem Jahr, in dem das Dorf ihrer Vorfahren von den Kolonialtruppen niedergebrannt wurde. Sie hat sich selbst ein eigenes Geburtsdatum gegeben. Vielleicht wurde ich im 19. Jahrhundert geboren, als die Bergarbeiter im Norden Frankreichs, wo meine Familie herkommt, damit begonnen haben, Gewerkschaften zu gründen und Streiks zu organisieren. Vielleicht wurde ich auch im Jahr 1895 geboren, als Oscar Wilde wegen des Vergehens homosexueller Unzucht angeklagt und zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurde. Wir sind nicht nur das eine oder das andere. Ich bin beides. Und vieles anderes.
Zur Person
Didier Eribon,
Jahrgang 1953, stammt aus dem französischen Reims. Nach dem Studium der Philosophie arbeitete er als Journalist, veröffentliche Bücher über Claude Lévi-Strauss und Michel Foucault und war in der Schwulenbewegung aktiv. Im deutschsprachigen Raum wurde er durch die autobiografisch gefärbte Analyse "Rückkehr nach Reims" bekannt
Zur Serie
Am 7. November (julianischer Kalender: 25. Oktober) jährt sich zum 100. Mal die Oktoberrevolution. Aus diesem Anlass stellen wir die Frage: Was wurde aus dem Proletariat und dem Kommunismus?
Bisher erschienen:
Das Schweigen der Hämmer (Falter 37/17)
Homo Faulenz (Falter 38/17)
Marx ohne Marxismus (Falter 39/17)
Reflexionen eines Klassenflüchtigen: das neue Buch von Didier Eribon
Eine Erklärung für den großen Erfolg von Didier Eribons "Rückkehr nach Reims" ist der autobiografische Blickwinkel, der aus einer soziologischen Analyse eine gut lesbare Geschichte macht. Ähnlich lebendig - und leider auch wehleidig - geht es in "Gesellschaft als Urteil" weiter, das mit einigen Jahren Verzögerung in deutscher Übersetzung erscheint.
Auch hier geht es um Klassenverhältnisse vor dem Hintergrund persönlicher Erlebnisse. Im Mittelpunkt stehen nicht die Erinnerungen an den Geburtsort Reims, sondern die Begegnungen mit Intellektuellen und die Lektüre prägender Bücher. In der von ihm so genannten Autosozioanalyse erzählt Eribon vom Übertritt in die "legitime Kultur", die aus dem Arbeitersohn den Liebhaber von Romanen Claude Simons und den Opern Alban Bergs machte. Warum, fragt sich Eribon, haftet dem "Klassenflüchtigen" dennoch ein Stallgeruch an?
Ein zentrales Kapitel ist dem Soziologen Pierre Bourdieu gewidmet, mit dem Eribon bis zu dessen Tod 2002 befreundet war und mit dem er die proletarische Herkunft gemeinsam hat. Die beiden gingen unterschiedlich mit dem sozialen Schamgefühl um. Während sich Bourdieu eine Sympathie für die gewalttätigen Kids aus der Vorstadt bewahrte, war Eribons Blick auf die Verhältnisse stets von seiner Homosexualität geprägt.
"Schwul zu sein bedeutet, in seinem tiefsten Inneren von einer geradezu ontologischen Verletzbarkeit zu sein", schreibt Eribon. Bourdieus Untersuchungen der unsichtbaren Grenzen zwischen den sozialen Klassen, die vor allem auch im Bildungssystem reproduziert werden, waren für Eribons Denken entscheidend. Gewalterfahrungen hinderten ihn indes daran, in den Burschen aus der Banlieue die Hoffnungsträger einer Bewegung zu erkennen.
Zu den literarischen Einflüssen gehören auch Bücher von Annie Ernaux und Simone de Beauvoir, die ihren Müttern jeweils autobiografische Texte widmeten. Auch hier geht es um die Gesetzmäßigkeiten eines Milieus, das wenigen einen Platz in der Geschichte ermöglichte und die anderen zum Schattendasein verdammte. Die ökonomische Ungleichheit sei, argumentiert Eribon, in noch viel tiefere Mechanismen der Differenzierung eingebettet. "Man fühlt sich unwohl, wenn man in einem bürgerlichen Haus zu Gast ist, man weiß nicht, wie man im Restaurant mit dem Besteck umgehen soll", beschreibt Eribon die Macht der bürgerlichen Kultur.
Eribons Bekenntnisdrang kann einen mitunter nerven. Wie in "Rückkehr in Reims" fragt sich der Leser öfters, ob sich der Autor nicht doch etwas zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Ein bisschen weniger "Ich" und mehr Fakten würden der Schärfe seiner Analysen guttun. Dennoch verrät auch dieser Essay viel über die Feinmechanik der französischen Gesellschaft, in der sich auch noch im 20. Jahrhunderts die Geschichte eines Arbeitersohns mit Bildungsambitionen liest wie ein Entwicklungsroman aus der Zeit der Pariser Kommune.
Reflexionen eines Klassenflüchtigen: das neue Buch von Didier Eribon
Matthias Dusini in FALTER 40/2017 vom 04.10.2017 (S. 29)
Eine Erklärung für den großen Erfolg von Didier Eribons „Rückkehr nach Reims“ ist der autobiografische Blickwinkel, der aus einer soziologischen Analyse eine gut lesbare Geschichte macht. Ähnlich lebendig – und leider auch wehleidig – geht es in „Gesellschaft als Urteil“ weiter, das mit einigen Jahren Verzögerung in deutscher Übersetzung erscheint.
Auch hier geht es um Klassenverhältnisse vor dem Hintergrund persönlicher Erlebnisse. Im Mittelpunkt stehen nicht die Erinnerungen an den Geburtsort Reims, sondern die Begegnungen mit Intellektuellen und die Lektüre prägender Bücher. In der von ihm so genannten Autosozioanalyse erzählt Eribon vom Übertritt in die „legitime Kultur“, die aus dem Arbeitersohn den Liebhaber von Romanen Claude Simons und den Opern Alban Bergs machte. Warum, fragt sich Eribon, haftet dem „Klassenflüchtigen“ dennoch ein Stallgeruch an?
Ein zentrales Kapitel ist dem Soziologen Pierre Bourdieu gewidmet, mit dem Eribon bis zu dessen Tod 2002 befreundet war und mit dem er die proletarische Herkunft gemeinsam hat. Die beiden gingen unterschiedlich mit dem sozialen Schamgefühl um. Während sich Bourdieu eine Sympathie für die gewalttätigen Kids aus der Vorstadt bewahrte, war Eribons Blick auf die Verhältnisse stets von seiner Homosexualität geprägt.
„Schwul zu sein bedeutet, in seinem tiefsten Inneren von einer geradezu ontologischen Verletzbarkeit zu sein“, schreibt Eribon. Bourdieus Untersuchungen der unsichtbaren Grenzen zwischen den sozialen Klassen, die vor allem auch im Bildungssystem reproduziert werden, waren für Eribons Denken entscheidend. Gewalterfahrungen hinderten ihn indes daran, in den Burschen aus der Banlieue die Hoffnungsträger einer Bewegung zu erkennen.
Zu den literarischen Einflüssen gehören auch Bücher von Annie Ernaux und Simone de Beauvoir, die ihren Müttern jeweils autobiografische Texte widmeten. Auch hier geht es um die Gesetzmäßigkeiten eines Milieus, das wenigen einen Platz in der Geschichte ermöglichte und die anderen zum Schattendasein verdammte. Die ökonomische Ungleichheit sei, argumentiert Eribon, in noch viel tiefere Mechanismen der Differenzierung eingebettet. „Man fühlt sich unwohl, wenn man in einem bürgerlichen Haus zu Gast ist, man weiß nicht, wie man im Restaurant mit dem Besteck umgehen soll“, beschreibt Eribon die Macht der bürgerlichen Kultur.
Eribons Bekenntnisdrang kann einen mitunter nerven. Wie in „Rückkehr in Reims“ fragt sich der Leser öfters, ob sich der Autor nicht doch etwas zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Ein bisschen weniger „Ich“ und mehr Fakten würden der Schärfe seiner Analysen guttun. Dennoch verrät auch dieser Essay viel über die Feinmechanik der französischen Gesellschaft, in der sich auch noch im 20. Jahrhunderts die Geschichte eines Arbeitersohns mit Bildungsambitionen liest wie ein Entwicklungsroman aus der Zeit der Pariser Kommune.