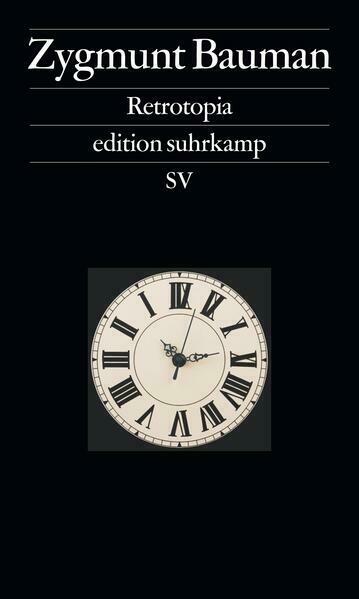Zurück in die untote Vergangenheit
Gerlinde Pölsler in FALTER 10/2018 vom 07.03.2018 (S. 20)
In seinem letzten Buch erklärt der Soziologe Zygmunt Bauman, warum wir im Zeitalter der Nostalgie leben und was daran so gefährlich ist
„Make America great again!“ Mit diesem Spruch beschwor US-Präsident Donald Trump eine verklärte Vergangenheit und fing die Sehnsucht von Millionen ein. Auch in anderen Ländern ist die „Rückkehr ans Stammesfeuer“, wie Bauman es nennt, zu beobachten: scharfe Grenzziehung, Mauern mit Stacheldrahtkrone und der Glaube an die eigene Überlegenheit inklusive.
Die Sehnsucht nach einer „verlorenen, geraubten, verwaisten, jedenfalls untoten Vergangenheit“ sah der polnisch-britische Soziologe und Philosoph Zygmunt Bauman als prägend für unsere Zeit. „Retrotopia“ sollte das letzte Buch des vielfach Ausgezeichneten werden, Bauman starb Anfang 2017. Klein-Klein war seine Sache nie. Bauman stellt die großen Zusammenhänge her, er mäandert durch die Jahrhunderte und über die Kontinente, zitiert wissenschaftliche Literatur ebenso wie Populärkultur. En passant streift er dabei Themen wie Populismus und Flucht, Liebe, Einsamkeit und Echokammern bis hin zur Wiederkehr der „Habenden“ versus die „Habenichtse“.
Die Zukunft als finsterer Ort
500 Jahre nachdem Thomas Morus in „Utopia“ eine helle Zukunft entwarf, in der alles möglich schien, empfinden viele Menschen heute „Zukunft“ als einen bedrohlichen Ort. Sie kann bringen, dass man Job und Familie verliert, sozial absteigt und die eigene Stadt in eine „Nachbarschaft voller Fremder“ verwandelt findet. Daher, so Bauman, klammert man sich an eine romantisierte Vergangenheit, die unzweifelhaft noch „uns“ gehörte und in der angeblich noch keine Fremden da waren.
Die Individualisierung brachte zwar neue Freiheiten, entpuppte sich aber für viele als Pyrrhussieg. Da ist Bauman ganz bei Ulrich Beck und dessen „Risikogesellschaft“. Freiheit bedeute heute vor allem Freiheit von Sicherheit und Bindungen und damit: Angst. Angst, den Ansprüchen nicht zu genügen. Angst, nicht dazuzugehören. Wo jeder von klein auf lernt, dass nur er selbst seines Glückes Schmied sein kann, da ist jeder allzeit bereit, sich selbst zu verteidigen. Alle anderen werden zu potenziellen Feinden. Und schon sind wir wieder zurück beim „homo homini lupus“: der Mensch als des Menschen Wolf.
Der Staat bietet keine Zuflucht mehr
Als Gegenmittel sah Thomas Hobbes einst den „Leviathan“, den starken Staat. „Vom Staat (…) glaubte man noch vor gar nicht langer Zeit, er erfülle die ihm auferlegte Mission ordnungsgemäß, die dem Menschen angeblich angeborene Grausamkeit zu unterdrücken, damit unser Leben in der Gemeinschaft mit anderen nicht ‚scheußlich, tierisch und kurz‘ sei.“ Doch inzwischen traut man ihm das immer weniger zu. Die Nationalstaaten können ihre Versprechen von Sicherheit und Wohlstand kaum noch einlösen. Das hat mit der Globalisierung zu tun und damit, dass die Mächtigen sich der Kontrolle der Politik entziehen.
Mehr denn je sitzt die Menschheit also in einem Boot, auch was ihr Überleben auf diesem Planeten angeht. Doch, und hier sieht Bauman eine „Metazwickmühle“: Weder haben wir schon so etwas wie ein kosmopolitisches Bewusstsein, noch sind die politischen Instrumente auf die neuen Tatsachen ausgerichtet. „Eine Kluft tut sich auf zwischen dem, was getan werden muss, und dem, was getan werden kann.“
Im Schlusskapitel wird der Autor im Tonfall dringlicher, mahnend: Erstmals in der Geschichte gelte es, eine Weltgesellschaft zu bilden, die ohne die Definition eines Feindes auskommt. „Mehr als zu jeder anderen Zeit stehen wir, die menschlichen Bewohner des Planeten Erde, vor einem Entweder-oder: Entweder wir reichen einander die Hände – oder wir schaufeln einander Gräber.“ Ein Buch, das nachhallt.