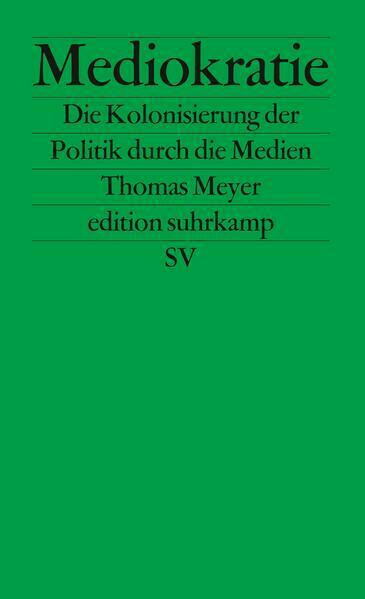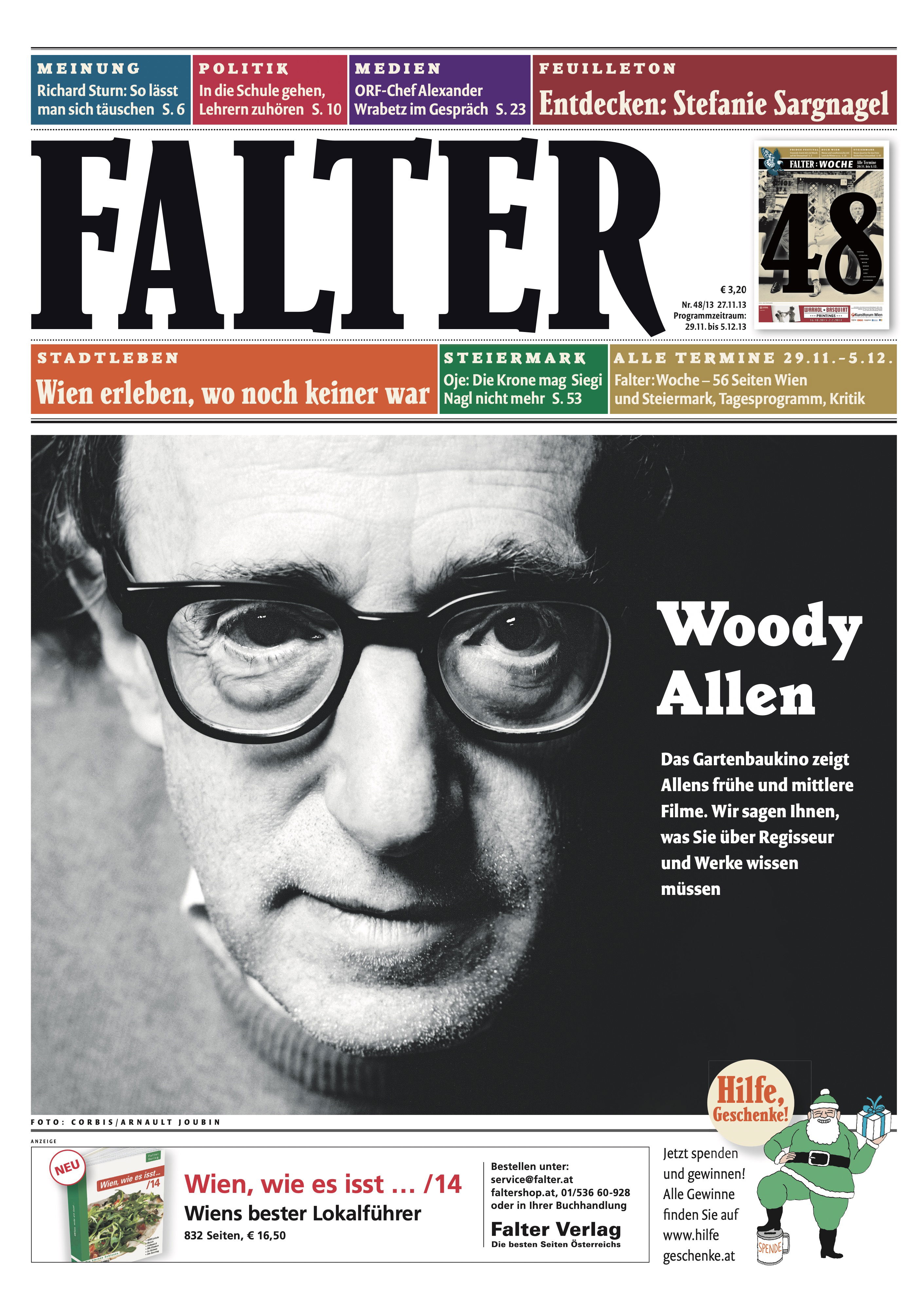
Idiotisierung der Öffentlichkeit
Wolfgang Zwander in FALTER 48/2013 vom 27.11.2013 (S. 20)
FAZ-Feuilletonist Nils Minkmar beschreibt in seinem Buch "Zirkus", wie die deutschen Medien dem SPD-Spitzenkandidaten Peer Steinbrück keine Chance gaben, einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf zu führen (siehe große Rezension). Die wissenschaftliche Analyse dazu stammt vom Politologen Thomas Meyer und ist zwölf Jahre alt; in "Mediokratie" berichtet er über die Idiotisierung unserer Öffentlichkeit.
Inhalt, Abwägung, Pro und Contra, das sei in den Massenmedien nicht mehr gefragt; stattdessen werde die Quote mit Ressentiments und "Stimmungsbildern" in die Höhe getrieben. Weil es eine Mordsgaudi ist und Auflage verspricht, wird die "Sau" Steinbrück durchs Dorf getrieben. Meyers Standardwerk ist aktueller denn je.
Die Seligsprechung Jörg Haiders und ein Missverständnis namens Populismus
Armin Thurnher in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 5)
Es ist die Stunde der Déja-vus. Die Covers der Magazine suhlen sich im Stracheglanz, wie einst in dem Jörg Haiders. Diese Woche – Anlass: Haiders fünfter Todestag – wieder einmal beide kombiniert, mit Gänsehautfaktor: Hach, was hatte der für 'n Charisma! Lass uns in Erinnerungen schwelgen, wie es uns kalt den Rücken hinunterrann, als der die vollen Plätze mit seiner dämonischen Demagogie elektrisierte. Dagegen Strache: der brüllt bloß.
Wenn es so einfach wäre. Die Besorgtenpresse tut ihr Bestes, ich sehe sie noch vor mir, die Profil- und die News-Cover, eine endlose Abfolge der Verherrlichung, die TV-Sendungen all der Kritiker, die der Bildsprache Haiders auf den Leim gingen und so sein Propagandageschäft besorgten, während sie so taten, als kritisierten sie ihn.
Die Grundlage des Lähmungsgefühls ist weiterhin vorhanden. Es ist das fehlende Charisma unserer politischen Protagonisten, aber nicht nur. Selbst wenn einer Charisma hätte, es würde auf dem Nährboden unserer verrotteten Medien verwelken. Denn das erpresserische Beziehungsgeflecht, das der politmedialen Darstellung zugrunde liegt, ist mit Händen zu greifen.
Man kann den Zynismus aber immer noch ein bisschen weitertreiben. Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner fordert schon die Rückkehr zu politischem Denken. Auch Eva Dichand, die Chefin von heute und Heute, wird gewiss bald etwas fordern oder dessen Gegenteil. Und ORF-Boss Alexander Wrabetz legt seine Pfote auf die Quote.
In diesen Tagen, die der aufkommenden Haidernostalgie gewidmet sind, der Vorstufe zum Seligsprechungsprozess (die Kronen Zeitung schritt vergangenen Sonntag wieder einmal voran, blöd nur, dass der Papst nicht mehr passt), darf man auf ein paar elementare Dinge hinweisen.
So ist die Politisierung der Politik nur um den Preis ihrer Entmedialisierung zu haben. Alle klugen Analytiker der Mediokratie, ihnen voran Thomas Meyer, der den Terminus prägte (und vor ihm Alexander Kluge und Oskar Negt in ihrem berühmten Buch "Öffentlichkeit und Erfahrung"), haben darauf hingewiesen, dass politische Zeit und Medienzeit sich nicht miteinander vertragen.
Wenn die Regierungsparteien sich der Laokoongruppe nicht entwinden, die sie mit den Boulevardmedien bilden, werden ihre eigenen Stimmen immer leiser werden. Immer lauter werden jene der Medien und immer schneller. Während politische Prozesse des Aushandelns bedürfen, der Kompromisse, der wohlbedachten und längere Zeit in Anspruch nehmenden Formulierung, legen Medien alles an auf Verkürzung, Beschleunigung, Instantbefriedigung.
Auch Expertendenken ist politischem Denken entgegengesetzt, es bedarf des Fachverstands, der schnell zu einem Ergebnis kommt. Politik hingegen muss auf lange Dauer setzen. Deswegen ist die nun erhobene Forderung nach Experten und 1000 Projekten ebenso hilflos wie die gut gemeinte Wortmeldung des Verfassungsgerichtspräsidenten Gerhart Holzinger, der die schnelle Realisierung eines Demokratiepaketes einmahnt (abgesehen von der sprachlichen Unempfindlichkeit, die selbst die Demokratie in Pakete schnürt und auf dem Postamt der Trostlosen aufgibt).
Umso wichtiger wäre es, dass Politik ihre eigene Sprache findet, wiederfindet, neu findet. Eine Sprache, zu der sie in ihrer erstickenden Verflechtung mit Medien, die anderen Gesetzen gehorchen, nicht gelangen kann. Die Scheinbelohnung an Aufmerksamkeit, die sie erhält, weil sie sich auf diese Verflechtung einlässt, erweist sich als trügerisch. Aufmerksamkeit ist eine Währung, die sich schnell verbraucht.
Die Regierungsparteien haben keine Sprache mehr. Strache hat immerhin sein rohes Gebrüll und die plumpen Verse seines Ghostwriters. Seiner allerprimitivsten Lüge, des vorgeschobenen Bekenntnisses zu Österreich, hätte er leicht überführt werden können, hätte einer seiner Gegner ihn und seine Recken nach dem Unterschied zwischen deutscher und österreichischer Nation gefragt. Aber davon haben vermutlich die diversen Spindoktoren abgeraten. So können sich unsere Deutschnationalen weiterhin als Austropatrioten maskieren. Das – nicht der hilflose Antifaschismus – ist der wahre österreichische Karneval.
Wir erinnern uns: Der Deutschnationalismus der FPÖ war Haider nicht zu viel, er hielt ihn aber in populistischer Hinsicht für schädlich. Die österreichische Nation war durch, dagegen kam auch er nicht an. Also schwenkte er auf seine Variante des Austrochauvinismus um. Strache schwenkte zurück, aber keiner seiner Gegner scheint es bemerkt zu haben.
Populismus? Nein! Die österreichische Variante der Mediokratie, die Medienverluderung ist kein Populismus. Der italienische Autor Marco d'Eramo zeichnet in einem heuer unter dem Titel "Apologie des Populismus" veröffentlichten Aufsatz nach, wie der Begriff des politischen Populismus in den vergangenen Jahrzehnten diffamiert wurde. Er erbte das Schlimmste von Kommunismus und Faschismus zugleich, den Geruch der Massenverführung, und wurde im Kalten Krieg gezielt abgewertet.
Heute sind die Volksparteien nicht mehr populistisch und nicht mehr populär. Sie sind stillschweigend Oligarchenparteien geworden. Sie vertreten das Regime "der Märkte", der Finanzinstitutionen, der steuerbegünstigten Investoren. Und sie argumentieren das nicht politisch. Die FPÖ und ihr wahrer Gegenpol, die Grünen, sind Oligarchen-unverdächtig.
Die ÖVP hingegen ist es in überwältigender Weise. Sie zeigt ihr Oligarchenverständnis in Separatabkommen mit Liechtenstein und der Schweiz zur Schonung von Steuersündern und in ihrer Haltung Banken gegenüber, die sie nicht nur gut wegkommen, sondern von denen sie sich auch die Politik vorschreiben lässt. Das gilt in nur leicht abgemilderter Weise auch für die SPÖ. Beide Parteien können schwer als Vertreter populärer gegen oligarchische Interessen im europäischen Rahmen auftreten. Und wenn es die SPÖ könnte, warum tut sie es nicht?
Eine Europa-Kritik aus Solidarität mit der europäischen Idee ist mehr denn je das Gebot der Stunde. Hat da jemand "Klassenkampf" gesagt? Ja, es war Warren Buffett, der Investor, derzeit der viertreichste Mensch der Welt. D'Eramo zitiert ihn mit folgendem deutlichen Satz: "Es gibt Klassenkampf, klar, aber es ist meine Klasse, die reiche Klasse, die den Kampf führt, und wir gewinnen ihn."
Ob das Gefühl für solche Sätze etwas mit dem Wahlergebnis und dem unaufhaltsamen Abstieg der "Volksparteien" zu tun hat? Ob Charisma am Ende aus einer deutlichen Position zu gewinnen wäre? Populär zu werden statt auf Populisten zu schimpfen? Wahlen nicht nur als dekoratives Zubehör für die wahren Entscheidungsträger, "die Märkte", zu betrachten?
Fragen über Fragen, aber die Neuerfindung der österreichischen Politik werden sie nicht bewirken. Die Entrechtsradikalisierung der FPÖ – um den Terminus Entnazifizierung zu vermeiden – wird weiter auf sich warten lassen. Mit einer Rekonstruktion des Öffentlich-Rechtlichen ist nicht zu rechnen. Mit einer eigenständigen Position Österreichs in der EU schon gar nicht. Stellen wir uns vor: Innenministerin Johanna Mikl-Leitner nimmt zu den Toten von Lampedusa Stellung. Stellen wir es uns lieber nicht vor. So weit nach rechts hat Haider die beiden Ex-Volksparteien getrieben.
Also, Entscheidungsträger, Medienoligarcherln und der Rest: Holt die Taschentücher raus zu Haiders Todestag. Und fürchtet euch weiter wohlig vor Hazeh Strache. Im Übrigen bin ich der Meinung, der Mediamil-Komplex muss zerschlagen werden.
"Wir erleben eine Idiotisierung der Öffentlichkeit"
Wolfgang Zwander in FALTER 20/2011 vom 18.05.2011 (S. 20)
Thomas Meyer, einer der renommiertesten Medienexperten
Europas, über den Niedergang von Politik und Journalismus
Als die "neben London sprühendste Stadt Europas" bezeichnet Thomas Meyer Wien, wo er sich zu Vortragszwecken aufhält. Der gebürtige Frankfurter, 67, sitzt im Gastgarten des Café de l'Europe am Graben, bestellt einen Cappuccino und wundert sich über den preisgünstigen Tafelspitz, der um die Ecke angeboten wird. Der bekennende Sozialdemokrat hat unter anderem Willy Brandt beraten und ist ein international gefragter Medienexperte. Mit seinem Buch "Mediokratie", in dem er die Kolonisierung der Politik durch die
Medien kritisiert, sorgte er zuletzt für Aufsehen. Meyer referierte vergangene Woche in Wien im Bruno-Kreisky-Forum.
Falter: Herr Meyer, Sie sagen, Politiker orientieren sich viel zu sehr an der Logik der Boulevardmedien, die kein Interesse hätten an gutem Journalismus, sondern vor allem Geld verdienen wollen. Sie warnten schon vor zehn Jahren in ihrem Buch, dies würde unsere Demokratie zerstören. Wie aktuell ist Ihre Analyse heute?
Thomas Meyer: Sie ist noch zutreffender geworden. Mittlerweile hauen auch öffentlich-rechtliche Sender in die gleiche Kerbe wie die privaten und unterwerfen fast ihr ganzes Programm dem Quotendruck und der Entertainisierung. Dazu kommt noch eine andere Entwicklung: In fast allen europäischen Ländern sitzt eine Generation von neubürgerlichen Journalisten an den Schalthebeln. Diese Leute haben eine postmoderne Problemwahrnehmung. Gesellschaftliche Konflikte behandeln sie nur noch spielerisch, und zu sozialen Themen haben sie ein ironisches bis zynisches Verhältnis. Das hat in Deutschland dazu geführt, dass es bis hinein in das Herz der Qualitätsmedien einen Schutzwall gibt gegen kritische und linke Themen.
Woher kommt diese neubürgerliche Bewegung?
Meyer: Erstens haben die Kinder der 68er einen Überdruss an kritischem und sozialem Engagement. Zweitens sind das oft Leute, die in gut bezahlten Positionen sitzen und die in handfester Art ihre eigenen Interessen vertreten. Hinzu kommt die hohe Medienkonzentration. Die führt dazu, dass drei Päpste die ganze Szenerie beherrschen, während der einzelne Journalist nicht mehr weiß, wo er morgen landet. Deshalb äußert er sich nicht mehr zu riskanten Themen, damit er für alle Arbeitgeber akzeptabel bleibt.
Kritische Themen bleiben auf der Strecke?
Meyer: Ja, sie sind nicht unterhaltsam genug. Die Entertainisierung führt dazu, dass diese Themen nicht prickeln. Ich arbeite auch in der Journalistenausbildung. Dort werden viele gute, sehr kritische Leute ausgebildet. In den Redaktionen bleibt davon aber fast nichts übrig. Wer etwa vor der Weltwirtschaftskrise darüber berichten wollte, dass sich da ein Desaster anbahnt, der wurde von Chefredakteuren ausge-lacht und gefragt: Wer soll denn das lesen? Die Folge ist eine flächendeckende Entpolitisierung, bei der alles nur an Images, Personen und oberflächlichen Konflikten festgemacht wird. Mittlerweile würde ich sogar von einer Idiotisierung der Öffentlichkeit sprechen, weil die Politik einfach aus der Berichterstattung verschwindet.
Inwiefern beschädigt die Entpolitisierung die Demokratie?
Meyer: Die Mediokratie, also die Vorherrschaft der boulevardesken Medienlogik, behindert die demokratische Willensbildung bis zur absoluten Verhinderung. Wir erleben gerade eine Rückkehr der höfischen Öffentlichkeit, in der sich die Herrschenden prätentiös darstellen, während der Rest nicht repräsentiert wird. Hinter dem Schleier der inszenierten Öffentlichkeit passieren längst wieder Sachen, für die keine demokratische Rechtfertigung mehr eingeholt wird, weil die Aufmerksamkeit der Leute durch die Medien auf völlig belanglose Themen wie das "Dschungelcamp" gelenkt wird.
Warum beteiligen sich auch die öffentlich-rechtlichen Sender an dieser Entertainisierung?
Meyer: Die machen das ja nicht ganz freiwillig. Wie viel Geld die Sender erhalten, macht die Politik von den Quoten abhängig. Einige Politiker, vor allem die auf der rechten Seite, machen das ganz gezielt, weil sie wissen, dass es in ihrem Interesse passiert. Die Entpolitisierung ist asymmetrisch, sie trifft die Linke viel stärker als die Rechte. Den Rechten tut das gut, weil sie den Status quo verwalten wollen und davon leben, heimlich ihre Interessen auszumauscheln. Für die Linke ist das tödlich, weil sie vom kritischen Diskurs und konkreten Thematisierungen abhängig ist.
Politiker argumentieren gegenüber den Machern der öffentlich-rechtlichen Sender, dass ihnen das beste Programm nichts bringe, wenn die Zuseher fehlen würden.
Meyer: Die Angst vor dem Quoteneinbruch mag für den Anfang sogar berechtigt sein. Aber ich nehme an, das würde sich ändern, wenn die Fernsehmacher eine Möglichkeit zum Experimentieren hätten. Man kann ja auch politisch Gehaltvolles auf sehr unterhaltsame Weise inszenieren. Der Witz ist, dass eine gute Inszenierung überhaupt nicht entpolitisierend sein muss. Im Gegenteil: Eine gute Inszenierung bringt ja gerade das Politische eines Themas zum Vorschein. Heute wird aber meistens nur der Schein, das bloße Brimborium inszeniert, weil es billiger, einfacher und bequemer ist.
Aber wenn das auch den Politikern selbst schadet: Warum machen die überhaupt da mit?
Meyer: Am Anfang sagen die Politiker, sie machen das nur, um in die Medien zu kommen, um dann ihre "gute Sache" besser verkaufen zu können. Aber sobald sie sich einmal darauf eingelassen haben, kommen sie da nicht mehr raus. Es gibt eine politisch-mediale Klasse, die treibt ein gemeinsames Spiel. Die kennen sich natürlich nicht alle persönlich, aber sie veranstalten zusammen diese oberflächliche Inszenierung. Es gibt dann keinen mehr, der eine Politisierung einklagen würde – im Sinne von Kontroversen, Diskursen, Dialogen und Interessenformulierungen. Das wird als Störung empfunden, und wenn es dann doch einmal zu einer Kontroverse kommt, weil einer ausschert, dann nennen das die Medien einen Zank. Und der wird sofort diskreditiert.
Die Bürger werden nie wachgerüttelt, sondern ständig nur in ihrer eigenen vorurteilsbeladenen Weltsicht bestätigt?
Meyer: Ja, den Menschen wird das Denken abgewöhnt, es werden nur noch über Bilder gewisse Stimmungen erzeugt. Silvio Berlusconi ist das Extrem, weil er dieses Spiel am weitesten getrieben hat. Wozu er in der Lage ist, da er die privaten sowie die öffentlich-rechtlichen Sender kontrolliert und zudem Zeitungen besitzt. Es ist fast nicht mehr möglich, in der italienischen Öffentlichkeit ein politisches Thema zu diskutieren. Das wird sofort als Störung empfunden. Dabei wäre Berlusconis Politik keinen einzigen Tag akzeptabel, wenn es räsonierende Medien und eine kritische Öffentlichkeit gäbe. Aber weil es die nicht gibt, prallen an diesem Mann sogar Verbrechen ab. Dass Berlusconis Fall aber durchaus Schule macht, haben wir in Deutschland mit Guttenberg erlebt. Er hat in der Politik einen Scherbenhaufen angerichtet, seine Bundeswehrreform funktioniert überhaupt nicht. Aber wenn über die Medien so viel Unterstützung kommt, werden die Leute gegen die Fakten fast immun. Das wirkt sich dann so aus, dass sogar ein Mann wie Exkanzler Helmut Schmidt noch vor einem halben Jahr gesagt hat: "Es gibt nur drei Leute in Deutschland, die Kanzler könnten, einer davon ist Guttenberg."
Könnte man nicht einfach behaupten, dass das eine Folge der Demokratie ist? In dem Sinne, dass sich die Mehrheit der Leute einfach nicht für Politik interessiert und die demokratische Herrschaft daher automatisch eine entpolitisierte, mediokre Masse produziert?
Meyer: Am Desinteresse der Menschen trägt nicht die Demokratie Schuld. Wenn wir eine deliberative Demokratie hätten, würde ganz automatisch ein Druck des besseren Arguments entstehen. Und wer keine guten Argumente hätte, könnte sich in einer deliberativen Öffentlichkeit nicht behaupten. Weil es nun aber in der Mediokratie keine funktionierende Öffentlichkeit gibt, wird der Diskurs ersetzt durch lauter einzelne, isolierte Meinungsbildungen. Jeder wird mit den Medien alleingelassen. Und hinzu kommt noch der ganze Umfrageunsinn. Ohne Diskussion werden individuelle Meinungen erhoben und dann wird veröffentlicht: "70 Prozent sind für Ausländer raus." Alle fühlen sich danach in ihrer Meinung bestätigt, anstatt dass man das Thema irgendwie aufbricht. Diese Isolierung ist meiner Meinung nach die Quelle für diese gemeine kleinbürgerliche Mittelmäßigkeit.
Sie verwenden den Begriff deliberative Demokratie so, als ob es diese Regierungsform bereits gäbe. Aber ist das nicht bislang nur ein Zukunftsmodell?
Meyer: Es gibt Modelle einer repräsentativ-liberalen Demokratie, in denen per Losverfahren 150 oder 200 Bürger ermittelt werden, die dann über bestimmte Probleme deliberativ beraten. Da kommen Ergebnisse ganz anderer Qualität raus. Und es gibt manchmal, wenn ein Thema besonders heiß ist, deliberative Inseln in unserer Demokratie. In Deutschland war das in den 70er- und 80er-Jahren beim Thema Kernenergie der Fall. Da haben dann am Ende ein paar Millionen Leute in den Bürgerinitiativen mitdiskutiert. Das flaute dann aber wieder ab – genau das müsste aber gefördert werden.
Aber wer hat die Zeit, die man dafür braucht, heute noch?
Meyer: Das stimmt schon, aber man kann so etwas sogar in den Massenmedien machen. Ich erinnere mich an bestimmte Formate auf BBC. Da hat eine repräsentative Gruppe über ein Thema diskutiert, und durch eine geschickte Moderation ist im Gegensatz zu den Talkshows ein wirklicher Diskurs entstanden. Davon ist vielleicht nicht jeder, der den ganzen Tag am Fließband steht, begeistert, aber es ist eine Möglichkeit, diesen deliberativen Geist über die Massenmedien zu senden.
Wie könnten die Massenmedien dazu gebracht werden, in diese Richtung zu arbeiten?
Meyer: Ganz wichtig wäre eine bessere Medienkompetenz der Leser und Zuschauer. Die Leute müssten sofort merken, wenn da Schwachsinn abläuft. Das ist möglich, aber dafür braucht man eine lebendige Zivilgesellschaft, die immer wieder mit großen Themen in die Öffentlichkeit reinbricht. Und natürlich müsste der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgekoppelt werden vom Quotensystem. Im Grunde genommen müsste man die Medien marktunabhängig machen oder zumindest dafür sorgen, dass sich innerhalb ihrer Marktabhängigkeit ein gewisser Pluralismus findet. Sehr wichtig wäre auch, dass sich die Medien gegenseitig dabei beobachten, wie sie die Welt spiegeln. Das kann ihnen ja niemand abnehmen. Aber die großen Medienkonzerne tun heute einander nicht mehr weh.
Liegt es daran, dass sie sich damit ihr
eigenes Geschäftsmodell zusammenhauen würden?
Meyer: Sie verbinden ihre journalistischen Kampagnen längst mit ihrem eigenen Geschäft. Es gibt eine interessante Studie über die Bild-Zeitung, die besagt, diese sei kein journalistisches Produkt, sondern ein Kampagnenorgan in eigener Sache. Der Hauptzweck ist der Konzernprofit, und manchmal streuen sie in ihre Kampagnen ein bisschen Journalismus rein. Das ist eine riesige Sauerei, weil sie bei der Gelegenheit zum Beispiel gerade die EU beschädigen. Diese widerliche Aktion mit den "Pleite-Griechen" bereitet auf populistisch fiesestem Weg das Geschäft der Europa-Zerstörer.
Was bedeutet diese Art von Medien für die Zukunft unserer Demokratie?
Meyer: Ich war kürzlich auf einer Tagung an der Medienabteilung der Londoner Universität. Da war ein Dutzend Referenten der einhelligen Auffassung, dass eine Demokratie, die diesen Namen auch verdient, mit unserem derzeitigen Mediensystem gar nicht funktionieren kann. Öffentliche Diskurse sind unmöglich, die Blockademacht zum Wegdrücken von Themen ist fest in der Hand von Konzernen mit Privatinteressen, und die Politiker wagen es gar nicht, das zu kritisieren, weil sonst ihre Karrieren sofort kaputt sind.
Würde sich nicht das Internet dafür anbieten, die destruktive Logik der Medienkonzerne auszuhebeln?
Meyer: Das Internet hat ein emanzipatorisches, aufklärerisches Potenzial, aber bei weitem nicht nur. Die Allermeisten benutzen es für reine Unterhaltungszwecke. Diejenigen, die es politisch verwenden, nutzen auch die anderen Medien. Außerdem ist im Internet eine Hysterisierung der Debatte zu beobachten. So spielt es zum Beispiel bei der Organisation der amerikanischen Tea-Party-Bewegung eine massive Rolle. Es bietet die Chance, bei der Mobilisierung einen Schneeballeffekt zu erreichen, was gut oder schlecht sein kann. Und richtige deliberative Prozesse sind im Internet oft genauso schwer zu erreichen wie in den alten Medien. Jeden Mist mal reinzurotzen und dann einfach wegzulaufen, anstatt eine harte Argumentation durchzustehen, das hat mit flächendeckender Emanzipation nichts zu tun.
Wie könnte man dann das politische Denken wieder zurück in den Alltag bekommen?
Meyer: Das politische Denken verschwindet nur bei denen, die mit der Politik nur über die Medien in Kontakt kommen. Es gibt aber immer noch Menschen, die in ihrem eigenen Umfeld politisch arbeiten. Sie sind oft kritisch, aber nicht stark genug, um die Politik zu bestimmen. Im Endeffekt ist es aber nur diese Art von Zivilgesellschaft, die gegenüber den Politikern so viel Druck aufbauen kann, dass Qualität in den Medien wieder subventioniert wird. Der Einzelne kann sich vor der Entpolitisierung am besten dadurch schützen, indem er viele verschiedene Medien konsumiert.
Wie können die Qualitätsmedien selbst zu dieser Änderung beitragen?
Meyer: Sie können eine gut verkaufbare Synthese aus Aufklärung und Unterhaltung bieten. Das muss nicht immer so bierernst sein. Ab und zu sollen sie auch einmal ein bisschen spektakulär reinhauen.