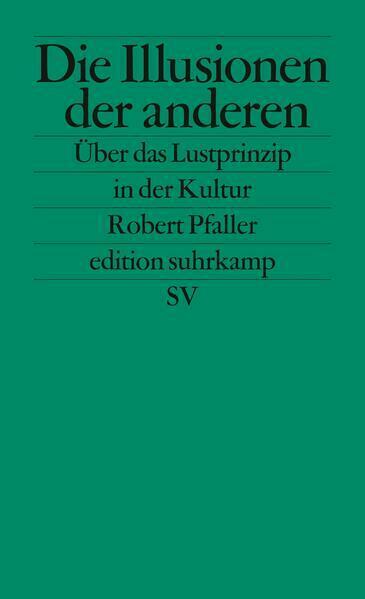Rudolf Helmstetter in FALTER 41/2003 vom 08.10.2003 (S. 32)
In seinem neuen Buch "Die Illusion der anderen" begibt sich der Philosoph Robert Pfaller unter anderem auch auf die Suche nach dem verlorenen Glück.
Auf solche Titel kommen sonst nur französische Philosophen, doch es handelt sich bei diesem kleinen grünen Taschenbuch nicht um eine Übersetzung: "Die Illusionen der anderen". Für den Wiener Philosophen Robert Pfaller ist das der formale Oberbegriff für "Aberglaube" und "Ideologie", für all das, was in der Kultur an Mythen, Einbildungen, tradierten Vorstellungen und Überzeugungen kursiert. Das Besondere seines Zugangs dabei ist, dass Pfaller nach der Form der Illusionen fragt. In welcher Form werden Illusionen, Einbildungen, Überzeugungen geglaubt und praktiziert? Was ist ihr Betriebsgeheimnis? Welche Art von Lust, Glück, Freude bereiten sie denen, die ihnen anhängen?
Dabei geht er von der Beobachtung aus, dass Vorstellungen und Verhaltensweisen, die gemeinhin als "abergläubisch" betrachtet werden, meist von einem besseren Wissen begleitet sind. Wir glauben und tun Dinge, die wir im Grunde unseres Herzens für unsinnig halten. Und wir glauben, dass andere (der "Mann auf der Straße" oder Kinder) wirklich daran glauben. Die Übertragung an andere entlastet von der Zumutung, selbst daran zu glauben, und mit der Vorsicht der Delegation sind diese Illusionen zu genießen.
Die Illusionen der anderen sind also lustvoll, sie sind aber auch von einer spezifischen Ambivalenz gekennzeichnet. Während sich zu den Illusionen der anderen niemand bekennt - Pfaller bezeichnet sie auch als Einbildungen ohne Subjekt -, sind eigene Illusionen (oder "Selbstglaube") Einbildungen, auf die man sich etwas einbildet. Der Selbstglaube fordert und formt Subjekte, die als Eigentümer ihrer Illusionen auftreten, die "dazu stehen" und dies auch sagen.
Seinen Grundgedanken entwickelt der Autor durch scharfsinnige Analogien mit dem Spiel: Wie der Aberglaube ist auch das Spiel von einer konstitutiven Ambivalenz geprägt: Jeder wahre Spieler gerät in einen Bann, in welchem das Wissen, "es ist ja nur ein Spiel", das konträre Empfinden, "das ist mehr als ein Spiel ...", keineswegs aufhebt, sondern vielmehr verstärkt. Das Spiel zieht in seinen Bann, es hat Zwangscharakter, es ist "tyrannisch": Nicht erst die "Spielsucht", jedes Spielen hat suchtartige und rauschhafte Züge.
"Die Illusionen der anderen" ist in einem fast vergessenen Sinne philosophisch. Es knüpft an eine seit der Aufklärung abgedrängte Tradition der Philosophie an, die von den antiken Glückstheorien über Spinoza bis zu Alain im 20. Jahrhundert reicht. Erkenntniskritik (und gleichermaßen Ideologiekritik) ist hier nicht Ziel, sondern Weg: ein Instrument der Aufklärung über affektive Irrtümer. Pfaller macht eine Thematik wieder zugänglich und philosophiefähig, die nicht nur die Philosophie angeht: die Affekte und ihre Abwege, das gute Leben und seine Verhinderungen, das Glück und der rechte Gebrauch der Lüste.
Wie die antiken Glücksphilosophien sieht Pfaller die Aufgabe der Philosophie in der "Entwicklung von Theorien und Techniken, die Glück verschaffen, indem sie Einbildungen auflösen". Dieses Verständnis von Philosophie schließt politische Motive und Stellungnahmen nicht aus, sondern ein. Die Frage nach der Form der Ideologie ermöglicht es dabei auch, Fantasie für andere Gebrauchsweisen der Ideologie und der Illusionen zu entwickeln. Denn es gibt schließlich auch heilsame und lustvolle Formen der Illusionen. Etwa die Höflichkeit, eine praktizierte und wirkungsvolle Fiktion, die Pfaller als Glückstechnik würdigt: Man tut so, als ob - als ob man einander respektierte, kompetent und sympathisch fände -, und es hilft.