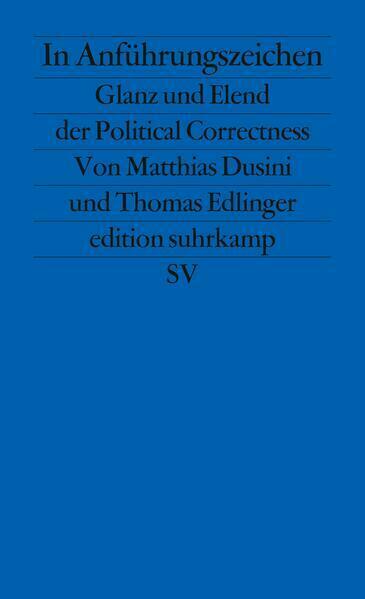Emanzipation für Fortgeschrittene
Matthias Dusini in FALTER 10/2017 vom 08.03.2017 (S. 30)
Akademische Begriffe und Fraktionskämpfe ließen den Feminismus wie ein Luxusproblem wirken. Kehrt die Bewegung nun zu ihren Ursprüngen zurück?
Die Häme war groß, als die schwedische Wirtschaftsministerin unlängst mit einer Handelsdelegation nach Teheran fuhr und dort ein Kopftuch trug. Bezeichnet sich ihr Kabinett nicht gerne als „feministische Regierung“, und ist das Kopftuch nicht ein Symbol religiöser Unterdrückung?
Dieses Beispiel zeigt, wie verquer aktuelle Kontroversen über Frauenrechte verlaufen. Konservative Männer entdecken ihre emanzipierte Seite und warnen vor dem mittelalterlichen Frauenbild des Islams, umgekehrt demonstrieren Aktivistinnen gegen das Kopftuchverbot: religiöse Gefühle seien in der Selbstbestimmung inkludiert. Und schließlich gibt es noch die Perspektive der schwedischen Politikerin, die sich lieber dem Gesetz des Gottesstaates beugte als einen männlichen Kollegen in den Iran zu schicken.
In der heroischen Zeit des Feminismus wies der feministische Kampf gegen die Ungerechtigkeit klare Frontlinien auf. Das Recht auf den eigenen Körper etwa, im Slogan „Mein Bauch gehört mir“ auf den Nenner gebracht, hatte einen identifizierbaren Gegner, den Patriarchen, der die Frau zum Sexualobjekt und zur Gebärmaschine degradierte.
Heute dagegen ist das große Thema, der ungerechte Unterschied, der zwischen Mann und Frau gemacht wird, in viele Nebenschauplätze zerfallen. Schwarze Frauen werfen weißen Feministinnen vor, deren an die Hautfarbe geknüpfte Privilegien auszublenden. Als sich etwa 2012 zwei weiße Aktivistinnen unter dem Schlagwort #Femfuture für eine stärkere Netzpräsenz schwarzer Frauen starkmachten, wurde das nicht etwa als Solidarität wahrgenommen. Auf Twitter ernteten sie Schimpf und Schande, etwa deshalb, weil die Anliegen indigener Frauen nicht explizit angesprochen worden seien. Auch sei der gemäßigte Tonfall weißer Feministinnen Ausdruck eines Überlegenheitsdenkens gegenüber der berechtigten Wut der „people of color“.
Solche „toxischen Twitter-Kriege“, wie sie die Publizistin Michelle Goldberg nannte, mögen die Ausnahme sein, aber sie weisen eine fatale Dynamik auf. Die vielen Kategorien und Unterkategorien von Benachteiligung, von der Hautfarbe über die sexuelle Orientierung bis zur körperlichen Ausstattung, lässt das gemeinsame Anliegen, den Kampf für die Menschenrechte, in den Hintergrund treten. Im aktivistischen #Hashtagfeminismus folgt einem oft nichtigen Anlass ein schriller, sich viral verbreitender Aufschrei, der dann rasch wieder verhallt.
Der Begriff „Feminismus“ umfasst so viele Aspekte, dass sich die Frage stellt, ob man nicht ein neues Wort für die betreffenden Sachverhalte erfinden müsste. So tritt eine Gruppe von Frauen als muslimische Feministinnen in Erscheinung, die sich auf entsprechende Äußerungen des Propheten Mohammed beruft. In einem tendenziell frauenfeindlichen Milieu einen solch fortschrittlichen Standpunkt zu vertreten nötigt Respekt ab. Nichtreligiösen Menschen erscheint die Kombination Schleier und Emanzipation indes als so widersinnig wie ein katholischer Pfarrer als Eheberater.
Auch die Begrifflichkeit des Feminismus trägt nicht dazu bei, dessen Inhalte verständlich zu machen. Das fängt beim Wort Gender an, das durch die Schriften der Philosophin Judith Butler Anfang der 1990er-Jahre ins Deutsche einwanderte. Ohne Grundkenntnisse postmoderner Theorie ist dieses Wort schwer zu begreifen, das Wörterbuch übersetzte es mit „sozialem Geschlecht“ im Gegensatz zum „biologischen Geschlecht“. Schwurbelalarm!
Wer diesen Deckel aufmacht, dem kommt gleich ein ganzer Schwarm kryptischer Behauptungen entgegen. Man erfährt, dass nicht nur das soziale, sondern auch das biologische Geschlecht etwas Konstruiertes sei und dass wir in einer von einer heteronormativen Sicht geprägten Welt leben. Hier schließt nun das ganze Vokabular der LGBT-Bewegung an: Intersexualität, Pansexualität, Bisexualität, Transgender. Dazu kommen noch die Stechmücken aus den antidiskriminatorischen Kämpfen, meist ohne Übersetzung durch deutschsprachige Diskurswolken fliegend: „slut shaming“, Intersektionalität, Transphobie, „tone policing“.
Auf bewundernswerte Weise versuchen akademische Zirkel, wissenschaftliche Erkenntnisse in die eigene Lebenspraxis einzubetten. Die Verabschiedung der allzu simplen Leitdifferenz Mann/Frau hat ein Verständnis für all jene hervorgebracht, die sich weder der einen noch der anderen Kategorie zugehörig fühlen.
Die Castingshows, Laufstege und TV-Serien sind voll von Divas mit Bart wie Conchita Wurst, Transgendermodels und Crossdressern. Man könnte darin ein Zeichen dafür sehen, dass die historischen Forderungen des Feminismus im Westen erfüllt sind. Frauen können Karrieren machen, verdienen etwa in New York mehr als Männer und stehen an der Spitze mächtiger Staaten. Im Feminismus für Fortgeschrittene kann man sich daher um Transgendertoiletten und den Genderstern *, die alle Geschlechtervarianten inkludierende Schreibweise, kümmern. Mit dem Siegeszug der Rechtspopulisten scheint der kurze Sommer des Genderfeminismus aber zu Ende zu gehen. Einer der ersten Maßnahmen des neuen US-Präsidenten Donald Trump war die Streichung von Geldmitteln für Organisationen, die Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen beraten. Außerdem drohte Trump damit, Abtreibungen zu kriminalisieren.
In den Reaktionen auf diesen Backlash zeichnet sich eine Rückbesinnung auf die alten Werte der Gleichheit und Schwesterlichkeit ab. Sogar Judith Butler, die Meisterin der Genderakrobatik, spricht wieder von Klassenunterschieden und wirft der unterlegenen demokratischen Kandidatin Hillary Clinton vor, sich zu viel mit Multikulturalismus beschäftigt zu haben: „Was bisher fehlte, ist eine genaue Analyse wirtschaftlicher Ungleichheit“, sagt Butler. Dem Beginn einer neuen feministischen Bewegung für Anfängerinnen und Anfänger steht nichts im Wege.
Verwirrung in der Fußgängerzone
Sebastian Fasthuber in FALTER 23/2012 vom 06.06.2012 (S. 34)
Die Political Correctness macht den Alltag nicht gerade leichter durchschaubar. Was bedeutet es, wenn eine Frau Schlampenoutfit trägt? Und was, wenn sie eine Burka anzieht? Womöglich dasselbe? Ein Vorabdruck
In der westlichen Gesellschaft herrscht nicht nur das Recht, sondern nachgerade die Pflicht, über seinen Körper zu bestimmen. Der propagierte Individualismus zieht einen Lebensstil nach sich, der sich immer auch als Bild ausdrücken muss. Zum Beispiel auch den Lebensstil der "Autonomen", die das höchste Ziel linksradikaler Dissidenz bereits im Namen tragen. Die Autonomen vermummen sich wie die Musliminnen, und auch ihnen droht man mit dem Vermummungsverbot.
Was im schwarzen Block aber im Gegensatz zu den Burkaträgerinnen unbestritten bleibt, ist die Freiwilligkeit der Verhüllung - eben die Autonomie der Autonomen. So liegt der Verdacht nah, dass das Verschwinden des individuellen Looks im schwarzen Block der Burkaträgerinnen auch ein Abweichlertum vom vorherrschenden Verständnis des Individualismus signalisieren könnte. Dann würde der Skandal der Verhüllung in einer verweigerten Selbstbestimmtheit liegen, von der man nicht weiß, in welchem Ausmaß diese selbst wiederum autonom ist. Die Ausradierung des individualistischen Befehls "Express yourself!" ist eine Kränkung der narzisstischen Gesellschaft, in der man sich zwar auch beherrschen, aber eben zugleich ausdrücken können soll - und muss.
Empowerment oder Pornografisierung?
Sich beherrschen und sich ausdrücken: Darum geht es auch in den seit 2011 weltweit stattfindenden Slutwalks. Anlass für diese Demos im und pro "Schlampenoutfit" war die Äußerung eines Polizeibeamten in Toronto, der vor den Studierenden der York-University meinte: "Mir wurde gesagt, ich sollte das nicht sagen. Wie auch immer: Frauen sollten es vermeiden, sich wie Schlampen anzuziehen, um nicht zum Opfer zu werden."
Auf diese Empfehlung hin formierte sich erwartungsgemäß Protest. Man warf dem Polizisten vor, Vergewaltigungsopfer mitverantwortlich für die ihnen angetane Gewalt zu machen. Der Polizist entschuldigte sich zerknirscht für seinen Fauxpas. Offizielle Stellen der Polizei beeilten sich zu versichern, dass eine etwaige Rechtfertigung von Vergewaltigung durch "aufreizende" Kleidung in klarem Widerspruch zu ihrer Ausbildungsdoktrin stünde, die die Schuld ohne jeden Zweifel beim männlichen Täter verorte.
Doch die Lawine der Empörung war bereits losgetreten. Der erste Slutwalk fand am 3. April 2011 in Toronto mit dem erklärten Ziel statt, jeden Anflug einer Täter-Opfer-Umkehr zu bekämpfen und für das Recht auf Souveränität in erotischen Begegnungen zu demonstrieren. Der Aufmarsch mit viel nackter Haut wurde von den Medien dankbar aufgenommen und erwies sich als Exportschlager. Mittlerweile gibt es mehr und mehr lokale Ableger weltweit - und eine innerfeministische Diskussion darüber, ob die Aneignung des pejorativen Slut-Begriffs der Sache der Frauen diene oder der Pornografisierung des weiblichen Körpers Vorschub leiste.
Kehren wir noch einmal zum Stein des Anstoßes zurück. Was hat der Polizist gesagt und gemeint? Die vorausgeschickte Formulierung, wonach es wohl besser wäre, das Folgende nicht zu sagen, lässt vermuten, dass er schon ahnte, dass seine Warnung als politisch nicht korrekt verstanden werden würde. Trotzdem sprach er sie aus, wohl aus pragmatischen, gutgemeinten Gründen, einer Empfehlung vergleichbar, bei Nacht bestimmte Gegenden zu meiden.
Trotzdem wurde dieser Ratschlag von den Slutwalk-Initiatorinnen nicht als solcher verstanden, sondern als Griff in die sexistische Mottenkiste. Erster Vorwurf: Der Sager wärme die alte Mär von der Täter-Opfer-Schuldumkehr auf. Dass diese hier erzählt worden sei, ist freilich selbst eine interpretatorische Konstruktion, die aus dem Ratschlag zur Vergewaltigungsprävention darauf schließt, implizit würde damit auch die Ansicht gutgeheißen, dass sich Frauen mitschuldig machten, wenn sie nicht vorsichtig seien. Aber der Polizist hatte zu dieser vor allem juristisch relevanten Verharmlosungsmethode weder etwas gesagt, noch wäre seine Aussage in seiner exekutiven Funktion maßgeblich. Zweiter Vorwurf: Die Äußerung sei faktisch falsch. Sie trage dazu bei, einen Zusammenhang von Kleidungsstil und der Wahrscheinlichkeit einer Vergewaltigung zu suggerieren, der schon oft widerlegt worden sei.
Wunderwaffe des Gendernahkampfs
Was wäre nun aber, wenn es diesen Zusammenhang doch gäbe? In diesem Fall würde der dritte, in Bezug auf die Slutwalks wirksamste Vorwurf allein ins Zentrum rücken. Er lautet: Selbst wenn es empirisch nicht ratsam wäre, sich schlampenartig zu kleiden, muss man die Einschränkung der modischen Selbstbestimmtheit - und der damit verbundenen Souveränität bei der Zustimmung zu und Ablehnung von Sex - vehement zurückweisen. Die Transparente der Slutwalk-TeilnehmerInnen sprechen eine klare Sprache. Sie sagen: Ich bin vielleicht gar keine Schlampe, sondern tue nur so als ob und solidarisiere mich so mit jeder Frau, die für sich entscheidet, in BH und High Heels durch die Stadt zu laufen.
Mit der Wunderwaffe des Gendernahkampfs, der Performancekunst, im Handtäschchen lässt sich behaupten: Mögen BHs und High Heels auch zu Recht als sexualisierte Modeteile gelten, so berechtigt das dennoch keinen Betrachter zu einer Reaktion, die mir unangenehm sein könnte - wobei ich als "Slut"-Performerin bestimme, wo Belästigung beginnt: zum Beispiel beim Hinterherpfeifen. "It's my hot body - I do what I want" heißt es kurz und bündig auf einem Transparent.
Diese Argumentation ist zugleich unanfechtbar und narzisstisch. Entsprechend findet sich das Beharren auf uneingeschränkter Selbstachtung in allen multikulturellen Revierkämpfen wieder, wo die absoluten Setzungen einzelner Gruppismen permanent gegeneinander ausverhandelt werden müssen. Es geht dann zum Beispiel um die Forderung nach dem Verzicht auf eine "schlampenmäßige" Kleidung vor einer Kirche oder einer Moschee, die als unzumutbare Reglementierung der persönlichen Autonomie empfunden werden könnte. Die Slut-Provokateurinnen müssten ihre Meinung, wonach die Art der Kleidung niemanden etwas angehe, gegen jene durchsetzen, die den Schlampenlook als Provokation religiöser Gefühle empfinden. Ein Lichtbandschriftzug der Künstlerin Jenny Holzer antwortet auf "I do what I want", diesen absoluten Imperativ des Begehrens, mit dem Satz: "Protect me from what I want."
Der Wille zum totalen Selbst
Gewiss soll mein Körper mir gehören. Aber ebenso gewiss ist, dass der kulturalisierte, symbolische Körper für und zu anderen spricht. Würde der vergleichende, nach Interpretation suchende Blick der anderen auf das eigene Performen in der Öffentlichkeit nicht mitkalkuliert, hätten Mode und Selbstausdruck gar keinen Reiz. Und hoffte man nicht auf den Effekt der Provokation, wäre ja auch das Insistieren auf den Schlampenlook bloß Karneval und nicht das, was angestrebt ist - nämlich die subversive Umdeutung eines diffamierten, modischen Zeichensystems im Dienste sexueller Autonomie.
Die fürsprecherische Maskerade des Slutwalks spekuliert bewusst auf die Ausreizung sexistischer Klischees des für den männlichen Blick zurechtgemachten Sexobjekts, um die Grenzen der Souveränität zu verschieben. Der Anspruch auf Souveränität mündet in einem absoluten Autonomieanspruch, der als Konsequenz die Legitimität der Deutung von Kleidung als Entwürdigung, Beschämung, Verletzung der Gefühle anderer bestreitet. "I do what I want": Das ist einerseits der berechtigte Einspruch gegen patriarchale Machtstrukturen, andererseits aber das Mantra einer Erziehung, die das totale Selbst zum obersten Prinzip erklärt.
Ich mache, was ich will: Ist das nicht auch das Credo der Frauen, die in der Fußgängerzone lieber Burkas statt bauchfreier Tops tragen? In diesem Konformismus der Stigmatisierten liegt auch ein Moment des Nonkonformismus, der sich in einer Strategie des Entzugs, in einem Akt des Unlesbarmachens äußert. Viele Feministinnen und Liberale verstehen Burka- und Kopftuchträgerinnen als Opfer männlicher Unterdrückung, als Ausgeschlossene und wollen sie befreien. Doch scheint die Botschaft nicht anzukommen - auch nicht im aufkeimenden "islamischen Feminismus", der laut der US-amerikanischen Imamin Amina Wadud ausgerechnet den Koran als Grundlagentext für eine Gleichstellung von Frau und Mann heranzieht.
Der autoritäre Ruf der Antiautoritären
Die Gründe für die mangelnde Emanzipation der Sitten liegen also nicht nur in der patriarchalen Repression weiblicher Selbstbestimmtheit, sondern auch darin, dass die seit 9/11 sich radikalisierende Islamkritik selbst dazu beigetragen hat, dass auf einem sichtbaren "islamischen" Lebensstil beharrt wird. Das vermutet jedenfalls der Berliner Filmemacher Neco Çelik, einer der über 30 Autoren und Autorinnen mit überwiegend muslimisch-türkischem Hintergrund, die zu dem als Antwort auf Sarrazins Thesen konzipierten "Manifest der Vielen. Deutschland erfindet sich neu" beigetragen haben. In einem Radiointerview im Februar 2011 beschreibt er, wie Menschen auf der Straße die ihnen zugeschriebene, religiöse Zwangsrolle vom Feindbild zum selbstbewussten Selbstbild umcodieren und möglicherweise auch ironisch überaffirmieren: "Durch die perverse Islamophobie werden Menschen zu Muslimen, denen Religion früher völlig egal war."
Was aber tut man, wenn dem Angebot zum Sturm auf die Bastille der Parallelgesellschaft kaum Folge geleistet wird, auch dann nicht, wenn der tyrannische Ehemann gerade in der Moschee weilt und das Ergreifen der solidarischen Hand nicht verhindert?
Eine der Konsequenzen daraus, dass das gefühlte Opfer zurückgewiesen wird, ist der autoritäre Ruf der Antiautoritären nach einem Vermummungsverbot, um so den Ausgang aus der angeblich fremdverschuldeten Unmündigkeit auszuleuchten. Dass die Autonomie von Frauen mit Migrationshintergrund aber auch darin liegen könnte, sich den äußerlichen Selbstbestimmungsvorgaben, die letztlich auf den Zwang zur Verwestlichung hinauslaufen, zu verweigern oder sie, etwa in Form der Applikation von Accessoires und der modischen Ausdifferenzierung der Verhüllung, zu hybridisieren, erscheint undenkbar. Es könnte ja auch sein, dass die Burkawalks ebenso Rollenspiele mit variierender Rollendistanz darstellen wie die Slutwalks.
Projektionsflächen für Ressentiments
Die queeren, weiblichen und Transgender-Sluts betreiben offensive Rollenspiele auf karnevalistischen Demos, die die Genderbandbreite als kollektive Option in einer Uniform der Dissidenz ausloten. Im Bezug auf die männlichen Reaktionen auf die Maskeraden der sexuellen Provokation wird die spielerische Uneindeutigkeit der Referenz auf die reale Akteurin, aber auch auf Kosten ihrer eigenen Handlungs- und Sprechoptionen zurückgenommen. Nein heißt nein - und niemals und unter keinen Umständen: vielleicht.
Diese Option ist in diesem Diskurs nicht mehr opportun und steht beiden Seiten nicht mehr zur Verfügung, selbst dann nicht, wenn das Vielleicht von der Sprecherin selbst angestrebt wird. Die Burkaträgerinnen hingegen vollführen auf der Bühne des Alltags, ob freiwillig oder nicht, defensive Rollenspiele, die die Möglichkeiten der Abweichung von einer Uniform als individuelle Notwendigkeit testen.
Das Provokationspotenzial beider Selbstdarstellungsformen ist unbestritten. Sowohl die Entblößung als auch die Verhüllung, die Slut und die Burkaträgerin, sind Projektionsflächen von kulturalistischen und sexistischen Ressentiments. Müsste man ein Objekt benennen, das zu beiden Praktiken eine Verbindung herstellen könnte, dann wäre das wohl der Burkini: ein Stück Stoff, das schützt und zugleich enthüllt, das begehrliche Blicke anzieht und sie gleichzeitig zurückweist.