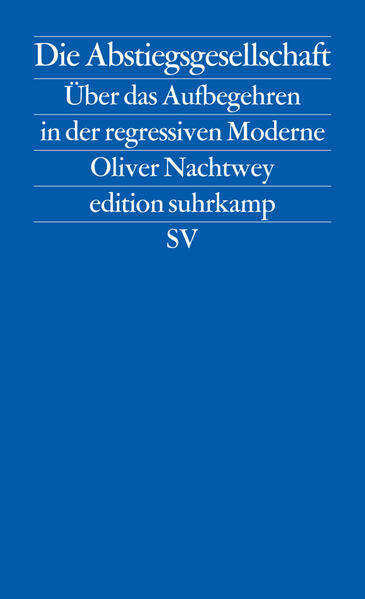Generation Abstiegsgesellschaft
Barbaba Tóth in FALTER 9/2020 vom 26.02.2020 (S. 23)
Zur spät zur Party? Bücher, die Generationendilemmata beschreiben, sind in Mode. Der Soziologe Oliver Nachtwey fasste 2017 in seinem glänzend geschriebenen „Die Abstiegsgesellschaft“ das Lebensgefühl der in den 1970er- und 80er-Jahren Geborenen mit wissenschaftlichem Blick zusammen.
Ludwig, der Lagerarbeiter
Barbaba Tóth in FALTER 17/2018 vom 25.04.2018 (S. 10)
Warten wir doch auf sein Team! Dem neuen Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig allein traut man neuen Schwung für Wien offenbar nicht zu. Warum nicht?
Montag vergangener Woche, Café Mozart am Wiener Albertinaplatz. Die Eröffnung der Schanigartensaison gehört zum kleinen Einmaleins für einen Wiener Bürgermeister. Oder: Baldbürgermeister. Dieses Jahr trinkt Michael Ludwig mit dem Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck einen Kaffee und lässt sich dabei fotografieren. Wenn, wie an diesem Tag, das Wetter schön ist, kann da nicht viel schiefgehen. Dass Nochbürgermeister Michael Häupl kurzfristig abgesagt hat, kümmert niemanden. Oder doch? In der Wiener SPÖ werden sie sich nachher fragen, ob Häupl damit etwas sagen wollte. Und wenn ja, was?
Auf Michael Häupl kann der designierte Bürgermeister Michael Ludwig in seiner Termingestaltung aber ohnehin keine Rücksicht mehr nehmen. Am Wochenende zuvor hat er die Eröffnung einer Outdoor-Installation am Schwarzenbergplatz besucht, dann waren da noch das Goldene Verdienstzeichen für Toni Polster und der Startschuss beim Vienna City Marathon. Diese Woche gibt es einen Fototermin in der Ottakringer Brauerei, wo das Bier für das Donauinselfest gebraut wird. Dazwischen ständige Termine mit SPÖ-Funktionären, und das Wohnbauressort muss er ja auch noch leiten.
Michael Ludwig ist dieser Tage überall und wird es auch in Zukunft sein. Das ist Teil seiner Strategie. Ein leutseliger Bürgermeister zum Anfassen, quasi omnipräsent, immer auf Achse. Aber trotzdem weiß keiner, wohin er genau will. „Warten wir einmal auf sein Team!“, „Das wird stark von den Menschen an seiner Seite abhängen“, „Das werden wir sehen, wenn er seine neuen Stadträte präsentiert“ sind die Antworten, die man bekommt, wenn man unter Wiens Sozialdemokraten nachfragt: „Für welche Art von SPÖ steht eigentlich dieser Mann?“
Ludwig selbst ist offenbar noch nicht Programm genug, was in Zeiten, in denen Parteien sich bevorzugt über ihren Spitzenkandidaten und dessen Charisma verkaufen, schon ziemlich herausfordernd ist. Kein Wahlabend, bei dem nicht vom „Kurz-Effekt“ die Rede ist. Auf den „Ludwig-Effekt“ hoffen die Wiener Genossinnen und Genossen erst gar nicht. Und wenn, dann nur auf einen, der nach innen wirkt. Als Mediator und Verbinder einer Partei, in der sich in fast einem Vierteljahrhundert unter Ludwigs Vorgänger Michael Häupl einiges an Brüchen, Konflikten und Animositäten aufgestaut hat.
Aber die Frage „Für welche Art von SPÖ steht eigentlich Michael Ludwig?“ geht weiter. Wie positioniert sich eine moderne, urbane Sozialdemokratie in Zeiten großer Verunsicherung? Was ist ihre Antwort auf den Rechtspopulismus, der in Österreich gleich mit doppeltem Gesicht auftritt, in höflicher Form bei der ÖVP, in klassischer bei der FPÖ? Der Politologe Fritz Plasser und der Wahlforscher Franz Sommer beschreiben in ihrem aktuellen Buch „Wahlen im Schatten der Flüchtlingskrise“ minutiös, wie sehr sich seit der großen Fluchtbewegung im Jahr 2015 die politische Debatte gedreht hat. Im September 2013 hatten nur 34 Prozent der Wahlberechtigten den Eindruck, „dass sich Österreich in eine falsche Richtung entwickelt“, im Jänner 2016 waren das bereits 63 Prozent. Als Ursache nannte fast die Hälfte davon die vielen Flüchtlinge, die 2015 ins Land gekommen waren.
Egal ob es um Probleme am Arbeitsmarkt, in den Schulen oder im Sozialstaat geht, allesamt klassische sozialdemokratische Themen, allesamt logische Herausforderungen für eine Millionenstadt wie Wien, sie wurden seit der Flüchtlingskrise nur noch als Migrations- und Integrationsprobleme – und damit im Sinne der Rechtspopulisten – diskutiert. In Michael Ludwigs Amtszeit als Wiener SPÖ-Chef und Bürgermeister wird also wohl oder übel auch eine der drängendsten Fragen der Sozialdemokratien Europas überhaupt beantwortet werden: Wie geht sozialdemokratische Politik im Schatten der Flüchtlingskrise, und, noch wichtiger: Wie gewinnt man damit am Ende auch Wahlen?
Wien wählt – geplantermaßen – im Oktober 2020. Die Ausgangslage für Ludwig könnte schlimmer sein. Die letzte veröffentlichte Wahlumfrage stammt aus dem Jänner 2018 und kommt von Unique Research für die Gratistageszeitung Heute. Sie sieht die SPÖ bei 34 Prozent, die ÖVP bei 22, die FPÖ bei 20, die Grünen und die Neos bei je acht Prozent und die Liste Pilz bei sechs Prozent. „Der ÖVP gelingt es, sicherheitsorientierte Wähler von der FPÖ zu sich zu holen“, erklärt der Unique-Meinungsforscher Peter Hajek. „Es kommt also zu einem Wähleraustausch, der den Abstand zwischen SPÖ und FPÖ vergrößert.“ Die SPÖ würde dann zwar gegenüber 2015 mehr als fünf Prozentpunkte verlieren. Allerdings sah Unique vor einem Jahr die FPÖ in Wien-Umfragen bei satten 37 Prozent, die SPÖ bei 31, die ÖVP überhaupt nur bei zehn Prozent. Mit anderen Worten: Ludwig profitiert vom Kurz-Effekt. Er sichert ihm den für die alteingesessene und stolze Stadtpartei psychologisch wichtigen ersten Platz. Aber es ist nur ein geborgter erster Platz, keiner, der aus eigener Kraft errungen wurde.
Aus Sicht Ludwigs gibt es noch einen zweiten Kurz-Effekt, der für ihn vielleicht gefährlich werden kann. Michael Häupl hat mehr als einen Wahlkampf in Wien damit gewonnen, das Duell gegen Heinz-Christian Strache auszurufen. Das rote Wien, das letzte gallische Dorf im schwarz-blauen Österreich, das linke, antifaschistische Werte hochhält, die Menschenrechte respektiert, diese Geschichte hat am Wahltag tadellos funktioniert. Bis 2015. Niemand kann abschätzen, ob sie es auch heute noch tun würde und erst recht in zwei Jahren, wenn die türkis-blaue Bundesregierung weiterhin die Mittel für Schulen und soziale Einrichtungen der einzigen Metropole des Landes kürzt – und gleichzeitig die Binnenzuwanderung von Neo-Österreichern nach Wien fördert. Wie die türkis-blaue Doppelmühle funktioniert, ließ sich vergangene Woche bestens beobachten. Es gibt in Wien 276 Volksschulen, 13 Hauptschulen, 128 Neue Mittelschulen, 35 Sonderschulen, 13 Polys und 94 Gymnasien. Laut Stadtschulrat Wien werden sie derzeit von 25 Schulpsychologen und 27 Schulsozialarbeitern betreut. In den letzten beiden Jahren gab es Unterstützung von zusätzlich 150 Sprachförderlehrern, 43 Sozialarbeitern, 125 Personen für begleitende integrative Maßnahmen sowie sechs mobilen interkulturellen Teams. Sie alle wurden aus dem Integrationstopf des Bundes bezahlt, sie alle will ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann jetzt streichen. Einzig die 43 Sozialarbeiter dürfen bis 2019 weitermachen. Gleichzeitig schlägt die Wiener ÖVP Alarm: Immer mehr Gewalt an Wiens Schulen! „Aushungern und laut schreien, das ist eine beliebte Strategie“, kommentiert das der grüne Bildungsexperte Daniel Landau.
Aber natürlich gibt es Gewalt an Wiens Schulen, es gibt Brennpunktschulen, in denen fast jedes Kind einen sogenannten „Migrationshintergrund“ hat, genauso wie es die perspektivlosen afghanischen Jugendlichen in der Venediger Au am Praterstern gibt und islamistische Parallelwelten in Wiens Moscheen und Kulturvereinen. Noch bis 2015 hätte zum Beispiel der Präsident des Wiener Stadtschulrates solche „unangenehmen“ Themen von sich aus nicht angesprochen, und anfragenden Journalisten wurde gern beschieden: Was nicht sein darf, ist auch nicht. Nichts durfte an Wiens Image als bestregierter Multikulti-Millionenstadt kratzen. Volk? Nation? Identität? Migration? Religion? Um alles, was Rechte zum Thema machen, wurde lieber ein Bogen gemacht, und wenn man die Probleme doch ansprach, dann nur im sozioökonomischen Kontext, nur ja nicht im ethnischen oder kulturellen, denn das ist ja rassistisch. „Regressive Left“ nennen britische Parteiforscher diese Haltung innerhalb des linken Spektrums: regressive, zurückgebliebene Linke.
Die Konflikte, die in der Wiener SPÖ im Schatten der Flüchtlingskrise aufbrachen und als deren Ergebnis letztlich Ludwig auf dem Landesparteitag am 27. Jänner 2018 als Sieger hervorging, kamen oft als plumper Krieg zwischen Anhängern einer rot-blauen Koalition – mit Ludwig als Statthalter – und jenen einer rot-grünen Koalition – mit seinem Rivalen Andreas Schieder als Symbolfigur – rüber. Aber sie sind vielschichtiger. Es geht um Interessenkonflikte zwischen strukturschwachen Flächenbezirken und privilegierten Innengürtelgrätzeln, um das Verhältnis der oppositionellen Bundespartei zu ihrer mächtigsten Landesorganisation, wie immer auch um Frauen- gegen Männerseilschaften, um Cliquenrivalitäten und am Ende natürlich auch um die große Frage, ob und wie wir uns den „Schatten“ der Flüchtlingskrise stellen.
Gewinnt man einen Wähler mehr, wenn man ein Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen und Alkoholverbot rund um den Praterstern ausspricht, wie es Ludwig und seine engste Vertraute, die neue SPÖ-Landesgeschäftsführerin Barbara Novak, zuletzt getan haben? Oder geht es eher darum, mit solchen Ansagen nicht noch einen Wähler mehr zu verlieren? Und wie genau geht man rechte Themen als linke Stadtpartei an, wenn man beides will? Wie wird man zur progressiven Linken? Fragen über Fragen, die in der Wiener SPÖ derzeit aber noch nicht offen diskutiert werden.
Stattdessen geht es jetzt einmal um das Miteinander, das Brückenbauen und das Heilen. Und um die Sehnsucht nach Einheit und Zusammenhalt. Der 1. Mai ist ein Lostag, Trauma und Traum zugleich für Ludwig. Er will alles nur kein Pfeifkonzert wie anno 2016, als die Genossinnen und Genossen auf dem Rathausplatz den damaligen Parteichef Werner Faymann ausbuhten. „Die Nervosität ist groß, der Druck auf die Bezirksorganisationen auch“, erzählt eine Funktionärin, die, wie so viele, in dieser sensiblen Transformationszeit von Häupl auf Ludwig nicht mit vollem Namen zitiert werden möchte. „Mit Mehrheit gegen Minderheit, mit Ordnung und Disziplin lässt sich heute keine moderne Stadtpartei und schon gar nicht eine superdiverse Stadtgesellschaft regieren“, warnt ein anderer, hochrangiger Funktionär. „Der neue Parteivorsitzende wird viel für den Zusammenhalt tun müssen, wenn er jene Brücken bauen will, die er bei seiner Kandidatur versprochen hat.“
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher kann nach eigenem Bekunden jedenfalls „sehr gut“ mit Ludwig und der Wiener Landesparteisekretärin Barbara Novak. Die gemeinsame Positionierung gegen die türkis-blaue Regierung steht zwei Jahre vor den Wien-Wahlen nicht infrage. Darüber hinaus sind ohnehin beide mit sich selbst beschäftigt: Lercher will die Bundespartei intern reformieren und nach außen die Oppositionsrolle schärfen. Und Ludwig muss in der Wiener Landespartei vor allem Frieden stiften.
Dort gärt es seit Jahren. Michael Häupl hat es nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze der Landespartei nicht geschafft, seine Nachfolge vorzubereiten. Spätestens seit der letzten Gemeinderatswahl ist die Wiener SPÖ zerrissen. Da gibt es die Fraktion um Doris Bures und Christian Deutsch und Ex-Bundesgeschäftsführer Gerhard Schmid, die seit der Ablöse von Werner Faymann durch Christian Kern im Schmollwinkel gestanden ist und sich früh für Michael Ludwig deklarierte.
Da gibt es die großen Flächenbezirke, die bei den letzten Stadtratspostenvergaben personell nicht zum Zug gekommen sind. Es gibt Gewinner und Verlierer. Als Verlierer fühlen sich viele der Delegierten, die auf dem Parteitag für Andreas Schieder und gegen Michael Ludwig gestimmt haben, immerhin mehr als 40 Prozent. Wenn man mit den Unterstützern von Andreas Schieder spricht, hört man rasch eine trotzige Verbissenheit heraus. Von Ludwig sei noch nichts gekommen. Statt des versprochenen Brückenschlags würde er versuchen, die Gräben mit einem Personalpaket, bei dem alle Seiten zum Zug kommen, zuzuschütten.
Ludwig versuchte ansatzweise, ein Fundament zu errichten. Er ließ Tiefeninterviews mit Dutzenden Parteimitgliedern führen, traf sich mit den Bezirksvorstehern zum Austausch und veranstaltete eine Klausur auf dem Kahlenberg. Obwohl viele Teilnehmer von einer guten, kritischen Auseinandersetzung und spannenden Projektideen berichten, ist das Ergebnis sehr bodenständig ausgefallen. Supergreißler zur Aufwertung von infrastrukturschwachen Grätzeln, eine Mehrzweckhalle – Letztere ein Wunschprojekt der Wiener Wirtschaftskammer, Sparte Tourismus – und eine Sommerbühne an der Donau wirken wie Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden.
Ludwig hat zwar nach seiner Kür zum Wiener SPÖ-Chef Gespräche mit den derzeit amtierenden Stadträten geführt. Es waren – so hört man – aber bloß Plaudereien in freundschaftlicher Atmosphäre, keine inhaltlichen Auseinandersetzungen, geschweige denn konkrete Ansagen über die zukünftige Zusammensetzung der Stadtregierung.
In den Wochen seit dem Parteitag haben Andreas Mailath-Pokorny und Sandra Frauenberger ihren Rückzug bekanntgegeben. Integrationsstadträtin Frauenberger hat 2017 die Gesundheitsagenden von der zu Siemens abgewanderten Sonja Wehsely geerbt – und damit das Fiasko rund um die Errichtung des Krankenhauses Nord.
Schon bald nach Ludwigs Wahl zum Parteivorsitzenden begann eine Kampagne im Boulevard gegen Frauenberger, die darin gipfelte, dass die Kronen Zeitung eine Wahrsagerin ein Foto von Sandra Frauenberger deuten ließ. Auch Brauner wurde über Wochen hinweg für ihren Besuch beim Viennese Opera Ball in New York gescholten. Tägliche Berichterstattung mit Bildern von Brauner in Abendkleidern vermittelten den Eindruck, die Finanzstadträtin würde nichts anderes tun, als das Tanzbein zu schwingen.
Die deklarierten Feministinnen Brauner und Frauenberger waren unter Bürgermeister Michael Häupl ein Machtfaktor in der Stadt. Brauner hat als Vorsitzende der SPÖ-Frauen in Wien zahlreiche Karrieren mitgestaltet und sich damit auch Rückhalt in der Stadt verschafft. Frauenberger kommt aus der Gewerkschaft der Privatangestellten, galt zumindest bis vor kurzem als logische Nachfolgerin Brauners an der Spitze der SPÖ-Frauen. Beide haben ihre politische Heimat im Bezirk Margareten, beide unterstützten Ludwigs Mitbewerber Andreas Schieder. Und beide sind für sehr anspruchsvolle Ressorts zuständig, die Ludwig jetzt neu besetzen wird. Mit Frauen? Aus dem linken Flügel? Aus innerstädtischen Bezirken?
Während Dutzende Mitarbeiter in den Stadtratsbüros auf Klarheit warten, sondiert der engste Kreis um Michael Ludwig mögliche Kandidaten für die maximal fünf zu vergebenden Ressorts: Kultur, Frauen, Finanzen, Gesundheit und Wohnbau. Die Aufgabe ist kompliziert: Das Team der neuen Stadtregierung soll zumindest personell die verschiedenen Fraktionen in der Wiener SPÖ einen. Linker Flügel, rechter Flügel, Gewerkschaft, Flächenbezirke, Frauen, Männer und noch viele mehr wollen zufrieden gestellt werden. Mitte Mai soll die neue Regierungsmannschaft präsentiert werden. Bis jetzt erfährt man auf der Rathaus-Gerüchtebörse noch von keinen Zusagen. Der heiß umworbene Josef Ostermayer will nicht in die Politik zurückkehren: Als Generaldirektor der gemeinnützigen Sozialbau AG verdient er besser und spart sich den permanenten öffentlichen Druck. Inhaltlich ist er in diesem Bereich als langjähriger Mitarbeiter der Mietervereinigung, Geschäftsführer des Wohnfonds Wien und Kabinettschef Faymanns im Wohnbauressort ohnehin zu Hause. Wien-Holding-Chef Peter Hanke gilt als Kandidat für das Finanzressort, soll sich aber noch zieren.
Auch Pamela Rendi-Wagner, angeblich Wunschkandidatin als Gesundheitsstadträtin, hat noch nicht zugesagt. Sie wäre aus mehreren Gründen eine Optimalbesetzung: Sie ist fachlich versiert, eine Frau, hat hohe Beliebtheitswerte und ist dem weltoffenen, eher linken Lager zuzurechnen. Dafür hat sie in Wien keine politische Machtbasis, und die Sanierung des Krankenanstaltenverbundes und die Baustelle Krankenhaus Nord machen den Job nicht allzu erstrebenswert.
Definierte man den Ludwig-Effekt nach seiner Anziehungskraft für Quereinsteiger jenseits des Wiener Kader- und Apparatschikmilieus, er sähe derzeit schwach aus. Aber vielleicht sitzt die wichtigste Person im Team Ludwig ohnehin schon in der Stadtregierung: Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, 16 Jahre jünger als Ludwig und eine der größten Zukunftshoffnungen der Wiener Partei. Ludwig wäre dann ein Übergangsparteichef, einer, der die Partei aufräumt, den Hof kehrt und ordentlich übergibt. Nicht glamourös, aber wichtig. Ein echter politischer Lagerarbeiter eben.
Es gibt noch eine Pflichtübung der politischen Wiener Populärkultur, die heuer anders ausfällt als gedacht. Besser gesagt: entfällt. Die traditionelle Sommereröffnung der Alten Donau des Bürgermeisters mit dem Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten – immer nebeneinander in einem kleinen Elektroboot sitzend – findet nicht statt. Es konnte einfach kein gemeinsamer Fototermin mehr gefunden werden.
„Der Tipping Point ist erreicht“
Barbaba Tóth in FALTER 40/2017 vom 04.10.2017 (S. 20)
Oliver Nachtwey hat mit dem Buch über die „Abstiegsgesellschaft“ die Gegenwartserzählung für die Generation X vorgelegt. Aus seiner Sicht hat sich der Neoliberalismus überholt
Oliver Nachtwey hat in seinem Bestseller „Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne“ das Lebensgefühl der in den 1970er- und 1980er-Jahren Geborenen zusammengefasst. Sie mühen sich ab, können aber nicht den Wohlstand aufbauen, den die Elterngeneration noch schuf. Richtig rebellisch macht sie das aber auch nicht. Nachtwey ist selber in Kind dieser Zeit, was er in seinem blendend geschriebenen Buch als Soziologe beschreibt, kennt er zum Teil aus seinem eigenen Umfeld. Ein Gespräch über den langen Schatten des Neoliberalismus, neue soziale Bewegungen und den österreichischen Wahlkampf.
Falter: Herr Nachtwey, mit dem Slogan „Holen Sie sich, was Ihnen zusteht“ startete die SPÖ in den Nationalratswahlkampf und erntete viel Kritik dafür. Haben wir verlernt, klassenkämpferisch zu denken?
Oliver Nachtwey: Auch ich habe mich über den Slogan gewundert. Ich habe schon verstanden, was die Absicht war. Jeremy Corbyn hatte den genialen Claim „For the many, not the few“, und das war dann die österreichische Übersetzung. Er soll wohl Verteilung, Gerechtigkeit ansprechen, aber man kann ihn semantisch auch so interpretieren, dass er an den Besitzindividualismus appelliert. Das steht mir zu! Ich hau jetzt mal auf den Tisch! Aber Gerechtigkeit ist immer eine Frage von kollektiven Aushandlungen. Gruppen agieren miteinander, es geht um Kompromissfindung. Der Slogan ist gut gemeint, aber sicher nicht optimal.
Die SPÖ hat lange auch damit geliebäugelt, das Thema Sicherheit zum Hauptthema ihres Wahlkampfes zu machen. Wäre das ein Fehler gewesen?
Nachtwey: Ich denke ja. Die Sozialdemokratien stehen in Konkurrenz zum Rechtspopulismus. In Österreich ist das nicht nur die FPÖ, sondern auch die Liste Sebastian Kurz. Der ist ja eine Figur, die man sich nicht ausdenken kann.
Wie meinen Sie das?
Nachtwey: Er ist wie aus einem Thomas-Mann-Roman entsprungen. Als 30-Jähriger mischt er die Politik mit viel Chuzpe und wenig Substanz auf. Es ist mir noch nicht klar, wie das funktioniert. Aber zurück zum Thema: Es gibt diese große Verunsicherung im Mittelstand. Ökonomisch aber auch in Fragen der politischen Repräsentation. Wer sind wir? Was ist unser Status? Wer repräsentiert uns? Wo sind unsere Zukunftsperspektiven? Hat unser Beruf noch Zukunft? Unsere Vorstellung von Familie? Dass es uns einmal besser geht, haben viele schon abgeschrieben. Die alten Formen der politischen Repräsentation wirken auf viele nicht mehr passend.
Und die Sozialdemokratie zerreibt es?
Nachtwey: Die Sozialdemokratie ist häufig wie ein Flipperball, der von der Dynamik in den gesellschaftlichen Verhältnissen und den Magnetismen von einer in die andere Richtung geworfen wird. SPD-Kandidat Martin Schulz hat anfangs auf das Thema soziale Gerechtigkeit gesetzt, schoss wie eine Rakete in den Himmel und fiel kurze Zeit später wie ein Stein zu Boden. Corbyn wurde am Anfang belächelt, aber er war kohärent in seinen Forderungen nach dem Ausbau des Sozialstaates, mehr Chancen für die Jugend, Umverteilung, klarer Linie beim Flüchtlingsthema. Wenn die Sozialdemokratie das Thema Gerechtigkeit nicht durchzieht, wirkt sie nicht mehr glaubwürdig.
In Ihrem Buch „Die Abstiegsgesellschaft“ schließen Sie mit einem hoffnungsvollen Gedanken: es werde neue, solidarische Bewegungen geben. Das Buch erschien 2016, sind Sie immer noch so optimistisch?
Nachtwey: Für mich als Beobachter ist interessant, wie schnell sich die Entwicklung vollzogen hat. Ich habe 2014 begonnen, an diesem Buch zu schreiben. Damals gab es die Occupy-Bewegung und den arabischen Frühling. Beides war neu. Soziale Fragen wurden mit Demokratiefragen verbunden, sehr viele Prekäre engagierten sich. Dann kamen mehr und mehr die Wutbürger auf, und mit ihnen ein gewisser kleiner Autoritarismus, eine Verachtung demokratischer Verfahren, getragen von einer technischen Intelligenz.
Sie geben den Akteuren dieser technischen Intelligenz den schönen Namen „Expertenbürger“.
Nachtwey: Der Expertenbürger ist ein Protesttypus, der viel mit der Mentalität des Ingenieurs zu tun hat und dem Glauben an technische Lösungen, die Politik überflüssig machen könnten. Er ist ungeduldig und hat ein generelles Misstrauen gegenüber politischen Prozessen. Bei den Wutbürgern können ursprünglich progressive Anliegen regressive Züge annehmen. Bei Pegida, die sich als „patriotische Europäer“ bezeichnet haben, hatte man anfangs sogar einen starken Bezug zum Schutz von Frauen. Absurd, wie sich weiße, konservative ältere Männer plötzlich für Frauenrechte einsetzen, wenn es darum geht, sie vor Fremden zu schützen.
Nach Ihrem Buch groß geworden sind Figuren wie Donald Trump oder Emmanuel Macron, Politiker, die sich jenseits von links und rechts geben. Wie ordnen Sie diese Phänomene ein?
Nachtwey: Ich sehe zwei Entwicklungen. Zum einen sind die neuen solidarischen Bewegungen tragischerweise schnell verpufft. Occupy etwa. Auch, weil sie sich ohne klassische, linke Repräsentationsverfahren konstituieren wollten. Ohne Organisationen, ohne Sprecherinnen. Als Occupy New York ein Auto geschenkt bekam, stellte sie das vor ein unlösbares Problem. Wie anmelden, wenn wir nicht einmal ein Verein sind? Wer kontrolliert die Autoschlüssel? Wer zahlt für Benzin? Ähnlich ging es Occupy Frankfurt. Der verständliche, antiinstitutionelle Impuls hat das Weiterbestehen dieser Bewegungen verhindert, auch wenn einiges davon in den USA in der Bernie-Sanders-Bewegung aufging.
Zum anderen?
Nachtwey: Durch die Flüchtlingsbewegung entstanden neue rechtspopulistische Bewegungen. Die Globalisierung hat nationalstaatliche Ideen zunichte gemacht, die Linke hat keine neue, solidarische Antwort darauf, was wiederum den Identitären Raum für ihre Themen gibt. In Deutschland hatten wir jetzt lange das Gefühl, eine riesige rechte Welle geht durchs Land. Gleichzeitig gibt es eine riesige soziale Bewegung, die aber nicht als solche gezählt wird: die Willkommenskulturbewegung. Zehntausende engagieren sich, nicht unter einem Dach, sondern vor Ort, in Cafés, in Anlaufstellen, zu Hause. Das war ein anderes, leises, aber genauso mächtiges Aufbegehren.
Aber die Willkommenskulturbewegung blieb politisch ohne Antwort?
Nachtwey: Die Linke in Deutschland hat es aufgenommen, aber sie hatte damit zu kämpfen, dass ein Teil ihrer Wähler selbst große soziale Ängste hatte. Natürlich ist das auch ambivalent, weil die Flüchtlingsbewegung von einem eher bürgerlichen, christlichen – nicht im religiösen Sinne – Milieu
getragen wurde, das es sich auch leisten kann. Der ungelernte Leiharbeiter war da nicht dabei. Eventuell kann man die Wahlbewegung für Alexander Van der Bellen als eine Ausformung dieses unsichtbaren Willkommenskultur-Netzwerkes ansehen. Jedenfalls hat sich die Gesellschaft wieder sehr stark politisiert.
Warum reden wir bei sozialpolitischen Themen nach wie vor so oft über Flüchtlinge und nicht über Verteilungsgerechtigkeit?
Nachtwey: Beides ist Teil eines globalen Umbruchs. Migrationsströme gehören zur Globalisierung dazu. Es gibt massive Abstiegsängste, aber keiner der politischen Akteure hat das offen thematisiert. Auch die Sozialdemokratie hat nach Ende des regulierten Kapitalismus der 1950er- und 1960er-Jahre der Liberalisierung das Wort geredet. Der Sozialstaat hat sich verändert. Er ist kein wachsender Kuchen, an dem alle teilhaben können, sondern er schrumpft und ist kostbares Gut. Flüchtlinge werden aus der Sicht der Leute, die jetzt die Rechtspopulisten wählen, zu unproduktiven Mitessern, die von außen kommen. Deswegen gibt es einen Zusammenhang zwischen den Flüchtlingen und der sozialen Frage. Wer die soziale Frage nicht angeht, muss damit rechnen, dass sich die Debatte weiter in Richtung Flüchtlinge und Wohlfahrtsstaatschauvinismus verschiebt.
Kennen Sie persönlich das Gefühl des sicheren Wachstums, das von der Angst vorm Abstieg abgelöst wird?
Nachtwey: Mein Großvater väterlicherseits war noch Arbeiter in einer Fahrradfabrik im Ruhrgebiet. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er eine kleine Werkstatt aufgemacht. Dort, wo ich aufwuchs, sah ich im Haus gegenüber auf seine Werkstatt, im Erdgeschoß unseres Hauses befand sich die Konditorei meiner Großeltern mütterlicherseits. Mein Vater hatte kein Abitur. Er machte eine Lehre als Fernsehelektriker. Mein Großvater war noch CDU-Ratsherr in seinem Dorf, also konservativ. Mein Vater gründete noch die Junge Union und trat gleichzeitig der Gewerkschaft bei, weil er seine Lehre als zu monoton empfand. Er wollte nicht nur Fernseher schleppen, sondern auch etwas lernen. Er machte dann an der Abendschule die Matura nach, studierte und war am Ende seiner Laufbahn Geschäftsführer eines mittelgroßen Elektrounternehmens. Er erlebte einen sozialen Aufstieg, so wie seine ganze Generation. Er führ am Anfang eine Ente, am Ende einen Audi A6.
Und Ihre Mutter?
Nachtwey: Meine Mutter war zuerst die Alleinverdienerin. Sie arbeitete in einer Sparkasse an der Kassa, damit mein Vater studieren konnte. Sie lebten also nicht das männliche Ernährermodell. Sie sagte immer zu mir: Papa macht Strom, ich mach Geld, das brauchen alle Menschen. Da haben wir uns sicher gefühlt.
Sie sind also ein typisches Produkt der deutschen Nachkriegsordnung. Wie kam es, dass Sie sich mit der Abstiegsgesellschaft befassten?
Nachtwey: Es gab verschiedene Stränge, die sich zu einem Bild verdichteten. Viele Befunde aus meiner arbeitssoziologischen Forschung konnte ich auch im sozialen Nahbereich wiedererkennen. Auf den Festen meiner Eltern, bei denen sich die ganzen Aufsteiger aus der Generation meines Vaters trafen, die jetzt alle im Wohlstand leben, beobachtete ich, wie sich die Themen verändert haben. Früher protzte man so ein wenig herum, was man nicht alles materiell oder kulturell erreicht hatte. Man ging in die Oper, es wurde zum Statussymbol. Reisen, Anschaffungen, solche Sachen. Plötzlich fingen sie an, sich anders über die Kinder zu unterhalten. Es schlich sich so eine Sorge ein. Nach dem Internat, Studium und den Praktika im Ausland kam dann nicht mehr automatisch der tolle Job. Dann kamen erste Kündigungen in meinem Bekanntenkreis dazu.
Vermutlich ein gut gebildeter Freundeskreis?
Nachtwey: Ich wollte lange Zeit Journalist werden. Freunde von mir arbeiten beim Stern und beim Spiegel. Schon vor der Finanzmarktkrise begann diese Umbruchwelle. Später existierten Magazine wie die Brigitte ohne angestellte Redakteure. Aber als ich begann, die regressive Moderne zu erforschen, war das eher ein Zufall. Ich hatte meine Doktorarbeit über die deutsche und britische Sozialdemokratie geschrieben, es ging nicht um Parteien-, sondern um Sozialgeschichte. Dann bin ich in die Arbeitssoziologie gegangen und habe mit Leiharbeitern begonnen zu sprechen. Das war soziologisch hochinteressant, persönlich wirklich schwierig. Wenn man mit Menschen spricht, die die gleiche Arbeit nebeneinander ausüben und bis zu 50 Prozent weniger verdienen. Oder Fälle von Arbeitern, die outgesourct wurden und dann zu schlechteren Konditionen wieder eingestellt werden. Diese Hilflosigkeit, die Brutalität im Umgang mit ihnen, die kleinen Demütigungen im Betrieb – das war für mich ein Moment der Erkenntnis. Hier geht es nicht um geringe Einkommen und soziale Unsicherheit alleine, sondern um Statusverlust, um mangelnde Anerkennung und Würde. Es entstanden eine neue Klassifikation von Arbeit und ein neues gesellschaftliches Zukunftsbild: Man verlor den Optimismus, dass es den eigenen Kindern einmal besser gehen werde. Und dann habe ich mich viel mit Modernisierungstheorie beschäftigt.
Sie kommen aus dem Marxismus?
Nachtwey: Das merkt man mir an, ja. Ich fand aber, er hatte immer gewisse Schwächen. Seine Prämisse war, dass die Verhältnisse sich verschlechtern würden. Er konnte nicht einfangen, warum es durchaus auch eine Steigerung der Lebensqualität in der sozialen Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Der britische Soziologe T. H. Marshall beschreibt diese Evolution an zivilen, politischen und sozialen Bürgerrechten – in meinen Augen – sehr gut, aber auch er glaubte im Grunde an eine fortschreitende Gleichberechtigung, wenn auch mit Abstrichen. Aber meine Erfahrung mit den Leiharbeitern passte da gar nicht dazu, da hakte die Theorie der Modernisierung gewaltig und der Marxismus war hier wieder überzeugender. Als ich eine Studie zur Occupy-Bewegung machte, mit mehr als 1000 Befragten, zeigte sich, dass ein Großteil der Teilnehmer prekär beschäftigt und überqualifiziert war. Das ist etwas wirklich Neues. Sie waren postkapitalistisch orientiert, aber keine Aufsteiger im engeren Sinne mehr. Anders als die Träger der neuen sozialen Bewegung in den 1970er-Jahren, weil damals war es noch die neue Mittelklasse, die die Ökologie- und Friedensbewegung ausmachte. All das fasste ich dann unter dem Begriff „regressive Moderne“ und „Abstiegsgesellschaft“ zusammen.
Jetzt reden alle vom kommenden Aufschwung. Ist die Phase der regressiven Moderne damit vorbei?
Nachtwey: Als Ulrich Beck sein Buch „Risikogesellschaft“ 1986 geschrieben hat, meinte er, die Klassen spielen keine Rolle mehr, weil die Gesellschaft sich wie in einem Fahrstuhl allesamt nach oben bewegt. Seine These hielt noch fünf Jahre. Er war einfach viel zu drastisch. Manchmal entstehen soziologische Arbeiten nicht inmitten, sondern am Ende einer Epoche. Ich würde mich freuen, wenn auch mein Buch das Ende einer Epoche markiert. Wir also das Ende der Abstiegsgesellschaft erleben und das Pendel zurückschwingt.
Glauben Sie daran?
Nachtwey: Jein. Es gibt mehrere Dimensionen. Der Aufschwung ist schon da. Aber wer profitiert davon? In der Politik hat so eine Art Publikumsbeschimpfung stattgefunden. „Uns geht’s doch gut!“, „Wir wachsen doch!“, hören wir. Aber spüren das die Menschen bei den Mieten? In ihrer Geldbörse? Das hinterlässt ein seltsames Gefühl, fast verhöhnend. Die Unternehmensgewinne sind da, aber wo landet der Wohlstandsgewinn? Er landet relativ wenig beim unteren Einkommensdrittel. Von 1992 bis 2011 sind die Durchschnittseinkommen in Deutschland gesunken. Wir spüren Anzeichen von Deflation, die Löhne sind zu niedrig, die Zinsen bei null. Der Kapitalismus ist in einer Art Eigenblutdoping angekommen. Es wird Geld ins System hineingepumpt. Die Vermögenspreisinflation ist enorm. Wir sehen das an den Börsen. Die Hauspreise explodieren. Gleichzeitig ist die Debatte sehr ahistorisch. In der sozialen Moderne hatten wir Wachstumsraten über zwei Dekaden von vier Prozent. Jetzt reden wir vom Aufschwung bei 1,9 Prozent. Also Hochkonjunktur ist das keine. Als ich VWL studiert habe, war die Kennzahl drei Prozent Wachstum, um einen Stellenaufbau von Vollzeitbeschäftigten zu sichern. Das ist die Ambivalenz unserer Situation. Ja, wir haben einen leichten Aufschwung, es werden wieder Beschäftigungsverhältnisse aufgebaut, aber wenn man genau hinschaut, sind viele Teilzeitjobs dabei. Meistens Frauen, auch viele Leiharbeiter in sehr autoritären Verhältnissen. Der Aufschwung ist deshalb prekär, er ist nicht nachhaltig. Das gehört mitreflektiert, sonst wird die Politik als sehr, sehr unehrlich empfunden. Das Beunruhigendste ist: Mit der Nullzinspolitik hat man das letzte Mittel zur Bekämpfung einer neuen Finanzkrise aus der Hand gegeben. Wir verschießen gerade unser ganzes Pulver. Wenn eine große Krise aus den USA oder China kommt, ich weiß nicht, was dann passiert.
Wie nachhaltig sind die neoliberalen Formatierungen in unserer Gesellschaft, die die letzten beiden Jahrzehnte stark geprägt haben?
Nachtwey: Die neuen Jobs, die jetzt entstehen, stammen aus dieser neoliberalen Epoche: meist flexibel, auf Zuruf, ohne große Absicherung. Ich beschäftige mich gerade viel mit der digitalen Ökonomie und der Start-up-Kultur. Der religiöse Charakter der digitalen Ökonomie aus dem Silicon Valley ist beeindruckend. Er ist die Vorlage für so vieles in der Gegenwart. Emmanuel Macron sagte, er will die französische Nation wie ein Start-up führen. Er hat sich ein Placet geben lassen, dass er den Arbeitsmarkt liberalisieren darf, ohne die Gesetze dem Parlament vorzulegen. Ihr Sebastian Kurz schwimmt auch auf der Start-up-Modewelle. Helplink, Uber etc – diese neuen Unternehmen basieren alle auf Kontingenzarbeitskraft. Man ist nur noch lose mit der Firma verkoppelt. Das ist die ökonomische Zukunft. Eine klassische Mitgliedschaft in einem Betrieb mit Sozial- und Krankenversicherung gibt es dann nicht mehr. Natürlich gibt es Menschen, die mit diesem Phänomen sehr gut umgehen können. Es gibt in Deutschland ein Buch „Wir nennen es Arbeit“, das diese Ich-AGs heroisiert. Diese neuen Formen entstehen übrigens nicht, indem man die alten Formen abschafft, etwa Kollektivverträge, weil das würde zu große Proteste der Gewerkschaften hervorrufen. Nein, man umgeht sie, man baut völlig neue Strukturen parallel dazu auf, wie Bypässe. Bosch und Siemens steigen bereits ein. F & E wird zum Start-up-Modell aufgebaut. IBM hat zertifizierte Programmierer eingeführt, die für sie programmieren dürfen, sich aber um jeden Auftrag bewerben müssen.
Warum werden Start-ups und ihre Kultur trotzdem so gehypt?
Nachtwey: Wir alle lieben unser iPhone. Auch ich. Das ist ja das Problem mit dem Neoliberalismus. Er kommt ungemein schick daher und sieht gut aus. Er ist diabolisch genial gestrickt. Liberalisierung an sich hat schon so eine Doppeldeutigkeit. Deshalb gibt es auch keinen Weg zurück in die soziale Moderne. Bis 1968 war Homosexualität in Deutschland verboten, bis 1977 konnten Männer für die Frau den Arbeitsvertrag kündigen. Das kann man sich kaum vorstellen. Der Neoliberalismus ermöglicht eine gewisse Mündigkeit und Autonomie, die am Freiheitswunsch der 68er anknüpft. Wenn man sich schließlich auf den Neoliberalismus einlässt, bekommt man zuerst diese Goodies, es ist wie bei einem Tauschgeschäft. Gleichzeitig zahlt man den Preis, dass man viel abhängiger vom Markt wird
Das heißt, die 68er, die viele noch immer verehren, haben kräftig ihren Beitrag zum Sieg des Neoliberalismus geleistet?
Nachtwey: Ich verehre die leider gar nicht mehr. Jürgen Habermas hat 1961 eine Studie über deutsche Studenten gemacht, in der er zum Schluss kam, dass sie recht autoritär sind und deshalb nicht revoltieren würden. Wenige Jahre später sah das dann ganz anders aus. Aber wenn man sich die deutschen Alt-68er anschaut, hat Habermas am Ende vielleicht doch recht behalten. Sie nahmen an der Revolte als künftige Elite teil. Wir sitzen übrigens in Daniel Cohn-Bendits altem Stammcafé hier in Frankfurt. Aber sie sind im Grunde sehr maskuline, autoritäre Persönlichkeiten. Im Alter bleibt offenbar das Autoritäre mehr übrig. Deswegen bin ich skeptisch.
Was konkret haben sie für den Neoliberalismus geleistet?
Nachtwey: Wir unterscheiden verschiedene Kritikformen: die Sozialkritik und die Künstlerkritik. Bei den 68ern fiel beides zusammen, und das machte sie so stark. Die künstlerische Forderung nach Autonomie traf auf die soziale Forderung nach Gerechtigkeit. Und der Neoliberalismus sagte: Wir können das Autoritäre nicht restaurieren. Wenn wir den Feind nicht besiegen können, umarmen wir ihn und nehmen ihm seinen Partner weg. Peu à peu schieben wir die Sozialkritik weg. Deshalb sind wir heute sehr energisch, wenn es um unsere Autonomie geht, aber weniger engagiert, wenn es um die soziale Frage geht. Autonomie kann immer individuell verhandelt werden, die soziale Frage nur schwer. Sie braucht das kollektive Handeln. Auch wenn die SPÖ auf ihren Plakaten es uns jetzt gerade anders erzählt.
Jetzt wächst bereits die dritte Generation nach 68 mit diesen Prinzipien auf. Ist es unumkehrbar?
Nachtwey: Ich würde sagen, dass der Tipping Point erreicht ist. Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit dem Neoliberalismus. Damals war das eine echte Nischendebatte von ein paar neomarxistischen Politikökonomen. Inzwischen ist die Gesellschaft sensibilisiert. Die Millenials wollen sich zum Beispiel nicht mehr dem Markt vollständig aussetzen. Viele Arbeitsmarktexperten beklagen, dass diese Generation sich nicht mehr so ausbeuten lassen und selbstoptimieren will, ihre Work-Life-Balance hochhält und zuerst nach Sabbaticals und nicht nach Überstunden fragt. Die Situation ist offen. Es sieht nicht danach aus, als hätten wir eine neue starke Linke, die die Gesellschaft in mehr Gerechtigkeit trägt. Aber es dreht sich auch nicht alles klar in Richtung Rechtspopulismus.
Erhebt euch!
Barbaba Tóth in FALTER 32/2017 vom 09.08.2017 (S. 10)
Egoistisch? Neoliberal? Geschmacklos? Weit gefehlt. Die neue Wahlkampagne der SPÖ führt die Partei rechtzeitig zum Kern ihrer eigentlichen Politik zurück
Fangfrischer Fisch aus dem Millstätter See, leichte Abendbrise, Blick auf das waldige Südufer. Für Kanzler Christian Kern gibt es vermutlich keinen besseren Ort, um eine seiner anstrengendsten Arbeitswochen dieses Jahres ausklingen zu lassen, als auf der Terrasse der alteingesessenen Seevilla in Millstatt in Kärnten, unweit seines Feriendomizils. Nur auf den ersten Blick ungewöhnlich war, mit wem Christian Kern vergangenen Freitagabend anstieß. Er speiste mit seinem Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner.
An diesem Abend schloss sich für alle Teilnehmer nach vier Monaten ein Kreis. An dessen Anfang im Mai dieses Jahres stand Mitterlehners Rückzug aus der Politik, nachdem ihn sein Nachfolger, Außenminister Sebastian Kurz, aus dem Amt gemobbt hatte; an dessen Ende steht der Wahlkämpfer Kern, der nach einer Phase des Driftens, der Intrigen im Kampagnenteam erstmals eine Art Grundton für die Nationalratswahl am 15. Oktober anschlägt. Gerade noch rechtzeitig, denn in Umfragen liegt Kern derzeit bis zu zehn Prozentpunkte hinter Kurz.
„Holen Sie sich, was Ihnen zusteht“, steht etwas holprig auf den vergangenen Freitag präsentierten Plakaten, auf denen Kern einen mit beschwörendem Blick anschaut und mit dem Zeigefinger auf einen zeigt. In den sozialen Netzwerken greift Kern zum vertraulicheren Du. Der Aufschwung ist da, aber die Menschen spüren ihn nicht, das und vor allem das soll die zentrale rote Wahlkampferzählung in den zehn Wochen bis zum Wahltag sein. Nicht Flüchtlinge, nicht Sicherheit, nicht Law and Order, kurzum: keine rot-blauen Themen, sondern ein genuin rotes. Die SPÖ sei die Partei, die dafür sorgt, dass Wohlstand in Zukunft fairer verteilt wird. Mit einem steuerfreien Mindestlohn von 1500 Euro und einer Erbschafts- und Schenkungssteuer ab einer Million Euro zur Sicherung der Pflegefinanzierung etwa.
Die Entscheidung für diese Linie wurde vom Wahlkampfverantwortlichen Georg Niedermühlbichler in Fokusgruppen sorgfältig abgetestet. Sie treffe einen Nerv, versichert die rote Parteizentrale. Von der Presse bis zu den Vorarlberger Nachrichten lautete das Urteil hingegen überraschend einhellig: Pfui, die SPÖ setzt im Wahlkampf auf eine Neiddebatte.
Aber ist das wirklich so? Oder haben wir im letzten Jahrzehnt der Wirtschaftskrisen und neoliberalen Hegemonie einfach verlernt, für unsere Ansprüche einzustehen, ja sie uns überhaupt zuzugestehen? Träfe Letzteres zu, hätte das „Hol dir, was dir zusteht“ nichts mit schnödem Neid zu tun, sondern mit schöner Gerechtigkeit. Der Soziologe Oliver Nachtwey hat für die Zeit, in der wir gerade leben, den knackigen Begriff der „regressiven Moderne“ geprägt. Anders als in den Jahren der „sozialen Moderne“, als Sozialdemokraten wie Bruno Kreisky, Olof Palme und Willy Brandt regierten und das Versprechen des sozialen Aufstiegs durch Bildung und Leistung noch greifbar war, befinden wir uns jetzt in einer Phase allumfassender Prekarisierung.
„Abstiegsgesellschaft“ tauft das Nachtwey brutal. Prekär fühlen sich nicht nur jene am unteren Einkommensende, die immer schon von Monat zu Monat sparen mussten, sondern auch die gesellschaftliche Mitte. Wer nicht geerbt hat, muss erleben, dass der gesellschaftliche Aufstieg binnen einer Generation, wie ihn die eigenen Eltern in den 1970er-Jahren noch hinbekamen, nahezu unrealistisch geworden ist. Als Normalverdiener eine Eigentumswohnung finanzieren? Den Kindern eine private Ausbildung schenken, weil die Bildungsabschlüsse des öffentlichen Systems am globalen Markt immer mehr an Wert verlieren? Schwierig. Selbst gut ausgebildete, bürgerlich lebende Menschen erleben, wie Freunde ihre Jobs verlieren. Die Einschläge kommen näher.
Aber statt aufzubegehren, arbeiten die meisten, vor allem in der aufstiegsorientierten Mittelschicht, auch noch an der Aufrechterhaltung des schiefen Status quo mit. Verantwortlich dafür ist die nach eineinhalb Jahrzehnten Wirtschaftskrise durch und durch neoliberale Grundformatierung unserer Gesellschaften, die sich etwa so zusammenfassen lässt: Jeder ist für sich selbst verantwortlich, wer es nicht schafft, hat sich eben zu wenig angestrengt. Wir sind alle wie kleine Ich-AGs. Gemeinsam für etwas kämpfen? Das ist doch so etwas von 1990!
Die neue „Bewegung“ von ÖVP-Chef Kurz ist die politische Entsprechung dieser Denke. Sie gibt sogar vor, sich wie ein Start-up zu finanzieren und ihren politischen Marktwert über Sponsoren selbst zu generieren. So gesehen macht der neue SPÖ-Slogan „Hol dir, was dir zusteht“ sogar doppelten Sinn, weil er am „neoliberalen Konzept eines isolierten Individuums“ ansetzt, wie es der Ökonom Walter Ötsch im Standard vor kurzem beschrieb, und dieses für ein größeres Ganzes – in diesem Fall für die SPÖ als traditionelle Partei des Klassenkampfes – aktivieren will.
Zum richtigen Zeitpunkt kommt die SPÖ mit ihrer Forderung und der sie umgebenden Erzählung vom Aufschwung, der nicht nur den Begüterten zukommen darf, jedenfalls. Europas Wirtschaft wächst stabil. Über das Jahr hinweg halten Experten vom Internationalen Währungsfonds (IWF) sogar 1,9 Prozent für möglich. Österreich meldete fürs zweite Quartal 2017 solide 0,8 Prozent Wachstum. Aber die Löhne ziehen nicht mit. Die jährliche Lohnzuwachsrate lag im ersten Quartal 2017 bei 1,2 Prozent – „deutlich“ unter dem seit 1999 gemessenen Durchschnitt von 2,1 Prozent, berechnete die Europäische Zentralbank. Selbst EZB-Präsident Mario Draghi mahnt regelmäßig höhere Gehälter ein.
An der Irritation, die die neue SPÖ-Kampagne in der veröffentlichten Meinung der Qualitätspresse auslöste, lässt sich auch ablesen, wie sehr selbst kritische Beobachter der Gesellschaft die neoliberale Sicht auf die Dinge verinnerlicht haben. Klassenkampf ist offenbar nur mehr etwas, das in die Sphären der Gewerkschaften verräumt gehört. Politik wird zum Marktplatz spontan organisierter Interessen. Dem Einzelnen bleibt die Selbstoptimierung. Einer Partei, noch dazu der österreichischen Sozialdemokratie, zuzugestehen, dass sie zur Abwechslung mal klassenkämpft, gilt in dieser Logik als hoffnungslos altmodisch und befremdend.
Kern „befeuert den Neid“, kritisierten die Salzburger Nachrichten. Die Kampagne sei eine „offene Einladung zur Neiddebatte“, konstatierte die Presse. Ein „Geiz-ist-geil-Slogan“, die Vorarlberger Nachrichten. Der Rest war professioneller Ennui angesichts des mageren Unterhaltungswerts der Kern’schen Kampagne. Zu viel Inhalt (über 200 Seiten Wahlkampfprogramm!), zu wenig Emotionen, nicht einmal ein echter „Eat the rich“-Slogan, wo bleibt da meine Schlagzeile?
Kern kokettiert ganz bewusst mit der Retroanmutung seiner Kampagne. Er sei „stolz darauf, eine Partei zu sein, keine Liste oder Bewegung“, rief er vergangenen Donnerstag im Kongresszentrum der Messe Wien der versammelten roten Funktionärselite zu. Und ja, die anderen, die „wollen nur über Flüchtlinge reden“, nicht über Arbeitsplätze, Ausbildung oder Pflege. Er aber nicht. Die Genossinnen und Genossen applaudierten erleichtert. Jetzt müsste Kern den neuen Grundton nur noch durchhalten.
In der Abstiegsgesellschaft
Barbaba Tóth in FALTER 46/2016 vom 16.11.2016 (S. 21)
Der deutsche Soziologe Oliver Nachtwey versucht in diesem Buch, die große Gegenwartserzählung vorzulegen: Was macht unsere Gesellschaft heute aus? Es geht ihm vor allem um Deutschland, aber viele Beobachtungen sind deswegen auf Österreich – und andere europäische Länder – problemlos übertragbar. Viel ist derzeit von der Überheblichkeit der Eliten die Rede, die nicht verstehen wollen, warum der „White Trash“ rechte Populisten wählt. Nachtwey hält sich nicht mit Befindlichkeitsanalysen auf, sondern zerlegt klug und stringent die sozioökonomischen Zusammenhänge der „Abstiegsgesellschaft“: Postdemokratie, neue Unterschicht, prekäre Arbeitsverhältnisse, stagnierender Kapitalismus, Selbstausbeutung und Neoliberalismus.