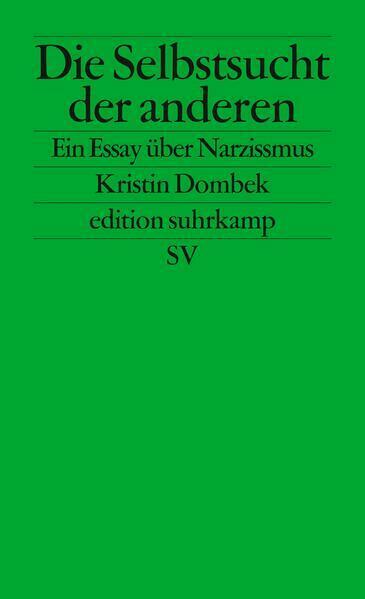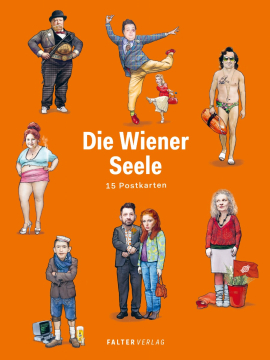Der König der Kälte
Matthias Dusini in FALTER 3/2017 vom 18.01.2017 (S. 25)
Der neue US-Präsident gilt als Lehrbuchbeispiel für einen bösartigen Narzissmus. Warum finden viele seinen Größenwahn so attraktiv?
Am 20. Jänner wird Donald Trump der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wahl des Immobilienunternehmers und Fernsehstars zum mächtigsten Mann der Welt macht vielen Angst. Manche ziehen sogar Parallelen zur Zwischenkriegszeit, als Schreihälse wie Benito Mussolini ihre Länder auf fatale Weise „wieder groß“ machen wollten. „Make America great again“ war der Slogan von Trumps Wahlkampfkampagne.
Um die Gefährlichkeit des kommenden US-Präsidenten zu beschreiben, äußern Kritiker den Faschismusverdacht. Oder sie stellen die Narzissmusdiagnose. Personen mit krankhaftem Geltungsdrang suchen häufig einen Psychoanalytiker auf, nun sitzt ein Egoshooter an den Schalthebeln der Macht und spielt Apokalypse. „Wenn wir Atomwaffen haben, warum setzen wir sie nicht ein?“, kokettierte Trump letzten Sommer.
Mit Narzissmus bezeichnete Sigmund Freud eine Phase in der kindlichen Entwicklung, in der das Subjekt in Allmachtsfantasien verfällt. Wenn die Eltern dem Geltungsdrang nicht durch eine Mischung aus Zärtlichkeit und Mäßigung entgegensteuern, kann dem Kleinen das später zum Verhängnis werden. Der bösartige Narzisst ist jener Mensch, der unfähig ist, dauerhafte Bindungen zu seinen Mitmenschen einzugehen, weil er sie nie gekannt hat.
Süchtig nach Anerkennung, arbeitet der Narzisst mit allen Tricks, um den Applaus seiner Umgebung zu bekommen. „Maligne“ Narzissten geben sich oft verführerisch, heucheln Verletzlichkeit, um die Zuneigung anderer zu gewinnen, ehe sie ihnen die kalte Schulter zeigen. Das Gefühl, der Mittelpunkt der Welt zu sein, kann sich zum paranoiden Dauerzustand auswachsen.
Der Narzisst teilt die Welt in Gut und Böse und seine Umgebung in Fans und Feinde, jene Differenzierungen verweigernd, die die Wahrnehmung eines reifen Menschen auszeichnen. In seinem Leben gibt es nur Belohnungen, keine Durststrecken. Entweder du bist ein King oder ein Loser, lautete die Maxime von Donalds Vater, die Anleitung für die Egoexpansion des neuen US-Präsidenten.
Der spricht von sich selbst in der dritten Person, bezeichnet sich als „wonderful“ und „great“. Donald Trump prahlt mit seiner Schwanzlänge und verunglimpft seine Gegner als Idioten und Abschaum. Der Name Trump steht auf Unterwäsche und einem Tower, sein Träger nennt als Lieblingsbuch seine 1987 veröffentlichte Autobiografie „The Art of the Deal“.
Erinnern Trumps Grimassen nicht an einen Dreijährigen, dem der Nachbarbub die Schaufel klaute? Seine Haare wirken so, als würde sich Donaldinho weigern, zum Friseur zu gehen, zum ersten Einschnitt in präpubertäre Wachstumsfantasien. Frauen sind für ihn ein unbekannter Kontinent, den es durch primitive Waffen zu erobern gilt. Er lehnt die Naturwissenschaften etwa im Falle des Klimawandels ab, symptomatisch für einen Siebzigjährigen, der in einer Märchenwelt lebt.
Wenn auf der Trump-Rally die Rolling-Stones-Nummer „You Can’t Always Get What You Want“ lief, war das ein Täuschungsmanöver. Der Narzisst bekommt immer, was er will. Psychotherapeuten nennen das die Unfähigkeit, erwachsen zu werden.
Abweichendes Verhalten
Seit den späten 80er-Jahren, als Trump zum Liebling der Klatschpresse aufstieg, galt er als Lehrbuchbeispiel eines Narzissten. Sein Name taucht in wissenschaftlichen Publikationen wie „Abweichendes Verhalten im 21. Jahrhundert“ oder „Persönlichkeitsstörungen und ältere Erwachsene“ auf. Der Psychologe George Simon setzt Videoclips mit Trump in seinen Lehrveranstaltungen ein: „Ich müsste sonst mit Schauspielern arbeiten. Es gibt kein besseres Beispiel als ihn.“
Und so jemand wird US-Präsident?
„Trump gibt uns das Gefühl, wieder wir selbst zu sein“, kommentierte einer seiner Anhänger den überraschenden Sieg Trumps über die demokratische Kandidatin Hillary Clinton. In den USA, dem Mutterland der Religion des Selbst, lässt sich Narzissmus nicht auf eine Verhaltensauffälligkeit reduzieren. Der in der religiösen Rhetorik des Reformchristentums verwurzelte Urschrei lautet: Du schaffst es!
Ein robustes Aufbegehren gegen das staatliche Über-Ich stellt jenen Aufwärtsschub bereit, der dem spirituellen Leistungssportler das erfolgreiche Überwinden von Barrieren in Aussicht stellt. Henry David Thoreau lieferte in dem 1854 erschienenen Buch „Walden“ den Blueprint für zahllose weitere Versuche, durch Alleingänge den Durchbruch zum wahren Selbst zu schaffen. Er sei in den Wald gezogen, erklärt der Ich-Erzähler, weil er den Wunsch verspürte, „dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten“.
Trumps Erweckungserlebnis fand nicht in der freien Wildbahn statt, sondern im Herzen des Kapitalismus. In seiner Heimatstadt New York fand er eine geistige Schule für Extratouren ohne plagende Gewissensprüfung. Als Kind besuchte er die Marble
Collegiate Church in Manhattan, in der die Lehren von Reverend Norman Vincent Peale (1898–1993) gepredigt wurden.
Peale lehrte, dass es gottgefällig sei, Geschäftstüchtigkeit zu beweisen. Während es eine lange christliche Tradition gibt, Ehrgeiz als Sünde zu verdammen, wurde er von Peale als eine Art Gottesdienst interpretiert. In dem Bestseller „Die Kraft des positiven Denkens“ (1952) übersetzte er die kapitalistische Religion in eine Verhaltenslehre narzisstischer Kälte.
Was Psychologen als Ausdruck von Größenwahn deuten, verkauft Trump als authentische Verkörperung eines amerikanischen Ideals. „Wir verehren jene, die für hochgesteckte Ziele große Risiken auf sich nehmen, selbst wenn sie an ihnen scheitern“, versucht Trump-Biograf Michael D’Antonio dessen Erfolg zu erklären. „Und wir tolerieren im Hinblick auf Wohlstand, Gesundheit und Lebenserwartung große Unterschiede, solange uns das die – und sei es auch nur minimale – Chance erhält, selbst zu den Gewinnern zu gehören.“
Das in den 1980er-Jahren entstandene Genre des Reality-TV sollte, lange vor den Echokammern des Internet, Trumps Übungsgelände für narzisstische Höhenflüge werden. Hier konnte er den Kampf um Anerkennung, die ideale Sportart für Menschen mit unersättlichem Aufmerksamkeitsbedürfnis, in die Währung Prominenz konvertieren. 2004 stieg er in die von dem britischen TV-Produzenten Mark Burnett entwickelte NBC-Serie „The
Apprentice“ (Der Lehrling) ein, die in einer leerstehenden Etage des Trump-Tower gedreht wird. Zwei Mannschaften treten an, um sich für einen Job im Trump-Konzern zu bewerben. Die Kandidaten müssen bestimmte Aufgaben lösen, etwa ein Luxusappartement vermieten. Trumps Rolle ist es, deren Leistung zu beurteilen und in jeder Folge den schwächsten Teilnehmer zu feuern, bis am Ende nur noch der Gewinner übrig bleibt. Der Ausruf „You’re fired“ (Du bist gefeuert) wurde zum Markenzeichen der Sendung und zum Synonym für jene Siegerkälte, die für das Selbstmitleid der Verlierer nur Verachtung übrig hat.
In „The Apprentice“ konnte Trump jene Superegorhetorik ausprobieren, die einige Zeit gute Einschaltquoten garantierte, und seine Rolle als Starunternehmer einüben, die mit der Realität nur wenig zu tun hatte. Während er sich schon damals als Milliardär bezeichnete, kam eine Schätzung der Deutschen Bank im Jahr 2007 nur auf 788 Millionen Dollar, was in Österreich etwa dem Vermögen der Familie Dichand entsprach.
Wenn Trump jemanden feuerte, dann meist mit dem Hinweis auf die verantwortungsvolle Aufgabe, die der Kandidat unmöglich übernehmen könne. Übernahm Trump selbst die Verantwortung, lief es nicht immer gut. Der Kauf von Casinos in Atlantic City war eine von zahlreichen Pleiten, die hunderte Millionen Dollar vernichteten.
Jeder Manager wäre dafür gefeuert worden, nicht so Trump, dem das Fernsehen die Immunität des unverletzbaren Markthelden garantierte. Wo Narzissmus den Rang eines Volkssports besitzt, gerät die in Einschaltquoten messbare Anerkennung zum Leistungsnachweis.
Trumps Popularität wirkt dennoch anachronistisch. Seine Rolle als Master of the Universe scheint einem Roman oder Film der 80er-Jahre zu entstammen. Schriftsteller wie Bret Easton Ellis oder Tom Wolfe beschrieben den Typus des Wallstreet-Wolfs, der sich in den endlosen Spiegelungen seiner selbst verliert, berauscht von den täglichen Spekulationsgewinnen, unfähig, Empathie zu entwickeln. Wenn Trump heute durch seine goldenen Paläste führt, verbreitet er ein Flair wie ein Schulterpolsterkleid von Versace.
Mit Donald Trump zieht ein Soziotypus ins Weiße Haus, der eine beispiellose Pleiteserie hinter sich hat. In den Movern und Shakern der Nullerjahre überlebte zwar das breitbeinige Gehabe der Yuppies, und die Wallstreet verteidigte ihren Ruf als Mekka der Gierigen und Maßlosen. Sie hinterließen allerdings einen Trümmerhaufen, kaputte Banken und ruinierte Anleger, eine in wenige Reiche und viele Arme geteilte Welt. Nach dem Crash des Finanzmarktes wanderten einige Hedgefondsnarzissten ins Gefängnis oder baten öffentlich um Abbitte für die im Renditerausch begangenen Sünden.
Woraus bezieht Donald Trump, dieser Missionar des Nichtzweifels, dann seine Stärke?
Narzissmus der Opfer
Die Analyse seiner Gegner ermöglicht eine Antwort. Kritik an der Ich-Besoffenheit brachte eine mächtige Bewegung hervor, die nicht das grandiose, sondern das verletzliche Selbst in den Mittelpunkt stellte. Den Partys der Herrenmenschen folgten die Askesen des korrekten Lebens, dem Narzissmus der Täter der Narzissmus der Opfer.
Die typisch neoliberale Selbstdarstellung à la Trump wurde als Persönlichkeitsstörung alter Männer gebrandmarkt, die sich durch antidiskriminatorische Sprachregelungen und Transgender-Toiletten heilen lässt. Feministinnen entlarvten die Erotik erfolgreicher Männer als Neandertalercharme, Antirassisten hinterfragten die Privilegien der weißen Stämme. Anerkennung bekam, wer sich als Loser inszenierte oder sich öffentlich von seiner Männlichkeit lossagte.
Jede/r bekam das Recht zugesprochen, beleidigt zu sein. Die Reinigung der Kinderbücher von diskriminierenden Symbolen und die Verbesserung der Sprache durch das inklusive Binnen-I sind Symbole einer Entwicklung, in der die Sprache des Leids höchste Priorität genießt. Nicht das phallische Ich eines Donald Trump galt als Leitbild, sondern die Slash-Identität eines Sängers wie Antony Hegarty, der sich zur Musikerin Anohni weiterentwickeln sollte. Das queere Performen von Geschlechterrollen stach die High-Performance aus, der Safe-Space der LGBT-Bewegung die Risikogesellschaft.
Was die AntirassistInnen und AntisexistInnen mit ihrem Lieblingsgegner, der Ideologie des weißen Mannes, verbindet, ist das obsessive Kreisen um Gefühle wie Stolz und Angst. Nicht die Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse steht im Zentrum linker Politik, sondern der Nachweis, in seinen Gefühlen verletzt zu sein. Identitätspolitik propagiert die Abweichung als wahres Selbst, identitäre Politik die Rückkehr zur Norm. Wenn sich der Trumpismus nun auf das Volk und die Nation berufen, kehrt er die Ideologie der Nicht-Identität in etwas metaphysisch Positives um. Den Karneval sich auflösender Geschlechter bekämpft Trump durch restaurative Männlichkeit. Das macht ihn paradoxerweise auch für jene attraktiv, die im Wettbewerb um Anerkennung den Kürzeren ziehen.
Wer in den Genuss positiver Diskriminierung kommt, etwa in Form von Frauenquoten in den Chefetagen, leidet unter dem Makel, es nicht allein geschafft zu haben. Friedrich Nietzsche polemisierte gegen die christliche Moral der Schuldgefühle, die die „aristokratische“ Bereitschaft, gefühllos und dennoch ausdrucksstark zu sein, unterdrückt. Im Reality-TV-Hero und Twitterkrieger Trump erkennen auch manche jener ein Idealbild wieder, die die Bürokratie des Privilegienabbaus als würdelos empfinden.
Das für viele Schockierende an seiner Wahl war nicht die Mobilisierung des konservativen Amerika, sondern der relativ hohe Stimmenanteil bei Frauen und Migranten, mithin jener Gruppe, der die Narzissmuskritik eine Sonderstellung einräumte. Sogar mexikanische Einwanderer wählten einen Mann, der sie verhöhnt hatte. Mit den Schlagworten Stolz und Stärke hatte Trump Frames gesetzt, die erotischer wirkten als die ritualisierte Selbstzerknirschung der Linken.
In der liberalen Anerkennung ohne Kampf lebt jene christliche Umkehrung fort, in der sich reale Unterdrückung als Einfühlung maskiert. Der Reiche verneigt sich demütig vor dem Armen, der Papst küsst dem Bettler die Füße. Die zu Almosenempfängern degradierten Schwachen empfinden antirassistische Solidarität möglicherweise nicht als Respekt, sondern als subtile Form der Erniedrigung. Das Regime der Nächstenliebe formuliert seine Drohung in süßen Worten: „Ich will doch nur, dass es dir gut geht.“ Wer sich als institutionalisiertes Opfer fühlt, sehnt sich nach einer Religion, die die Überwindung von Schuldgefühlen empfiehlt: „Gott gibt mir die Kraft, zu erreichen, was ich wirklich will“, predigte Trumps Seelsorger Reverend Norman Vincent Peale.
Meryl Streeps Hohn
Wenn von einem Riss in der Gesellschaft die Rede ist, kann er an dieser Stelle ertastet werden. Während das Milieu der umweltbewussten Radfahrer und Transgenderbiokistlkunden reich ist an moralischem Kapital, suchen die oft ländlichen SUV-Fahrer und Amazonshopper vergeblich nach Quellen der Selbstachtung.
Eine narzisstische Unterversorgung epidemischen Ausmaßes hat auch in Österreich jene Reichshälfte erfasst, die nicht nur Landflucht und Automatisierung erlebt, sondern auch rituelle Angriffe auf alte Gewohnheiten. Das privilegierte Volk der Begegnungszonen hat für heteronormative Glücksmomente, wie sie etwa auf Konzerten von Andreas Gabalier gefeiert werden, nur Hohn übrig. Wer das Singen der gendergerechten Version der Nationalhymne verweigert, findet sich im Eck unbelehrbarer Sexisten wieder.
In einem vielbeachteten Artikel für die New York Times rief Mark Lilla, Ideenhistoriker an der Columbia-University, zur Mäßigung bei moralischen Ansprüchen auf, mit anderen Worten: Ein vorsichtiger Umgang mit den Begriffen Rassismus, Islamophobie und Sexismus würde zur narzisstischen Stabilisierung großer Teile der Bevölkerung beitragen.
Meryl Streep prangerte unlängst die Ausländerfeindlichkeit von Donald Trump an. Wenn Hollywood nun alle ausländischen Künstler und Künstlerinnen rausschmeißen würde, bliebe den Amerikanern nichts anderes übrig als Football und Mixed Martial Arts zu schauen, die „keine Kunst sind“. Streep spielte damit auf die Lieblingssportarten des neuen Präsidenten an. Auf einen Schlag hatte es die feministische Ikone geschafft, Millionen Anhänger und Anhängerinnen einer nichtelitären Kultur vor den Kopf zu stoßen. Kristin Dombek, Autorin des Essays „Die Selbstsucht der anderen“, attestiert den Trump-Kritikern eine Lust, sich über ihren Gegner moralisch zu erheben: „Sie fühlen sich wahrhaftiger und tiefgründiger.“
Narzissmus und narzisstischer Anti-Narzissmus, Trumpismus und Opferkult finden sich nie in Reinkultur, sondern haben eine ambivalente Beziehung zueinander, wie jene von Freud beschriebene Hassliebe der Kinder zu ihren Eltern. Ein erfolgreicher Narzisst lebt von der Empathie seiner Anhänger, sein Ich wächst durch deren Applaus. Umgekehrt profitiert der Fan von der Grandezza seines Idols, sonnt sich mit ihm im Rampenlicht. Die neue Netflixserie „The OA“ erzählt die Geschichte einer Frau, die von einem Unbekannten entführt wurde und sich nach Jahren der Gefangenschaft befreien kann. Die Fantasie hilft ihr zu überleben, sie imaginiert sich als Engel und ihren Vater als russischen Oligarchen, der unterwegs ist, sie zu befreien: die Regression in narzisstische Grandiosität als Möglichkeit, das Unerträgliche zu überstehen.
Demnach wäre Donald Trump eine in seelischen Favelas entwickelte Fantasyfigur, seine Großartigkeit nichts anderes als das Wunschbild jener Niedergeschlagenen, die sich an einem imaginierten Helden aufrichten. „Wieder groß“ ist in diesem Sinne ein Märchen, das das Leben erträglich macht.
So wie bei jenem zehnjährigen Jungen, der ein Fan von „The Apprentice“ war. Der Bub hatte Krebs im Endstadium und sein größter Wunsch lautete, ein einziges Mal von Trump „gefeuert“ zu werden. Ein Wohltätigkeitsverein organisierte das Treffen in einer Drehpause, und der kleine Mann erschien in Anzug und Krawatte in der Vorstandskulisse des Trump-Tower.
Auch einen Rollkoffer hatte er dabei, denn es gehört zu den Elementen der Show, dass der gefeuerte Kandidat den Raum mit seinen Habseligkeiten
verlässt. Der junge Besucher träumte von einem Magier, dessen Worte auf ihn wirkten wie ein Zauberspruch.
Und wie reagierte Trump, der die Geschichte übrigens nie selbst öffentlich machte? Er brachte den Spruch „You’re fired“ zwar nicht über die Lippen, nahm das Kind aber auch nicht in den Arm. Vielmehr stellte er einen Scheck über mehrere tausend Dollar aus und sagte zu ihm: „Hau sie auf den Putz. Lass es krachen.” Im Reich von König Narziss gibt es keine Tränen.