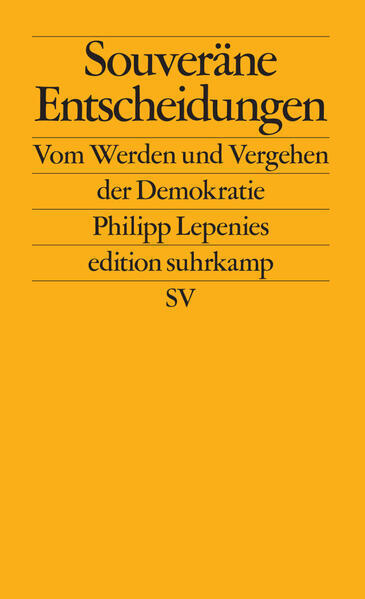Die notwendige Fiktion der Volkssouveränität
Klaus Nüchtern in FALTER 23/2025 vom 04.06.2025 (S. 21)
Wie uns praktisch täglich vor Augen geführt wird, ist Demokratie keine Staatsform, die unhinterfragt als erstrebenswert gilt, geschweige denn auf Dauer gestellt wäre. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2023 hat über die Hälfte der Deutschen kein großes Vertrauen in sie. Bedroht ist sie aber nicht nur durch populistische oder autoritäre Strömungen, sie ist, wie der aus dem US-amerikanischen Exil nach Deutschland zurückgekehrte Jurist Ernst Fraenkel bereits in den 1950ern konstatierte, mehr als jede andere Regierungsform selbstmordgefährdet.
Die Erosion, die schleichende Zerstörung von innen, ist denn auch ein Phänomen, das der Wirtschafts-und Politikwissenschaftler Philipp Lepenies zum Ausgangspunkt seines jüngsten Buches gemacht hat. "Souveräne Entscheidungen" zeichnet das "Werden und Vergehen der Demokratie" anhand historischer Beispiele nach, zieht daraus Schlüsse für die Gegenwart und stellt gleich zu Beginn eine überraschende These in den Raum: "In der Geschichte der Demokratie hat der Demos, das Volk, kaum eine Rolle gespielt."
Für eine Herrschaftsform, die gemäß der berühmten Definition von Abraham Lincolns "Gettysburg Adress"(1863) eine "Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk" darstellt, ist das doch ein steiler Befund. Und er ist, wie sich bei fortschreitender Lektüre herausstellt, in dieser Apodiktik auch nicht haltbar.
Wahr ist freilich, dass die Pioniere der Demokratie nur begrenztes Vertrauen in die Demokratiefähigkeit des Volkes hatten. "Es ist unglaublich, wie stupid das Volk ist", befand der Mainzer Jakobiner, Naturforscher und Reiseschriftsteller Georg Forster; den liberalen Revolutionären von 1848 graute vor der "Krawallsouveränität" des "Volkshaufens", und die Weimarer Reichsverfassung von 1919 verordnete Staatsbürgerkunde als Pflichtfach in den Schulen - ein Auftrag, vor dem sich, so Lepenies, der Staat auch heute nicht drücken könne, nachdem weder die Familie noch die Religion dazu in der Lage sei, "den Trend der gesellschaftlichen Dezivilisation umzukehren".
Der historische Panoramaschwenk, den der Autor liefert, macht deutlich, wie verschieden die Akteure, Motive und Strategien sind, die zur Entstehung von Demokratie beitragen. Ohne Programm, Vorbilder und institutionelle Praxis hat es mitunter gar den Anschein, als wäre diese irgendwie "passiert" - und das auch noch im Mutterland des Parlamentarismus: "England wurde eine Republik wider Willen, eine Republik ohne überzeugte Republikaner."
Mitunter geraten die Ausführungen zur Demokratiegeschichte in Mainz, Frankfurt und Weimar etwas gar langatmig und zitatreich. Äußerst aufschlussreich ist dafür das Schlusskapitel, eine rechtsphilosophische Auseinandersetzung nicht zuletzt mit dem Werk Hans Kelsens, des Vaters der österreichischen Verfassung von 1920. Der Rechtspositivist gelangte nämlich zur Einsicht, dass die Volkssouveränität eine notwendige Fiktion sei, mit der der Parlamentarismus etwas zu leisten verspricht, "was er nicht gehalten hat, und was er niemals zu halten im Stande sei".
Worauf heute von Volkskanzlerdarstellern und anderen Populisten gepocht wird, nämlich dass das Parlament den "Volkswillen" zu exekutieren habe, sei weder möglich noch im Sinne einer repräsentativen Demokratie. Dass diese auf dem Wettstreit der Argumente und den daraus resultierenden Kompromissen beruht, ist keine neue Erkenntnis, aber eine, so legt Lepenies nahe, die immer wieder aufs Neue durchdacht, gelebt und verbessert werden muss.