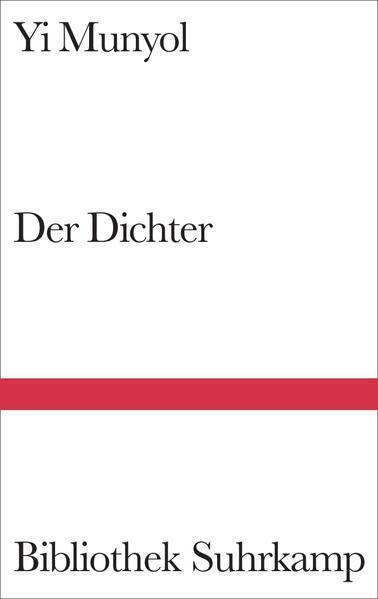Die Schande, die nimmt ihren Lauf, der Dichter setzt den Strohhut auf
Karl-Markus Gauß in FALTER 10/2011 vom 09.03.2011 (S. 33)
In seinem historischen Roman "Der Dichter" gibt sich der Südkoreaner Yi Munyol keine Mühe, uns das alte oder das gegenwärtige Korea verständlich zu machen. Gut so!
Korea im Jahr 1811. In der Provinz bricht eine Revolte gegen den fernen König aus, der sich auch der angesehene Kommandant der Stadt Pyongan anschließt. Als der Aufstand blutig niedergeschlagen ist, wird über seine Familie die Ächtung bis in die dritte Generation verhängt.
Schon der Sohn des Kommandanten, aus dem Hochadel ins Lumpenproletariat verstoßen, versucht durch unerschütterliche Untertanentreue die Ehre der Familie wiederherzustellen, aber er stirbt vorzeitig, von der beständigen staatsbürgerlichen Fleißarbeit erschöpft. Auch der Enkel steht permanent unter Druck, er muss als "Abkömmling eines Verräters" einfach besser, ergebener, pflichtbewusster sein als seine Kameraden in der Schule.
"Lernen ist der Schlüssel zur Macht", wird er von seiner Mutter belehrt, und wie es ein sino-amerikanischer Bestseller neuerdings wieder empfiehlt, drillt sie ihn daher darauf, unentwegt zu "lernen, lernen, lernen". Sie selbst nimmt die größten Entbehrungen auf sich, um stets die besten Lehrbehelfe für ihn aufzutreiben.
Als er 18 ist, hat Kim mehr Bücher als alle Gefährten gelesen, und er weiß mit Pinsel und Tinte besser umzugehen als sie. Zu den Disziplinen, die beherrschen musste, wer es zu Ansehen bringen wollte, gehörte die Dichtkunst. Bei einem Wettbewerb erringt Kim den ersten Platz. Welchen sonst?
Das vorgegebene Thema, bei dem er mit patriotischen Versen brillierte, war freilich just jener Aufstand, in dem sein Großvater auf der falschen Seite stand. Als er davon erfährt, setzt Kim sich einen Strohhut auf, den er bis ans Ende seiner Tage nicht mehr abnehmen wird und dessen Krempe so breit ist, dass niemand seine Augen sehen kann. Dann legt er den Preis zurück und zieht übers Land, ein Vagabundendichter, der bald zur Legende und schließlich eins wird mit der Landschaft, die er durchquert, mit den Mythen, die er erzählt.
"Der Dichter" ist ein historischer Roman, der von einer realen Gestalt erzählt, die als "Kim Sakkat", als der Dichter mit dem Strohhut, in die koreanische Literaturgeschichte eingegangen ist. Der Roman befremdet, weil er sich gar keine Mühe gibt, uns das alte Korea, in dem er spielt, und das neue, in dem sein selbstreflexiver Autor ihn geschrieben hat, vertraut zu machen.
Der 1948 geborene Yi Munyol gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren Südkoreas. Er, der als Sohn eines zu den Kommunisten im Norden übergelaufenen "Verräters" selbst eine schwere Jugend hatte, erzählt von einer Welt, die uns fremd anmutet; von einem Denken, das grundlegend anders ist als das unsere, und einem Wertesystem, in dem wir unseren Platz nicht so leicht finden würden.
Endlich einmal werden wir also nicht dazu verleitet, von der Globalisierung zu schwärmen oder über sie zu jammern; lesend erfahren wir vielmehr, dass sich die ökonomische Globalisierung nicht überall als kulturelle Vereinheitlichung ausgewirkt hat und dass es Menschen gibt, die in derselben technologischen Umwelt wie wir ganz anders leben, als wir es tun.
Die Macht der Sippenhaft, die vor zwei Jahrhunderten über die Familie des Kommandanten verhängt wurde, hat bis heute ungebrochen Tradition in Korea: Auch wenn der Staat sich ihrer nicht mehr bedient, haben doch seine Bürger selbst sie verinnerlicht. Man denke nur an den Präsidenten Roo Mo Hyun, einen tapfer gegen die Korruption kämpfenden Reformer, der sich 2009 von einem Felsen ins Meer stürzte, weil er nur so die Schmach tilgen zu können glaubte, die durch betrügerische Machenschaften seines Sohnes über die ganze Familie gekommen war.
Die dramatische Szene, in der der junge Dichter ersten Ruhm erwirbt und zugleich von der Schmach der Familie erfährt, taucht das ganze Romangeschehen in ein flackerndes Licht, in irritierende Ambivalenz. Ist der junge Kim Sakkat geflüchtet, weil er sich seines Großvaters oder weil er sich seines Gedichtes schämte? Oder hat sich Kim Sakkat damals gar wider alle Konventionen seine Existenz als heimatloser, ungebundener, als erster "moderner" Dichter seines Landes selbst entworfen?
Yi Munyol gibt keine Antwort darauf, er zitiert vielmehr einander widersprechende Quellen, er spielt verschiedene Legenden gegeneinander aus und befragt die Zeugnisse der Vergangenheit mit dem Wissen und den psychologischen Einsichten des Heutigen. Nur Mutmaßungen stellt er darüber an, warum Kim Sakkat vom Staats- zum Volksdichter wurde und, populär geworden mit galligen Spottversen, endlich doch zur Einsicht gelangte: "Warum sich verhärten in harter Zeit?"
Der Autor erfreut die Leser mit einem merkwürdigen, bis zuletzt befremdlichen Roman, aber auch mit allerlei kuriosen Grübeleien. So spekuliert er einmal darüber, was aus Gedichten wird, die keiner mehr liest und die nirgendwo mehr vorgetragen werden. Nun, sie bleiben Gedichte auf ewig.
Was aber ist mit dem Dichter, wenn er einmal gestorben ist? Die Antwort gibt erst der letzte Satz des Buches: "Kurz und knapp: ein toter Dichter ist nicht mehr Dichter." Das leuchtet ein, auch wenn mir kein europäischer Roman einfällt, der so hätte enden können.
Wer sich auf Literatur einlässt, die aus fernen Ländern zu uns kommt, wird oft bemerken, dass das Fremde in Wahrheit so fremd nicht ist. Manchmal aber lehrt die Literatur gerade umgekehrt, dass die Menschen nicht überall genauso empfinden, denken, leben müssen, wie wir es tun. Auch das ist eine Erfahrung, die man sich nicht ersparen sollte.