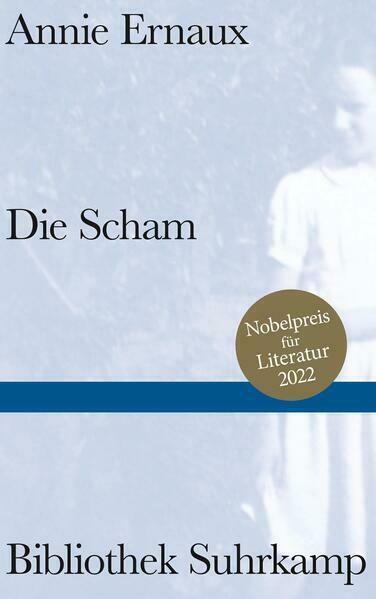Klaus Nüchtern in FALTER 49/2020 vom 02.12.2020 (S. 34)
„An einem Junisonntag am frühen Nachmittag wollte mein Vater meine Mutter umbringen.“ Ein starker erster Satz, der Erwartungen weckt, die systematisch unerfüllt bleiben. Erst nach 20 Seiten prätentiös-pathetischer Metareflexion rafft sich die Autorin dazu auf, das zwölfjährige Mädchen, das sie 1952 war, zu rekonstruieren, denn: „Es gibt keine wirkliche Erinnerung an sich selbst.“
Als „Ethnologin meiner selbst“ macht sich Ernaux daran, die soziale Topografie der Kleinstadt zu erstellen, in der sie aufwächst. Die Eltern betreiben ein Geschäft und ein Lokal, nichts zu verschwenden und nicht unangenehm aufzufallen ist oberste Lebensmaxime. Die kleinbürgerliche Disziplin wird durch sado-katholische Schulerziehung verstärkt. Im Original bereits 1997 erschienen, erinnert „Die Scham“ im Ansatz mitunter an Handkes „Wunschloses Unglück“ (1972), ist vor jargonesk verbrämten Banalitäten allerdings nicht gefeit.