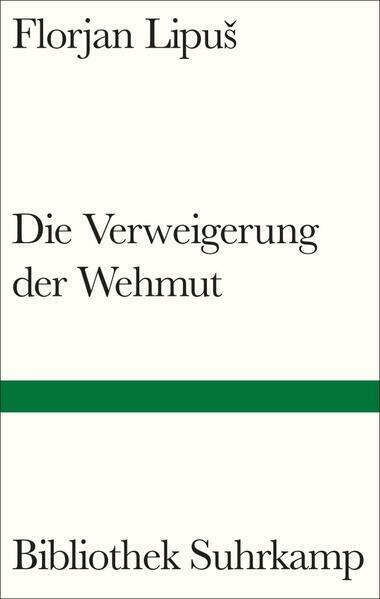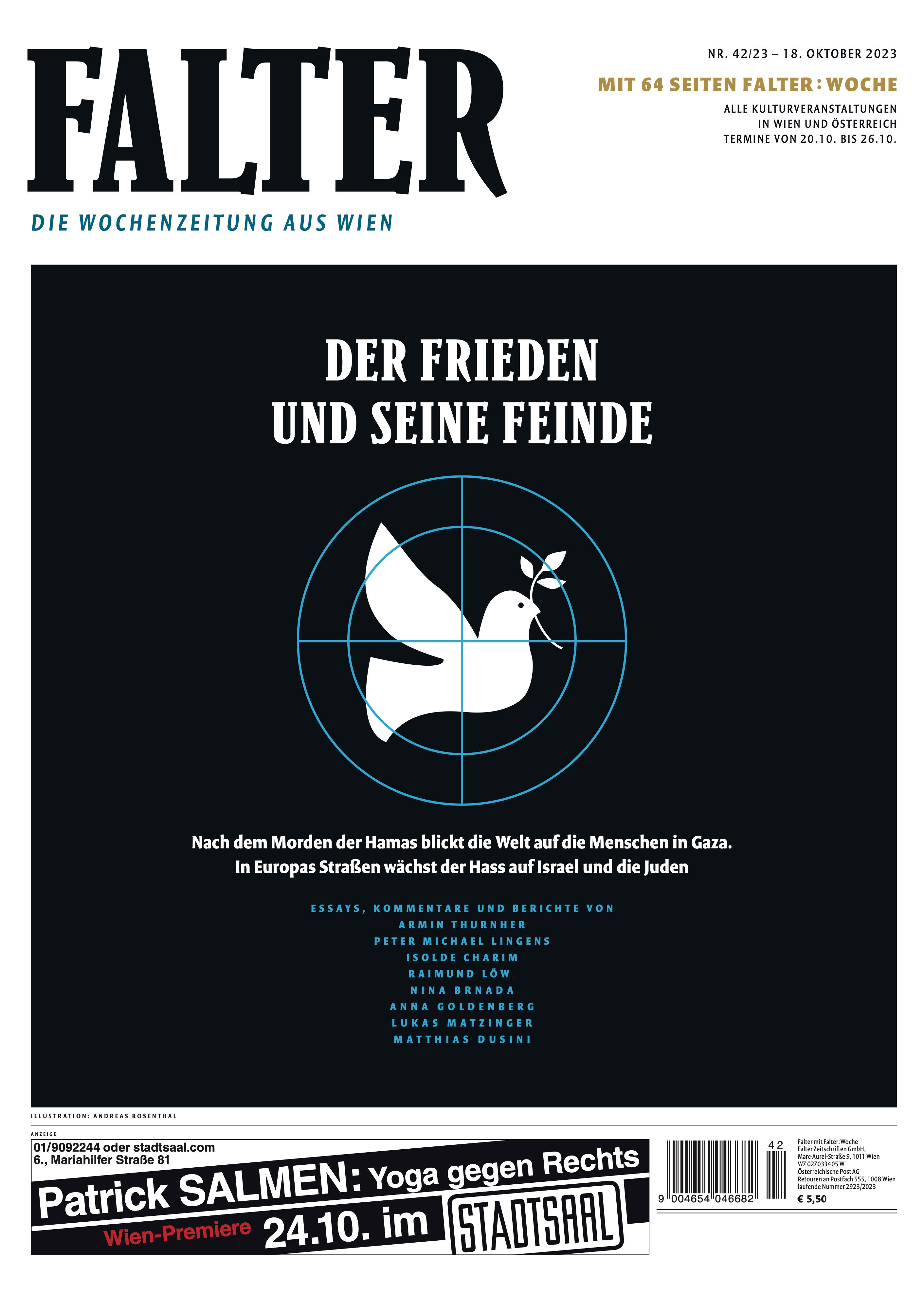
Totenwache mit Tieren, aber ohne Sohn
Antonio Fian in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 11)
Die Verweigerung der Wehmut“ wurde 1989 erstmals auf Deutsch veröffentlicht und seither mehrfach in verschiedenen Verlagen wieder aufgelegt. Nun hat der Text Eingang gefunden in die ehrwürdige Bibliothek Suhrkamp.
Im ersten von vier Kapiteln dieses schmalen Buches hat sich der Protagonist auf die Reise aus der Stadt in den abgelegenen Weiler im Kärntner Unterland gemacht, um an der Beerdigung des Vaters teilzunehmen. Schon während der Zugfahrt taucht er ein in die Vergangenheit, die Kindheit als Sohn eines Holzarbeiters und einer Erntehelferin, erinnert sich der schweren Arbeit in den Wäldern und auf den Feldern, sieht vor sich den (realen oder bloß von ihm imaginierten?) Unfalltod des Vaters im Wald ebenso wie jenen der Großmutter bei der Erntearbeit: „Sie ließ sich auf die Knie nieder, auf ihr Gesicht, röchelte, knackte wie ein trockener Zweig […], verließ das Feld, wie das stachelige Fruchtgehäuse einer Kastanie zu Boden fällt und aufplatzt und aus ihr eine reife Kastanie springt, fortkollert, wegstiebt.“
Kapitel zwei und drei beschreiben das Ritual der Totenwache, an der der Sohn nicht teilnimmt, anders als die Menschen der näheren Umgebung, die zahlreich erscheinen, um Abschied zu nehmen und Litaneien zu beten, aber auch, um die Gelegenheit wahrzunehmen, an der „Pogačafestlichkeit“ teilzunehmen und reichlich zu essen und zu trinken. Schaben und Spinnen kriechen aus ihren Verstecken, um sich ihren Anteil zu holen, und je länger die Totenwache dauert, umso mehr verwandelt sie sich in eine wilde, trunkene, schamlose Feier des Lebens.
Auch an dem Begräbnis am nächsten Tag, zu dem er ja angereist ist, nimmt der Sohn nicht teil, sondern sucht, im abschließenden Kapitel, noch einmal die Überreste des Elternhauses auf, das seit Jahrzehnten verfallen ist und eingewachsen in die Wildnis, die es umgibt. Es musste verlassen werden in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, weil die Mutter, die es ohne männliche Hilfe bewirtschaftete, eines Tages von Gestapo-Männern abgeholt und ins KZ verschleppt wurde. „Die Hände hatte sie voll mit Teig gehabt, als sie kamen, sie zu holen. […] Die Männer ließen sich nicht erweichen, sie ließen nicht zu, daß der Laib in den Ofen geschoben wurde.“
Um die Ermordung seiner Mutter, dieses traumatische Detail seiner Biografie, kreisen mehrere von Florjan Lipuš’ Büchern. Selten verlässt er darin die nähere Umgebung, in der er aufgewachsen ist und noch immer lebt. Er lässt sie erstehen in einer bildmächtigen, archaisch anmutenden literarischen Sprache, die sich freudig Assoziationen überlässt und dabei Reime, Wortspiele, Wortneuerfindungen nicht scheut.
Nicht hoch genug einzuschätzen ist daher die Leistung des viel zu früh von uns gegangenen Fabjan Hafner, der für seine Übersetzung ins Deutsche eine Form gefunden hat, die die Virtuosität und die Intention des slowenischen Originals auch für dieser Sprache nicht mächtige Leserinnen und Leser spürbar macht.