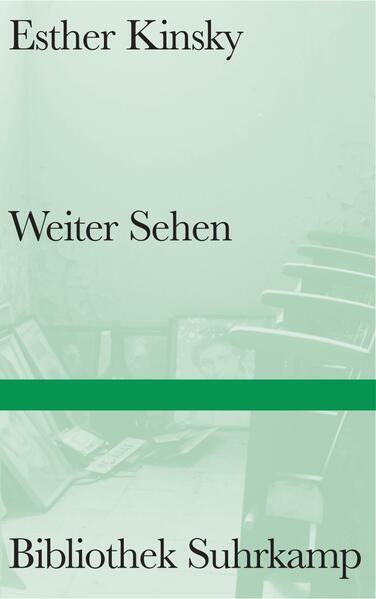"Das Kino ist für mich ein Ort der Heilung"
Michael Omasta in FALTER 20/2023 vom 17.05.2023 (S. 36)
Esther Kinsky, 66, zählt zu den meistbeachteten und -ausgezeichneten deutschsprachigen Autorinnen der Gegenwart. Ihr hochgelobter Roman "Rombo" (2022) handelt von einem Erdbeben, das 1976 das Friaul erschütterte, wo die im Rheinland aufgewachsene Kinsky, die davor in London, Berlin und Budapest gelebt hatte, eine neue Wahlheimat fand. Daneben hat sie auch noch eine kleine Wohnung auf der Wieden in Wien, wo sie mehrere Monate im Jahr verbringt.
Die Kinos sind für Kinsky von jeher Orte mit einer geradezu magischen Anziehungskraft gewesen - eine lebenslange Faszination, ja Obsession, über die auch ihr jüngstes Buch "Weiter Sehen" Auskunft gibt. Grund genug für den Falter, die Autorin bei einem Besuch der noch bis Ende Juni laufenden Doppelretrospektive der französischen Regisseure Claude Sautet und Jacques Becker (siehe Kasten) im Filmmuseum zu begleiten und danach in der nahe gelegenen Gastwirtschaft Reinthaler das folgende Gespräch zu führen.
Falter: Frau Kinsky, Sie haben sich bereits gestern einen Film von Claude Sautet angesehen?
Esther Kinsky: Ja, ich habe zum ersten Mal "Der Panther wird gehetzt" mit dem jungen, ungemein präsenten Jean-Paul Belmondo gesehen und fand den sehr, sehr gut. Der Anfang des heute gezeigten Films "Schieß, solange du kannst" hat mich schon an den erinnert. Auch die Musik war super.
Die Ankunft von Lino Ventura, den man im Flieger, im Taxi, im Hotel, im Auto und auf dem Schiff sieht -das war schon extra dry.
Kinsky: Ja, ganz toll - ein fragmentiertes Roadmovie.
Ist das Ihre übliche Besuchsfrequenz: täglich ins Kino?
Kinsky: Wenn ich an einem Buch schreibe, sitze ich in Italien und gehe nicht ins Kino. Auch weil in dem sehr schönen Kino in Udine neuerdings viele synchronisierte Filme gezeigt werden, was ich hasse. Außerdem ist es für mich auch kein Ins-Kino-Gehen, wenn ich 15 Kilometer fahren muss.
Und wenn Sie Ihr Schreibprojekt abgeschlossen haben?
Kinsky: Dann ist mein Bedürfnis so groß, dass ich sogar zwei oder drei Mal am Tag ins Kino gehe. Das Kino ist für mich ein Ort der Heilung.
Wie meinen Sie das?
Kinsky: Ich bin eine große Gegnerin der Privatisierung und der Entwertung des öffentlichen Raumes und finde, dass die anonyme Gemeinschaft im Kino etwas Unersetzbares ist. Darin liegt für mich eine therapeutische Qualität.
Das Thema ist durch die Pandemie brisanter geworden. Es gibt aber Menschen, die finden, dass Kinos durch Streaming-Dienste obsolet geworden sind.
Kinsky: Dagegen muss man ins Feld ziehen! Diese Form von Privatisie-Fortsetzung nächste Seite rung geht mit einer totalen Auslieferung des eigenen Privatlebens einher: Wenn ich mit Bargeld meine Kinokarte kaufe, bin ich viel weniger kontrollierbar, als wenn ich mir am Laptop einen Film herunterlade. Sobald mein Smartphone seinen Geist aufgibt, werde ich es durch ein altes Nokia-Handy ersetzen.
Sie unterscheiden strikt zwischen dem Medium Film und dem Kino als Ort und schreiben auch, dass Sie sich oft nicht mehr an den Film, aber ans Wetter erinnern, das beim Besuch gerade geherrscht hat.
Kinsky: Ja, oder was für ein Kopf in der Reihe vor mir zu sehen war. Mit dem Kinosterben geht auch ein Verlust des Materiellen, des Handwerklichen einher. Jemand wie John Cassavetes hat wahnsinnig viel Material verbraucht und von anderen Reste unbelichteten Films erbettelt. Und man kann bei seinen endlos langen Filmen sehen, wie sich von der einen auf die andere Rolle auf einmal das Licht und die Farben ändern. Sie sind auch eine Dokumentation des Ringens ums Material.
Wenn Sie nicht ins Kino kommen, schauen Sie wohl auch nichts auf Netflix?
Kinsky: Nie! Ich streame nicht und besitze vielleicht zehn DVDs, aber nur deswegen, weil ich manchmal über Filme schreibe und mir dann eine Szene mehrmals ansehen muss.
Zum Beispiel?
Kinsky: Meine Lieblingsszene aus Fellinis "La Strada", von der niemand gemerkt hat, dass ich sie in "Rombo" eingebaut habe. Dabei dachte ich: Es ist so offensichtlich!
Welche ist das?
Kinsky: Die, in der Anthony Quinn und Giulietta Masina, die ich nie besonders mochte, auf eine Farm kommen, wo gerade eine Hochzeit vorbereitet wird. Da bandelt Quinn mit dieser tollen Schauspielerin an, die das Essen vorbereitet. Die ist unglaublich subtil! "La Strada" ist schon auch ein grandioser Film über ein total zerbrochenes Land.
Sie leben mittlerweile selbst in Italien. An einem filmtauglichen Ort?
Kinsky: Ich lebe tatsächlich in einer Kinolandschaft zwischen den Bergen, die mich eigentlich nicht so interessieren. Aber wenn man von den Hügeln weiterfährt, kommt man in die Ebene. Besucher zwinge ich dazu, Regionalzüge zu nehmen und an einem bestimmten Bahnhof auszusteigen. Das ist wie aus Bertoluccis "1900".
Wann haben Sie den zum letzten Mal gesehen?
Kinsky: Bei der Morricone-Retrospektive im Filmmuseum letztes Jahr.
Und hat er gehalten?
Kinsky: Finde ich schon. Wobei ich vergessen hatte, dass Gérard Depardieu eine Hauptrolle hat. Für diesen Film kann man ihm viel verzeihen, da ist er einfach großartig! Die Szene, in der die Mädchen auf dem Dachboden liegen und in dieser flirrenden, flachen Landschaft von dem fernen Mantova fantasieren, war eine der Inspirationen für "Weiter Sehen".
Sie vertreten so etwas wie einen Determinismus der Landschaft?
Kinsky: Ja, den gibt es für mich tatsächlich.
Flache Gegenden machen die Menschen müde
Kinsky: Sie machen sie müde, aber sie bringen auch Leute hervor wie meinen Lieblingsregisseur Béla Tarr. Diese leeren Landschaften sind eigentlich Unlandschaften, die keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wie zum Beispiel Berge. Sie sind auch nicht so spektakulär wie Wüsten. Dadurch bekommen aber Dinge - sei es ein Haus, ein kleiner Hain oder ein Pflug -eine ganz andere Gültigkeit. Das hat mich sehr fasziniert und mein Leben tatsächlich verändert. Wenn man von Wien aus in Richtung der pannonische Tiefebene blickt, verliert sich ja auch alles Pittoreske.
In den österreichischen Filmen der 1930er-Jahre bekommt diese flache Landschaft mit den Wolken darüber ganz schnell etwas Unheimliches.
Kinsky: Auf jeden Fall! Auch bei Regisseuren wie Miklós Jancsó und mehr noch in der ungarischen Fotografie spielt diese Übermacht des Himmels eine große Rolle.
Wie stehen Sie zur niederländischen Malerei?
Kinsky: Oh, die liebe ich sehr!
Haben Sie die Vermeer-Ausstellung im Rijksmuseum in Amsterdam gesehen?
Kinsky: Ja, weil meine Übersetzerin ins Niederländische gleich am zweiten Tag Karten ergattern konnte. Bei Vermeer kommt der Lichteinfall fast immer von links, das ist für meine Fotografie sehr wichtig. In der Ausstellung gab es ein Bild, das ich nicht kannte. Es zeigt eine Lautenspielerin, die innehält und gerade aus dem Fenster blickt, wo sie etwas gesehen hat. Ein ganz, ganz tolles Bild!
Womit fotografieren Sie?
Kinsky: Ich habe eine Hasselblad, Mittelformat.
Ihre Fotos von dem ungarischen Kino, das Sie vor Jahren entdeckt haben, waren der Anstoß für das "Weiter Sehen"?
Kinsky: Ja, die hatte ich sehr lange nicht mehr angesehen, und als ich sie zwei Freunden zeigte, meinten die, ich müsse unbedingt ein Buch daraus machen.
Sie erzählen darin die ziemlich irre Geschichte, dass Sie spontan zur Kinobetreiberin in der ungarischen Pampa wurden. Wie kam es dazu?
Kinsky: Wir hatten unser Haus in London verkauft, und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Geld, von dem auch noch was übrig blieb, nachdem ich eine Wohnung in Budapest gekauft hatte. Ich war zum Fotografieren in Südostungarn und musste wegen eines Gewitters in einem Ort bleiben, von dem ich nicht einmal wusste, wie er hieß. Danach ging ich spazieren, komme zu einem Haus, und auf einmal stand, wie aus dem Boden gewachsen, ein Mann mit einem Schlüsselbund neben mir. Er fragte mich, ob ich das Haus sehen wolle, es sei zu verkaufen. Ich sehe mir das an, es gefällt mir, und ich frage aus Höflichkeit: "Wie viel kostet das?""5000 Euro." Worauf ich mich sagen höre: "Ja, nehm ich."
Von welchem Zeitrahmen sprechen wir?
Kinsky: Bis alle Papiere fertig waren, dauerte es vielleicht zehn Tage. In dieser Zeit habe ich auch das Kino entdeckt. Und auf einmal verfügte ich über eine Equipe von etwa fünf Handwerkern, die alle ein bisschen Deutsch konnten, weil sie einem Stuttgarter Wurstfabrikanten über zwei Jahre lang einen Atombunker gebaut hatten.
Das hört sich ja fast an wie aus "Better Call Saul"! Wie lange hatte das Kino davor geschlossen?
Kinsky: Zwölf Jahre. Es war ziemlich verfallen, aber auch unglaublich schön, sehr groß und ausgemalt mit diesen pastellfarbenen geometrischen 60er-Jahre-Mustern -ein bisschen wie das Gartenbau-Kino.
Und wenn das Kino gut gegangen wäre, würden Sie heute noch Filme zeigen?
Kinsky: Wahrscheinlich schon. Ich hätte für Jahre ein tolles Programm machen können. Solange ich Geld habe, gebe ich es aus, aber organisatorisch bin ich hoffnungslos.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch von der Bedeutung des Kinos gerade an peripheren Orten.
Kinsky: Dazu muss man sagen, dass das Kino in den sozialistischen Ländern eine Rolle spielte, von der man sich im Westen keine Vorstellung macht. Das war ein Fenster in die Welt! In Kinos wie meinem kamen Leute wie der junge Emir Kusturica vorbei, und der brachte womöglich ein Ferkel mit, das im Garten vor dem Kino geschlachtet und gebraten wurde.
Und schon war das Drehbuch zum nächsten Kusturica-Film fertig!
Kinsky: Genau. Ich möchte aber nicht, dass das als so ein verrücktes Nostalgie-Projekt abgehandelt wird. Die Peripherie muss neu gedacht werden, und das würde ich gerne anstoßen.
Wenn ich sage, dass Ihr Buch mich immer wieder an Peter Handke erinnert hat, brechen Sie das Interview dann ab?
Kinsky: Nein. Ich mag Peter Handke sehr gern. Ich glaube aber, dass es etwas gibt, das mich von ihm unterscheidet: Ich rede nicht so gerne über mich selbst.