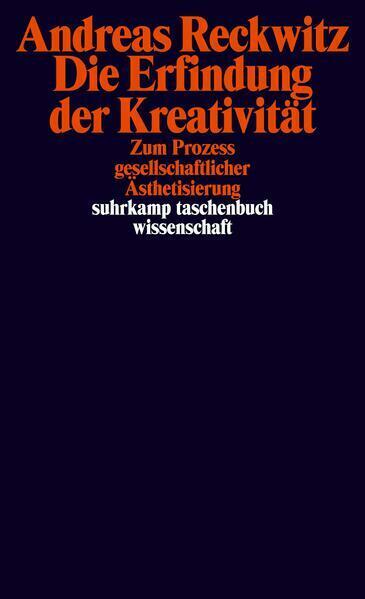"Kreativität ist keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern nur innerhalb eines bestimmten kulturellen Programms zu verstehen"
Klaus Nüchtern in FALTER 14/2013 vom 03.04.2013 (S. 23)
Wir müssen kreativ sein und wir wollen es auch sein. Was uns heute als fast selbstverständlich erscheint, ist in Wirklichkeit das Ergebnis eines komplexen historischen Prozesses, dessen Anfänge bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. In seinem Buch "Die Erfindung der Kreativität" zeigt Andreas Reckwitz, wie dieser Wunsch und Zwang zur Kreativität entstanden und wie er "seit den 1970er-Jahren immer tiefer in die kulturelle Logik der privaten Lebensführung der postmaterialistischen Mittelschicht (und darüber hinaus) eingesickert" ist. Reckwitz lehrt als Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.
Falter: Ihr Buch trägt den wohl auch bewusst kess gewählten Titel "Die Erfindung der Kreativität". Dürfen wir mit der Naivität kokettieren und Sie einfach einmal fragen, wer die denn wann
erfunden hat?
Andreas Reckwitz: Ebenso einfach geantwortet: Die Genieästhetik am Ende des 18. Jahrhundert war "schuld". Zu dieser Zeit wurde die Idee entwickelt, dass Künstler nicht das Klassische reproduzieren, sondern das Originelle "schöpfen" sollen. Kurz darauf haben dann die Romantiker begonnen, diesen Gedanken auf alle Menschen, also auch auf Nichtkünstler zu beziehen. In jedem Fall ist mir wichtig: Kreativität ist keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern nur innerhalb eines bestimmten kulturellen Programms zu verstehen.
Diese Kreativität ist aber auch ganz schön anstrengend. Der permanente Druck zur Selbstoptimierung produziert das "erschöpfte Selbst", wie Alain Ehrenberg das nannte. Sehen Sie da einen Ausweg oder ist das einfach der Preis, den wir zu entrichten haben?
Reckwitz: Dieses Doppel von Kreativitätsimperativ und Kreativitätswunsch ist in jedem Fall eine vertrackte Angelegenheit, denn beide Seiten stabilisieren einander, sodass die Orientierung an Kreativität praktisch unausweichlich scheint. Alternativen deute ich in meinem Buch an: Sie bestünden zum Beispiel darin, Kreativität in bestimmten Kontexten nicht mehr an einem bewertenden Publikum auszurichten – also quasi für sich selbst Fußball zu spielen statt vor Zuschauern. Zum anderen ist zu sagen, dass ästhetische Praktiken ja gar nicht auf das Neue und Innovative ausgerichtet sein müssen. Es gibt auch eine Ästhetik der Wiederholung und der Routinen – man denke an das Handwerk und was Richard Sennett darüber geschrieben hat.
Sie sind mit der weitverbreiteten These, wir lebten in einer "Wissensgesellschaft", nicht ganz einverstanden, weil die ästhetische Dimension zu kurz komme. Was wurde da übersehen?
Reckwitz: Die Wissensgesellschaft ist ja nur der erste Schritt gewesen: eine Gesellschaft, die auf Informationen und deren Verbreitung basiert. Aber grundsätzlicher ist mittlerweile die "Kreativästhetisierung", die Wirtschaft, Medien, Städte und Lebensstile erfasst hat. Ihre Grundstruktur ist mittlerweile darauf ausgerichtet, immer neue ästhetische Ereignisse zu produzieren und aufzunehmen. Auch Informationen interessieren dann primär unter ihrem ästhetischen Aspekt, eben dem Kick des Neuen, wie man an den Massenmedien sehen kann.
Ein klassisch kritischer Topos würde "Ästhetisierung" mit "Verschleierung" und "Ideologie" in eins setzen – wie das ja auch in Walter Benjamins bekannter Kritik an der "Ästhetisierung der Politik" durch den Faschismus der Fall ist. Greift das zu kurz?
Reckwitz: In jedem Fall. Ich würde Ästhetisierung keinesfalls pauschal negativ bewerten. Im Gegenteil: Die Transformation von Nichtästhetischem in Ästhetisches enthält ja das Potenzial für Wahrnehmungen und Gefühle, die sich vom Zwang der Zweckrationalität und der ewigen Befriedigungsaufschiebung emanzipieren. Das ist ja immer die ästhetische Utopie gewesen. Nur: Manche Formen der Ästhetisierung halten dieses Versprechen eben nicht.
Aus meiner Studienzeit erinnere ich mich an die schöne Frage auf dem Plakat der Marxistischen Gruppe: "Wie spät kann der Kapitalismus noch werden?" Was würden Sie antworten?
Reckwitz: Die Transformation vom klassischen Industriekapitalismus zum ästhetischen Kapitalismus ist so tiefgreifend, dass es sich in mancher Hinsicht doch auch um eine sehr neue Gesellschaftsformation handelt. Ich wehre mich also ein wenig gegen die simple These, die immer und überall nichts anderes als den Kapitalismus wittert! Der "ästhetische Kapitalismus" ist auch ein Element gesamtgesellschaftlicher Ästhetisierungsprozesse, die sich nicht auf den Kapitalismus reduzieren lassen. Es geht um ein ausgeprägtes Interesse an neuartigen Wahrnehmungsreizen um ihrer selbst willen und den mit ihnen verbundenen Affekten.
Was wären denn so die aktuellsten Phänomene, mit denen Sie Ihre These belegen würden, dass die "Ideen und Praktiken ehemaliger Gegen- und Subkulturen in die Hegemonie umgeschlagen sind"?
Reckwitz: Da gibt es viele Beispiele und schon seit längerem: ob man an den Yoga- und Meditationsboom denkt, die Individualreise à la "Lonely Planet" oder das Muster der schwulen Partnerschaft als akzeptierte Lebensform. Das beste Beispiel ist aber, wie ich finde, immer noch die Gentrifizierung und Kulturalisierung der Innenstädte: Dieses Zurück in die Innenstädte geht ja auf die Alternativkulturen der 70er-Jahre zurück und deren Ideal der Urbanität.
Da haben wir's wieder: Die Alternativen haben die Caffèlattisierung von Berlin-Mitte auf dem Gewissen. Ist da was falsch gelaufen oder ist die Alternativkultur quasi in ihrer Spießigkeit zu sich selbst gekommen?
Reckwitz: Das ist ein kultureller Prozess, der unabhängig von den Absichten der Personen abläuft. Die Alternativen wollten ja nicht Mainstream werden, sondern bestimmte Elemente aus ihrem Ideenpool waren einfach so attraktiv, dass andere Personen und Institutionen sie sich angeeignet haben.
Wer sich "verweigern" will, muss also aufpassen, dass er keine zu attraktiven Ideen hat?
Reckwitz: Das könnte man so sehen, bloß dass man die Attraktivität der Ideen selbst ja gar nicht abschätzen kann. Das ist ja genau der Prozess des Sozialen, der für mich als Soziologen die Entwicklung so interessant und für die Beteiligten vielleicht so ernüchternd macht: Mit großer zeitlicher Verzögerung können Minderheitspositionen mehrheitsfähig werden, kann also auch eine Haltung der Weigerung von einer individuellen Besonderheit zu einer ganzen sozialen Bewegung werden. Und am Ende versammelt sich eine ganze Kulturindustrie darum. Wir werden sehen.