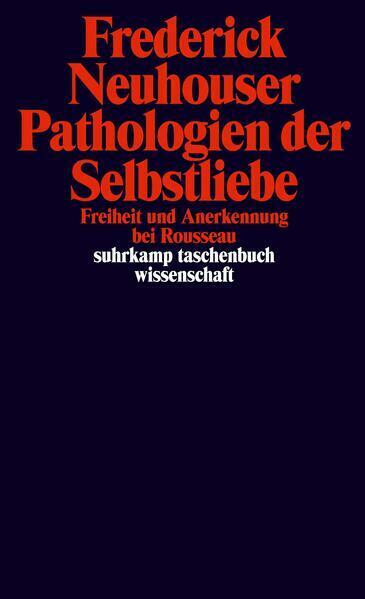Jean-Jacques, der Peinliche
Armin Thurnher in FALTER 26/2012 vom 27.06.2012 (S. 22)
Gehasst und verehrt, paranoid und luzid, verwirrend und ergreifend: warum man Rousseau lesen sollte
Jean-Jacques Rousseau war und bleibt eine Peinlichkeit. Frankreich feiert ihn im Jahr seines 300. Geburtstags leicht verlegen. Gut, Rousseau war kein Franzose, sondern Bürger der Republik Genf, also Schweizer. Aber im Gegensatz zu Franz Liszt, einem gebürtigen Ungarn, und Frédéric Chopin, einem gebürtigen Polen, widmete La Republique Française ihm kein Gedenkjahr. Obwohl die Republikaner 1794 seinen Leichnam ins Pantheon überführt und ihn gegenüber seinem Intimfeind Voltaire bestattet haben.
Rousseaus Gebeinen trug man ein Exemplar des "Gesellschaftsvertrags" voran. Der Revolutionär Robespierre berief sich mit geradezu religiöser Inbrunst auf Rousseau: "Er griff die Tyrannei mit Freimut an; er sprach mit Begeisterung von der Gottheit; seine Beredsamkeit schilderte enthusiastisch die Vorzüge der Tugend; sie verteidigte jene tröstlichen Grundsätze, die die Vernunft dem Herzen als Stütze gibt." Wenige Jahre zuvor war die von Robespierre geköpfte Königin Marie Antoinette schwärmerisch zu Rousseaus Grab gepilgert, das sich damals noch auf einer Insel im Park eines Aristokraten befand.
Ein Vorläufer Hitlers?
300 Jahre später ist "Tugendterror" ein Schimpfwort der Rechten gegen die Linke, und Rousseau kann jederzeit als Ziehvater dieser Spielart des Terrorismus (und auch jeder anderen) diskreditiert werden. In seinem schmalen, aber lohnenden Einführungsbändchen "Rousseau – Mensch oder Bürger" berichtet der Philosoph Robert Spaemann über Kontroversen zum 300. Geburtstag Rousseaus in Frankreich.
1912 verglich der antisemitische Rechtsintellektuelle Charles Maurras Rousseau mit einem heulenden Derwisch aus dem siebten oder achten Jahrhundert. "Wie Voltaire, aufgeklärt durch den antisemitischen Geist des Abendlandes (sic!), sehr wohl bemerkte, hatte Frankreich Lust bekommen, auf allen Vieren zu gehen und Gras zu fressen. Es ging, es fraß. Die reaktionären Triebe wurden nach Rousseaus Anweisung gemästet."
Er lehre die Menschheit, wieder auf allen vieren zu gehen und Gras zu fressen, war die zynische Antwort Voltaires, nachdem ihm Rousseau seinen Diskurs über die Ungleichheit geschickt hatte. Dort findet sich der Satz: "Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen: dies ist mein, und der Leute fand, die einfältig genug waren, es ihm zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft."
Der Weg zu Marx und Engels ist hier vorgezeichnet. Andererseits gefiel der Rechten Rousseaus Verklärung des einfachen Landlebens so sehr, dass Victor Klemperer, Literaturwissenschaftler und Naziopfer, Rousseau als "Vorläufer Hitlers" charakterisierte. Die Philosophen Karl Popper und Isaiah Berlin sowie der Ökonom Friedrich Hayek lehnten Rousseau ebenso ab, während der Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls, der Sozialphilosoph Jürgen Habermas und viele Kommunitaristen sich durchaus positiv auf ihn beziehen.
Voltaires Satz vom Gras begründete eine wunderbare Feindschaft. Rousseau, der Aufklärer, kritisierte 200 Jahre vor Adorno und Horkheimer die Dialektik der Aufklärung und setzte sich in Gegensatz, ja Feindschaft zu den Enzyklopädisten um Diderot und D'Alembert. In seiner Einleitung zur Enzyklopädie erwähnt D'Alembert Rousseau zu Reklamezwecken (dieser steuerte Artikel über Musik und Ökonomie bei), 180 Seiten später meint er, Rousseaus Kritik an den Enzyklopädisten scheine durch dessen "eifrige und erfolgreiche Mitarbeit" widerlegt.
Revolutionär und Reaktionär
Solches Maßhalten in der Polemik war selten. Denis Diderot, einst Rousseaus bester Freund, sagte am Ende nur noch: "Dieser Mensch erfüllt mich mit Unruhe; in seiner Gegenwart ist es mir, als stünde eine verdammte Seele neben mir. Ich will ihn nie wiedersehen; er könnte mich an Hölle und Teufel glauben machen." Der von Paranoia geplagte Jean-Jacques peinigte seine Gönner und Freunde. David Hume, der gutmütige englische Aufklärer, gab nichts auf die Warnungen der Enzyklopädisten, verhalf Rousseau zur Flucht nach England, zerkrachte sich dort aber spektakulär mit ihm und nannte ihn ein "Ungeheuer" und "den gefährlichsten Menschen auf Erden".
Rousseaus Paranoia war nicht nur gefühlt. Seine Bücher wurden verboten, er selbst wurde Frankreichs und der Schweiz verwiesen. In einem Schweizer Dorf kleidete er sich in armenische Tracht mit Pelzmütze und versuchte, seinen Lebensunterhalt mit textiler Heimarbeit zu verdienen. Die Schweizer Bevölkerung, aufgehetzt vom Klerus, bewarf ihn, seine Frau und sein Haus mit Steinen.
Rousseau war Revolutionär und Reaktionär, Aufklärer und Aufklärungsgegner, aber kein "Gegenaufklärer". Als solchen bezeichnet ihn Philipp Blom in seinem wichtigen Buch über die Enzyklopädisten, in dem Rousseau gar nicht gut wegkommt. Wie sollen wir uns diesem verwirrenden und verwirrten Philosophen nähern? Es gibt keine Einführung zu Rousseau, die unsere Verwirrung mildert. Man sollte sich also zuerst von den Originaltexten Rousseaus verwirren lassen. Das macht Freude: So fantastisch bizarr sein Leben, so vielfältig sein Werk und so gewaltig seine Wirkung, so unvergleichlich ist seine Sprache.
Wie man lesen soll
In seinen wirkungsmächtigsten Schriften, dem "Émile", der "Neuen Heloise", dem "Gesellschaftsvertrag", gelingt es Rousseau, "die offenen Herzen der Gebildeten, besonders der Frauen und zwar der vornehmsten" zu treffen, wie Jacob Burckhart anmerkt. Am besten beginnt man aber mit einem anderen literarischen Werk, mit den "Bekenntnissen", und einem philosophischen, dem "Diskurs über die Ungleichheit".
Die einführende Literatur ergibt sich dabei von selbst. Heinrich Meier, dem konservativen Flügel der Rousseau-Interpreten angehörend, zeigt in seiner Einleitung zum "Diskurs", wie klassisch-rhetorisch Rousseau bei aller Modernität seines Stils vorgeht. Meier weist auch darauf hin, dass in Zeiten von Absolutismus und Zensur nicht alles wörtlich genommen werden darf. Ein Bekenntnis zu Gott stellt ebenso eine Absicherung gegen die Kirche dar wie ein Zeichen des Glaubens.
Viel schwerer lesbar, auch aufgrund der unübersetzten Originalzitate, ist Meiers heuer erschienenes Buch über Rousseaus Spätwerk "Träumereien eines einsamen Spaziergängers", laut Robert Spaemann "eines der ergreifendsten Bücher der Neuzeit".
Die "Bekenntnisse" sind frappierend subjektiv – penetrant selbstrechtfertigend und mitleidlos selbstanklagend in einem. "Ich plane ein Unternehmen, das kein Vorbild hat und dessen Ausführung auch niemals einen Nachahmer finden wird. Ich will vor meinesgleichen einen Menschen in aller Wahrheit der Natur zeigen, und dieser Mensch werde ich sein." Rousseaus erste Sätze sind Paukenschläge, wie jener aus dem "Gesellschaftsvertrag": "Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten."
In den "Bekenntnissen" verteidigt sich Rousseau gegen die "Philosophes", die Enzyklopädisten um seinen ehemaligen Freund Diderot. Aber auch gegen einen ihn verfolgenden Feind, den Rousseau nicht kennt und der sich hinter einem schwarzen Schleier verbirgt. Mit seiner Paranoia setzt sich Rousseau ebenso offen auseinander wie mit allen seinen persönlichen Problemen.
Der Schweizer Literaturkritiker Jean Starobinski hat die nach wie vor beste Werkbiografie zu Rousseau geschrieben und sieht diesen zwischen zwei Extremen: zwischen "einem Raum ohne Hindernisse und Hindernissen, welche den gesamten Horizont verschließen, sodass hinter ihnen kein Raum mehr bleibt (
) Rousseau bewohnt abwechselnd eine unendlich offene Welt und ein hermetisch abgeschlossenes Gefängnis."
Theoretiker des Intimen
Rousseau gab alle fünf Kinder, die er mit der ihm in keiner Weise ebenbürtigen Thérèse Levasseur gezeugt hatte, gegen den Willen der Mutter ins Findelhaus. Er notierte sich nicht einmal deren Geburtstage, obwohl adelige Gönnerinnen bereit gewesen wären, sich um die Kinder zu kümmern. Sie hätten ihn am Schreiben und Denken gehindert, sagte Rousseau, und die herrschende Klasse habe ihm die Möglichkeit genommen, sie seinen Vorstellungen gemäß zu erziehen.
Es war gängige Praxis, sich auf diese Weise des lästigen Nachwuchses zu entledigen. Aber durfte das auch der emotionalste und individuellste aller Philosophen tun? Voltaire deckte die Affäre in einem anonymen Pamphlet auf. Worauf Rousseau sein gesamtes Werk gefährdet sah: War die Person diskreditiert, dann waren auch das sensationelle Erziehungsbuch "Émile" und die "Diskurse" entwertet, die auf persönlichen Erfahrungen und Erleuchtungen aufgebaut waren.
Rousseaus "Bekenntnisse" sind die faszinierende Gegenoffensive. Selbstentblößung als Attacke. Hannah Arendt nannte Rousseau den "ersten bewussten Entdecker und gewissermaßen auch Theoretiker des Intimen". Er erzählt alles. Als Knabe hatte er ein Band gestohlen und ein Dienstmädchen des Diebstahls bezichtigt: Lebenslang fühlte er sich schuldig. Ein anderes Mal war er für etwas gezüchtigt worden, was er nicht begangen hatte: Die Lust, als ihm der Hintern versohlt wurde, blieb ihm.
Seinen Masochismus lebte er nur als Masturbationsfantasie aus, oder indem er eine Zeitlang vor Frauen seinen Hintern entblößte. Sein Penis hatte eine merkwürdige Sichelform, Harnröhren- und Blasenentzündungen plagten ihn. Eigens ließ er sich Katheter anfertigen, um damit in sich herumzustochern, was sein Leiden gewiss nicht linderte. Eine ihm angebotene Stelle als Hofkomponist (ja, er komponierte auch und zwar durchaus erfolgreich) schlug er aus, weil er alle halbe Stunden Wasser lassen musste. Eine Obduktion ergab im Übrigen keine physischen Anomalien.
Das ist schwer erträglich, aber großartig geschrieben, immer mit dem Gestus des Autors Jean-Jacques, der sein Ich gegen die Kunstfertigkeit verteidigt, weil er diese als Wurzel allen Übels betrachtet: Die Zivilisation befördert nicht den Fortschritt der Humanität, sondern gefährdet diese.
Unverstanden von den Pflanzen
Wer Rousseaus Widersprüche jenseits von Paranoia und Blasenschwäche nüchtern aufgedröselt haben will, wird sich an Günther Mensching halten, der meint, Rousseau habe "der modernen Tendenz, Herrschaft als persönliche Abhängigkeit abzuschaffen und zugleich neue Herrschaft rational zu begründen, den ihr angemessenen, nämlich widersprüchlichen Ausdruck verliehen".
Als Einführung in Rousseau hilfreich sind aber auch Kurzkapitel biografisch orientierter Darstellungen wie jenes aus Nigel Rodgers' und Mel Thompsons "Philosophen wie wir" oder Jakob Burckhardts Vorlesungen über das Zeitalter Friedrichs des Großen, der Jean-Jacques Asyl anbot. Den neuen Freiheitsbegriff des großen Genfers wiederum bringt Wilhelm Weischedel auf den Punkt: "Rousseau betont (
) das Wozu der Freiheit: dass sie das Element der Willkür abstreife und sich an ein Gesetz binde (
) darum kann etwa Kant sagen, er sei durch ihn ,zurechtgebracht' worden." In Kants Zimmer hing als einziges Porträt jenes von Rousseau.
Hat man einmal dessen "Bekenntnisse" (nur 900 Seiten!) gelesen, wird man auch Vergnügen aus einer vor längerer Zeit erschienenen literarischen Paraphrase des deutschen Schriftstellers Ludwig Harig ziehen, einem sympathisierend-kritischen Roman-Echo auf Rousseaus Leben: "Er liebt die Botanik, aber er hasst die Anthropologie. Die Pflanzen haben ihn nicht verstanden, und die Menschen haben ihn missverstanden, warum soll er noch weitergehen?"
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: