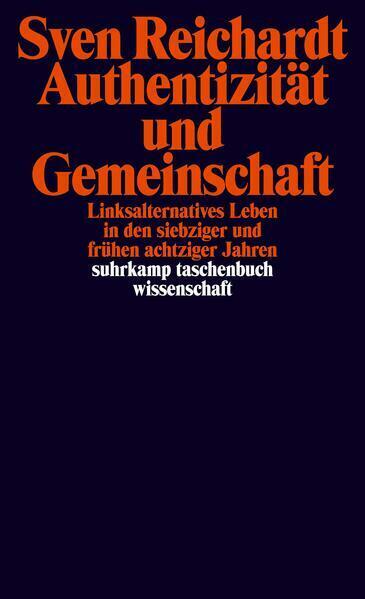Die abgesagte Katastrophe
Kirstin Breitenfellner in FALTER 15/2016 vom 13.04.2016 (S. 26)
Unsere Zukunft war vorbei, bevor sie begonnen hatte. Als am 26. April 1986, einem Samstag, Reaktor vier im sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl explodierte, waren wir schockiert und fühlten uns bestätigt – eine paradoxe Mischung aus Bedrohungsgefühl und Befriedigung. Wir, das waren die linksalternativen Jugendlichen, die das, was gerade geschehen war, am meisten gefürchtet hatten.
Die erwartete Katastrophe
Freilich hatten wir, so wie der Rest der Welt, von der Katastrophe erst zwei Tage später erfahren, als im über 1200 Kilometer entfernten Kernkraftwerk Forsmark in Schweden der Alarm losging. Aufgrund des Ostwinds richtete sich der Verdacht gegen die Sowjetunion, die erst in den Abendstunden eine Beschädigung des Reaktors zugab. Genaueres wusste man aber auch einen Tag später noch nicht, als die USA bereits den größten anzunehmenden Unfall (GAU), das Schmelzen des Kerns, vermuteten.
Der Super-GAU von Tschernobyl war ein Epochenmarker, ähnlich den Terroranschlägen von 9/11, bei dem alle damals über 16-Jährigen sich erinnern können, wo sie sich befanden, als sie von dem Ereignis erfuhren.
Denn 1986 schmolz nicht nur der Reaktorkern und setzte die Spaltprodukte Strontium-90, Jod-131 und Caesium-137 frei, von denen Letzteres aufgrund einer Halbwertszeit von 30 Jahren bis heute aktiv ist.
Damals schmolzen auch die Hoffnungen der Jugend auf den jungen, charismatischen Generalsekretär der KPdSU Michail Gorbatschow, der mit seiner Glasnost und Perestroika zum Aufbruch geblasen hatte und sich nun als Beton-Kommunist alter Schule erwies. Es begann mit besagter Nichtinformationspolitik und endete in einem zynisch wirkenden Krisenmanagement, das etwa eine halbe Million sogenannte Liquidatoren mit Besen und Schaufeln zum „Aufräumen“ in die Todeszone schickte.
Mit dem Reaktor von Tschernobyl explodierten sowohl die Hoffnungen derer, die immer behauptet hatten, es bestehe keine Gefahr – natürlich gab es auch einige, die weiterhin glaubten, „bei uns“ könne so etwas nicht passieren –, als auch derer, die es immer schon gewusst oder zumindest prophezeit hatten.
Kalter Krieg und Blockdenken
Ob man zuvor gegen das Atomkraftwerk Biblis und den Nato-Doppelbeschluss von 1979, die als „Nachrüstung“ verharmloste Aufrüstung mit atomaren Waffen wie Pershing II, oder in der Hainburger Au demonstriert hatte, war einerlei. Die Anhänger der Friedens- und Ökobewegung hatten Recht bekommen, aber es war alles andere als ein Triumph.
Die 1980er-Jahre waren geprägt von Kaltem Krieg und Blockdenken. Es wurde aufgerüstet. Osten und Westen, Gleichheit und Freiheit standen einander unversöhnlich gegenüber. Gemeinsam war ihnen der Glaube an Wachstum und Fortschritt.
Innerhalb der westeuropäischen Jugend standen sich ebenso unversöhnlich Popper und Freaks gegenüber. Die einen trugen Kurzhaar mit üppigem Seitenscheitel, V-Pullover und studierten Wirtschaft, die anderen engagierten sich in der Friedensbewegung oder wollten ganz aussteigen, zurück zur Natur. Hatte der politische Teil der 68er sich noch mit Theorie gerüstet, um, notfalls mit Gewalt, die Welt zu verändern, wurde nun ein trotziger Hedonismus gelebt.
Statt Systemumsturz stand Selbstverbesserung auf der Tagesordnung, flankiert von Gleichgesinnten. „Authentizität und Gemeinschaft“ lautet der dazu passende Titel der vor zwei Jahren erschienenen Studie von Sven Reichardt zum linksalternativen Milieu der 1970er- und frühen 1980er-Jahre.
Damals war man gerne authentisch und betroffen. Oder man fuhr voll auf etwas ab. Auf jeden Fall aber brachte man sich ein. Und jeder war aufgefordert, spontan zu sein. Es ging darum, bei sich selbst zu beginnen: Plastik gegen Jute, Fleisch gegen Dinkellaibchen, das Auto gegen das Fahrrad auszutauschen.
No Future
Der Optimismus der Wiederaufbaujahre und das Fest der Revolution waren vorbei. Wir waren die erste Generation, die keine Zukunft hatte. Das bezog sich sowohl auf den Arbeitsmarkt, der gesättigt zu sein schien, und den Fortschritt, der sich einbremste, als auch auf das – wie es uns damals schien – nackte Überleben.
In einer Zeit von beispiellosem Frieden und Wohlstand, wie unsere Eltern, selbst Kriegskinder, nicht müde wurden zu versichern, fühlten wir uns bedroht.
Denn der Wald war krank. Das sah man zwar nicht, aber das konnte man mit harten Fakten untermauern: „Der Wald stirbt. Saurer Regen über Deutschland“ titelte der Spiegel am 16. November 1981 zum Auftakt einer dreiteiligen Serie, in der die Experten – von Europa bis Nordamerika und Japan – sich einig waren, dass das Waldsterben die gesamte nördliche Hemisphäre betraf – die „gigantischste Umweltkatastrophe, die es je gab“.
Erstmalig wurde vom „Zusammenbruch des gesamten Ökosystems“ gesprochen. Saurer Regen hieß laut Spiegel die „satanische Substanz“, die daran schuld war. Die ersten großen Wälder würden schon in fünf Jahren sterben, hieß es. Und: „Im Jahr 2000 werden wir keine Straßenbäume mehr in den Städten haben.“
Bereits 1983 kam der nächste Schlag: Eine halbe Generation nach der sexuellen Befreiung war es vorbei mit der wilden Liebe. Die Seuche Aids stand am Horizont. „Make Love, Not War“ wurde heruntergebrochen auf „Petting statt Pershing“. Ein Jahr später tat sich das sogenannte Ozonloch im Himmel auf, durch das die Sonne ungefiltert auf unsere Haut brannte.
Das bleierne Jahrzehnt
Wir begannen, uns mit Sonnencreme zu schützen, nicht nur im Urlaub im Süden. Wir waren nicht mehr immun gegen Kritik, so wie die Generation davor, die wütenden, aber auch selbstgerechten 68er, von denen wir Nachkommende als brav und angepasst beschimpft wurden.
Dabei hatten sie nichts übrig gelassen, gegen das man noch protestieren konnte, ohne zum Nachahmer zu werden.
Wir lasen zum ersten Mal Zeitung, als der Wald zu sterben begann, wir hatten zum ersten Mal Sex, als Aids sich ausbreitete, und als wir mit der Schule fertig waren, ging Tschernobyl in die Luft.
Es spielte die Achtzigerjahre, das Jahrzehnt, in dem die Zeit und die Herzen stillstanden, weil die Fronten eingefroren zu sein schienen, und von dem niemand ahnte, dass es so kurz werden sollte. Wir fühlten uns, als würden wir gegen Mauern rennen, und wunderten uns, als 1989 plötzlich die wirkliche Mauer fiel.
Erst langsam wird diese bleierne Zeit aufgearbeitet. Das mag damit zusammenhängen, dass die 1960er- und 1970er-Jahre zur Genüge durchgekaut sind, aber auch damit, dass die Jugendlichen der 1980er, die Babyboomer, langsam in die Jahre kommen und sich an ihre Jugend zurückerinnern.
Auch das Fernsehen beginnt diese Lücke zu entdecken. Im Herbst letzten Jahres lief auf RTL die vielgelobte achtteilige Serie „Deutschland 83“ über den heißen Herbst, in dem eine Nato-Übung von den Sowjets für eine Vorbereitung eines geplanten Angriffs gehalten wurde und die Welt einem Atomkrieg so nahe war wie kaum je zuvor. Im gleichen Jahr hielten übrigens die Grünen Einzug in den deutschen Bundestag.
Die Stunde der Apokalyptiker
Die 1980er-Jahre waren eine Hochzeit für Apokalyptiker, die die Welt am Rande des Untergangs sahen, Survival-Guides hatten Hochkonjunktur (siehe Rezensionen Kasten unten). Und Mahner wie der deutsche Wissenschaftsvermittler Hoimar von Ditfurth, dessen Tochter Jutta Protagonistin der bundesdeutschen Grünen war, landeten Bestseller.
„So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit“ lautete der Titel seines Buchs von 1985, laut dem der Untergang der Menschheit durch Umweltzerstörung, Überbevölkerung und/oder einen „nuklearen Holocaust“ unmittelbar bevorstand.
Der Zukunftsforscher und spätere österreichische Präsidentschaftskandidat Robert Jungk – einer der Redner während des heißen Herbstes 1983 auf der Großdemonstration im Bonner Hofgarten – hatte mit seinem gleichnamigen Buch von 1977 den Begriff des „Atomstaats“ geprägt und vor den Gefahren der Endlagerung und eines terroristischen Zugriffs auf atomares Material oder Anschlägen auf Kraftwerke gewarnt, sowie davor, dass diese Umstände dafür herhalten könnten, unbeteiligte Bürger sicherheitshalber zu überwachen.
Die Bedrohungen der 1980er-Jahre waren unsichtbar: Baumskelette sah man höchstens im Fernsehen, sie standen im tschechischen Fichtelgebirge. Dass jemand Aids hatte, konnte man erst sehen, wenn es zu spät war – denn damals gab es noch keine Heilung. Und das Ozonloch und die Strahlenbelastung von Tschernobyl konnte man erst recht nicht mit den Sinnen wahrnehmen. Wahrscheinlich verbreiteten sie auch deswegen so viel Angst und machten anfällig für die Prophezeiungen der Apokalyptiker. Aber, so verteidigte sich Hoimar von Ditfurth gegen den Vorwurf, der jungen Generation jede Zukunftshoffnung zu nehmen, die Zeit sei sowieso von Angst geprägt – und es sei eher zu befürchten, dass sich die Menschen vor den falschen Problemen ängstigten. Trotzdem haben die dunklen Propheten nicht Recht behalten.
Klimawandel und Fukushima
Im Gegenteil: Die „Kassandra“ des Waldsterbens der 1980er-Jahre, der Professor für forstliche Bodenkunde und Waldernährung in Göttingen Bernd Ulrich, betont in der Spiegel-Recherche „Was wurde eigentlich aus dem Waldsterben“ vom Jänner 2015, dass die Diskussion um das Waldsterben zur Entstehung eines breiten ökologischen Bewusstseins beitrug.
Die Bedrohung des Waldes einte die deutschsprachigen Nachkriegsgesellschaften wie kein Thema zuvor. Nationalisten und Revoluzzer hatten plötzlich ein gemeinsames Ziel. Verschärfte Emissionsbestimmungen und Katalysatoren bewirkten, dass die Belastung mit Schwefeldioxid dramatisch zurückging. Mit positiven Folgen: Der Wald lebt und wächst sogar. In vielen Flüssen kann man wieder baden.
Stattdessen erschien eine neue Katastrophe am Horizont. 1986, das Jahr der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, war gleichzeitig das Jahr des losbrechenden Klimaalarms: Nun war nicht mehr nur der europäische Wald, sondern der Regenwald bedroht und erregte internationale Aufmerksamkeit.
Vermutlich vermögen der Klimaalarm und die Reaktorkatastrophe von Fukushima vom 11. März 2011 die heutige Jugend genauso zu verunsichern und zu verängstigen wie Waldsterben und Tschernobyl jene der 1980er-Jahre. Auch die heutige Jugend scheint, etwa hinsichtlich Arbeitsmarkt und Pensionsentwicklung, aber auch was die Ökologie betrifft, auf No Future gebucht, ohne vorher gefragt worden zu sein. Was kann man ihnen mitgeben?
Schule der Angst?
Die Prognosen von damals sind nicht eingetroffen – zumindest nicht so, wie befürchtet. Das ist die gute Nachricht. Von den neuen Katastrophen wissen wir noch nicht genau, ob, wie und wann sie schlagend werden. Deswegen ist Resignation das schlechteste Mittel.
Wer sich zu Tode fürchtet, ist auch gestorben, lautet eine Volksweisheit. Aber Angst ist überlebensnotwendig. Wer keine Angst hat, übersieht Gefahren. Wer der Wahrheit ins Gesicht sieht und scheinbare Gewissheiten hinterfragt, hat die Chance, aktiv zu werden und etwas zu verändern.
Engagement bewirkt nicht nur eine Minderung von Ohnmachtsgefühlen, sondern kann, wie die Erfahrung lehrt, auch angesagte Apokalypsen verhindern.
Hedonismus und Innerlichkeit
Kirstin Breitenfellner in FALTER 15/2015 vom 08.04.2015 (S. 19)
Die Ideen und Lebenskonzepte des linksalternativen Milieus der 1970er- und 1980er-Jahre haben die Gesellschaft verändert. Dazu gehören nicht nur Pazifismus, Umweltorientierung und die Ablehnung der Atomenergie, sondern auch ein neuer Hedonismus. Reichardt lässt die Werthaltungen, Symbole und Lebensweisen einer ganzen Generation Revue passieren: von der neuen Innerlichkeit, ausgelebt in Wohngemeinschaften, über die „Gegenöffentlichkeit“ alternativer Zeitungen bis zu neuen Arbeits-, und Erziehungsmodellen, untermauert von statistischem Material. Ein Standardwerk.