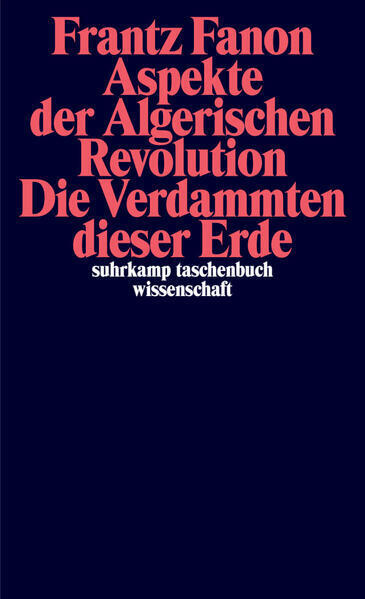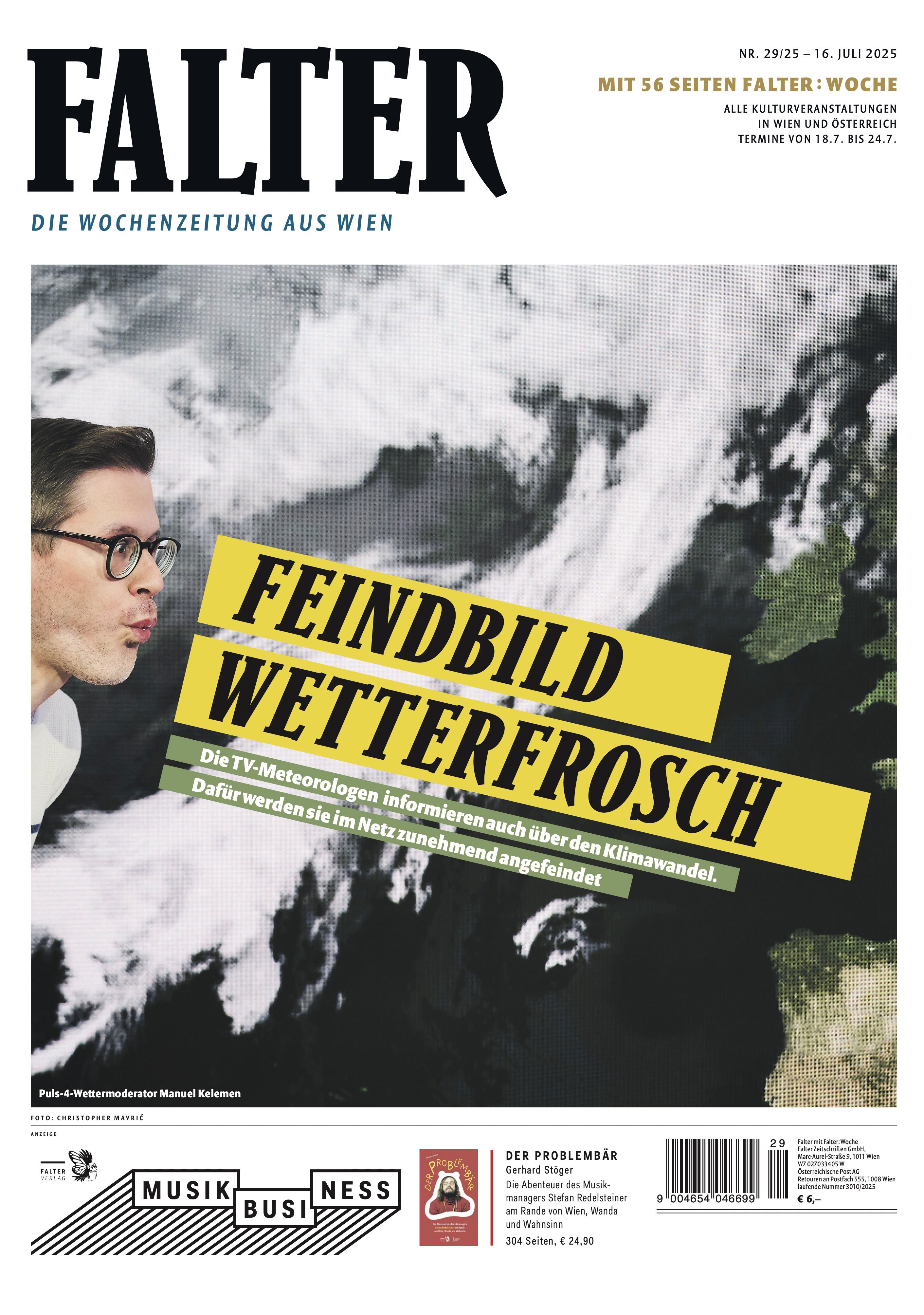
Der Anti-Gandhi
Klaus Nüchtern in FALTER 29/2025 vom 16.07.2025 (S. 24)
Als am 7. Oktober 2023 Mörderbanden der Hamas auf israelisches Staatsgebiet vordrangen und über 700 Zivilisten massakrierten, reagierten viele darauf mit unverhohlener Genugtuung. "Was habt ihr denn geglaubt, was Dekolonisierung bedeutet?", höhnte etwa die somalischamerikanische Publizistin Najma Sharif. "Vibes? Referate? Aufsätze? Ihr seid solche Loser."
Mit der zynischen Umdeutung sadistischer Grausamkeit zu einem heroischen Akt des Antiimperialismus geriet auch ein Name wieder verstärkt in Umlauf, der seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts mit dem Kampf gegen Rassismus und Kolonialismus so eng verbunden ist wie kaum ein anderer: Frantz Fanon.
Der Onlinedienst Google Trend, der eine statistische Auswertung der auf Google eingegebenen Suchanfragen bereitstellt, verzeichnete zu diesem Zeitpunkt die höchste Aufrufrate weltweit seit dem Dezember 2011 und dem Juni 2020.
Der Ausschlag in den genannten Monaten ist leicht zu erklären: am 6. Dezember 2011 jährte sich der Todestag Fanons zum 50. Mal; und am 6. Juni 2020 hatten weltweit über eine halbe Million Menschen im Rahmen der Black-Lives-Matter-Bewegung gegen die Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten in Minneapolis protestiert.
Obwohl sich Fanon zur Palästinafrage nie geäußert hatte, war es wohl unvermeidlich, dass er und sein Schaffen auch im Kontext des Hamas-Massakers und des darauf folgenden Gaza-Krieges wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten würde. Denn niemand hat sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so entschieden und einflussreich mit der Legitimität, ja Notwendigkeit von Gewalt im Kampf gegen Unterdrückung auseinandergesetzt wie der aus der Karibik stammende Nachfahre schwarzer Sklaven, der sich in den letzten Jahren seines kurzen Lebens ganz in den Dienst des Unabhängigkeitsstrebens seiner Wahlheimat Algerien vom französischen Mutterland gestellt hatte.
"Von der Gewalt" handelt denn auch dezidiert das erste Kapitel seines bekanntesten Werkes, "Die Verdammten dieser Erde", erschienen im französischen Original nur wenige Tage bevor Fanon an den Folgen einer spät entdeckten Leukämieerkankung in einem Spital ausgerechnet im "Land der Lynchmörder", den USA, im Alter von 37 Jahren verstarb.
Die kolonisierten Massen, heißt es dort, begriffen intuitiv, "dass ihre Befreiung durch Gewalt geschehen muss und nur durch sie geschehen kann". Als spiegelbildliche Antwort auf die jahrhundertelange Unterdrückung und Entwürdigung sei diese Gewalt aber nicht nur legitime Strategie, sondern ganz grundsätzlich Quelle der Lebensenergie, Handlungsmacht und Einheit des revoltierenden Volkes, die nur "aus der verwesenden Leiche des Kolonialherren" entstehen könne. Aber nicht nur das Kollektiv sei auf Gewalt angewiesen, auch das Individuum ziehe aus ihr gleichsam therapeutischen Gewinn: "Auf der individuellen Ebene wirkt die Gewalt entgiftend. Sie befreit den Kolonisierten von seinem Minderwertigkeitskomplex [ ]. Sie macht ihn furchtlos, rehabilitiert ihn in seinen eigenen Augen."
Fanon selbst stammte aus Martinique, einer Insel der Kleinen Antillen, die 1653 von Frankreich kolonisiert, wiederholt von den Briten besetzt worden, letztendlich aber als Übersee-Département unter französischer Herrschaft verblieben war. Als fünftes von acht Kindern eines Zollinspektors und einer Geschäftsbesitzerin war Frantz Omar Fanon in gutbürgerlichen Verhältnissen mit Bediensteten, Klavierunterricht und Wochenendhaus aufgewachsen. Die Geschichte der Kolonisierung steckte ihm, dessen weiße Vorfahren mütterlicherseits im 17. Jahrhundert vor religiöser Verfolgung aus Österreich ins Elsass ausgewandert waren, dennoch in den Knochen. Nominell französischer Staatsangehöriger, seiner dunklen Hautfarbe wegen aber de facto Bürger zweiter Klasse, wird ihm im Schulunterricht eingetrichtert, von "unseren Vätern, den Galliern" abzustammen. "Je suis français" lautete der erste Satz, den er zu buchstabieren lernte.
Die Besetzung Frankreichs durch Nazi-Deutschland führt zur Errichtung des kollaborativen Vichy-Regimes unter Marschall Pétain. Der Krieg, so meint ein Lehrer am Lycée Schoelcher, das Fanon besucht und an dem auch der spätere Schriftsteller und Politiker Aimé Césaire Philosophie unterrichtet, sei allein Angelegenheit der Weißen, die sich ruhig gegenseitig erschießen mögen. Fanon indes erhebt Einspruch: Werde die Würde des Menschen bedroht, so gehe das alle an. Gerade einmal 17 Jahre alt, meldet er sich zu einer auf der britischen Nachbarinsel Dominica stationierten Einheit der Forces françaises libres (FFL).
Es ist freilich eine Schule der Enttäuschung, die Fanon in der Folge durchmachen muss. Die Armee, die gegen das Nazi-Regime kämpft, erweist sich selbst als durch und durch rassifiziert. Am unteren Ende der Hierarchie stehen die Tirailleurs sénégalais, die Senegalschützen. Fanon selbst steht als französischer, christlicher Antillaner über ihnen und den Arabern aus Nordafrika, ist aber gerade deswegen desillusioniert. Im Elsass durch einen Granatsplitter schwer verletzt, schreibt er seinen Eltern, dass er im Falle seines Todes keinesfalls "für eine gerechte Sache" gestorben sein würde: "Ich habe mich geirrt."
Nach der Befreiung findet sich keine weiße Französin, die bereit ist, mit Fanon zu tanzen. Und die Kette der Kränkungen reißt nicht ab. Als er nach seiner Rückkehr nach Martinique, wo er die Schule abschließt, in Lyon Medizin und Philosophie studiert, zeigt ein kleiner Bub halb verängstigt, halb fasziniert mit dem Finger auf ihn und ruft aus: "Mama, ein Neger!" Als die peinlich berührte Mutter ihrem Sohn erklärt, dass er aber doch immerhin schön sein, entgegnet Fanon: "Der schöne Neger scheißt auf Sie, Madame!"
Herablassend für sein gutes Französisch gelobt und von den Mutterlandfranzosen als "Eh einer von uns" behandelt, findet sich Fanon dennoch brutal auf das Faktum seiner Hautfarbe verwiesen - eine Erfahrung, die seiner Schrift "Schwarze Haut, weiße Masken" von 1952 zugrunde liegt.
Bereits 1903 hatte der afroamerikanische Soziologe, Historiker und Bürgerrechtler W.E.B. Du Bois in "The Souls of Black Folk" das Phänomen des "doppelten Bewusstseins" beschrieben, mit dem Schwarze sich selbst immer auch durch die Augen der Weißen wahrnehmen. Fanon, der Du Bois nie gelesen hat, knüpft dennoch an diese Beobachtung an, begreift Stigmatisierung als körperliche Erfahrung.
Die Psychoanalytikerin Alice Cherki, der er die Vorlesungen Freuds und den Bebop Charlie Parkers nahebringt und die ihm später in Algerien als junge Assistenzärztin zur Seite stehen wird, lernt Fanon 1955 auf einer Psychiatriekonferenz kennen und hängt an dessen Lippen: "Als ich ihn reden hörte, vergaß ich, dass er schwarz war", erinnert sie sich. Als sie das Fanon später erzählt, bricht er, der für sein distanziertes, ja verschlossenes Wesen bekannt ist, in Gelächter aus.
Bei seinen Zeitgenossen bleibt "Schwarze Haut, weiße Masken" weitgehend unbeachtet. Heute hingegen ist Fanon, wie der Publizist und US-Redakteur der London Review of Books Adam Shatz in seiner brillanten, soeben auch in deutscher Übersetzung erschienenen Biografie "The Rebel's Clinic" (2024) schreibt, "ein intellektueller Star", der von den gegensätzlichsten Gruppen in Anspruch genommen werde: "von schwarzen Nationalisten und Kosmopoliten, im Panafrikanismus und Panarabismus, von Säkularen und Islamisten, Marxisten und Liberalen, von den Verteidigern der Identitätspolitik gleichermaßen wie von ihren Kritikern".
Was Fanon jedoch von vielen Vertreter:innen der Identitätspolitik unterscheidet, ist, dass er die Ontologisierung der Hautfarbe als übergeschichtliches Wesensmerkmal ablehnt. In "Schwarze Haut, weiße Masken" bestreitet er die Unveränderlichkeit rassifizierter Zuschreibungen - "Der nègre ist nicht. Ebenso wenig der Weiße" - und propagiert die Emanzipation von der Last der Vergangenheit: "Ich bin nicht der Sklave der Versklavung, die meine Väter entmenschlicht hat."
Mit dieser Auffassung opponiert Frantz Fanon auch dem Konzept der Négritude, wie sie von seinem bereits erwähnten Landsmann Aimé Césaire und dem Dichter und ersten Präsidenten Senegals, Léopold Sédar Senghor, vertreten wird. Insbesondere Senghors Auffassung einer spezifischen "schwarzen Vernunft", die stärker intuitiv orientiert und im Einklang mit Natur und Kosmos sei als die analytische der weißen Europäer, lehnt Fanon ab. Zu nahe scheint sie ihm der stereotypen Wahrnehmung Schwarzer als animalische, triebgesteuerte Wesen. Mit pointiertem Spott hatte auch der nigerianische Literaturpreisträger Wole Soyinka die Négritude von sich gewiesen: "Der Tiger proklamiert nicht seine Tigrigkeit. Er springt."
Der kühne identitätspolitische Sprung, den Fanon unternimmt, ist seine Selbsterfindung als Algerier. In dem französischen Protektorat, an dessen Stränden sich damals noch Schilder mit der Aufschrift "Keine Hunde oder Araber" fanden, schlägt sich Fanon bedingungslos auf die Seite der militanten FLN (Front de Libération Nationale), die im Unabhängigkeitskrieg nicht nur das französische Mutterland, sondern auch konkurrierende Befreiungsbewegungen und "Verräter" erbittert bekämpft.
Im psychiatrischen Krankenhaus der nordalgerischen Stadt Blida-Joinville, das er von 1953 bis 1956 leitet, findet er entsetzliche Bedingungen vor (tuberkulöse Schizophrene der haltlos überbelegten Anstalt werden angekettet und auf Strohsäcken gebettet) - und ein Betätigungsfeld für seine radikalen Reformen, die Erkenntnisse und Praktiken der sogenannten "Antipsychiatrie" antizipieren. Elektro-und Insulinschocktherapie sind an der Tagesordnung, daneben aber bemüht sich Fanon, die Insassen durch Arbeitsaufträge sowie das Angebot von Kursen oder die Einrichtung von Cafés ins Alltagsleben der Klinik einzubinden und ein Verständnis für deren soziales und kulturelles Umfeld zu entwickeln.
Im Unterschied zu vielen Kollegen habe Fanon, so konzediert ihm seine Mitarbeiterin und spätere Biografin Alice Cherki, keine Angst vor den "Verrückten" gehabt, die er freilich auch nicht bemitleidet oder romantisiert; ganz im Sinne Freuds geht es ihm lediglich darum, "hysterisches Elend in gemeines Unglück zu verwandeln". Die den Arabern rassistisch attestierten Eigenschaften wie Lethargie, Simulantentum und Verlogenheit versteht Fanon als Symptom der und legitimen Widerstand gegen die Kolonisierung, ihren Schmerz als Protest.
Als im Mai 1958 ein unblutiger Putsch der Algerienfranzosen zum Ende der Vierten Republik führt (und später von Staatspräsident de Gaulle niedergeschlagen wird), kommt es zu einer öffentlichen Zeremonie, in der algerische Frauen ihre Haïks abnehmen und verbrennen. In "Algerien legt den Schleier ab", dem ersten Kapitel seiner "Aspekte der Algerischen Revolution", die soeben gemeinsam mit "Die Verdammten dieser Erde" neu aufgelegt wurden, entlarvt Fanon die Inszenierung als "Spektakel der Zwangsemanzipation" (Shatz) - ganz gemäß des Verdikts der indischen Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak: "Weiße Männer retten braune Frauen vor braunen Männern". Fanon, der beileibe kein Feminist war, schreibt: "Jeder abgelegte Schleier, [ ] jedes Gesicht, das sich dem frechen und ungeduldigen Blick des Okkupanten darbietet, drückt auf negative Weise aus, dass Algerien beginnt, sich zu verleugnen, und dass es die Vergewaltigung durch den Kolonisator hinnimmt."
Mit "Die Verdammten" avanciert Fanon posthum zum Posterboy des Postkolonialismus. Als PR-Agent assistiert ihm dabei niemand Geringerer als Jean-Paul Sartre, Marxist, Existenzialist und international gefeierter Public Intellectual, den der um 20 Jahre Jüngere haltlos adoriert. Das erbetene und prompt gelieferte Vorwort, über welches, wie Skeptiker wiederholt moniert haben, viele vermeintliche "Fanon-Leser" gar nicht hinausgekommen seien, hat das Bild des Autors als Apologet der Gegengewalt von Anfang an zementiert.
In Personalunion von Bußprediger und Flagellant geißelt Sartre den verlogenen Humanismus des Westens und begrüßt die "durch eine blutige Operation" initiierte Ausrottung des Kolonialherrn, "der auch in jedem von uns steckt"."In der ersten Zeit des Aufstands", so dekretiert er, "muss getötet werden: einen Europäer erschlagen heißt zwei Fliegen auf einmal treffen, nämlich gleichzeitig einen Unterdrücker und einen Unterdrückten aus der Welt schaffen. Was übrigbleibt, ist ein toter Mensch und ein freier Mensch."
In Zeiten, in denen die selbstergriffene Zurschaustellung der eigenen White Guilt, der "Weißen Schuld", als politische Haltung durchgeht, feiert das Schema von Ethnizität als Erbsünde Hochkonjunktur: Aufklärung, Universalismus, allgemeine Menschenrechte, Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit -alles nur ein Täuschungsmanöver des westlichen Imperialismus.
Die jüdisch-deutsche Denkerin Hannah Arendt hat darauf hingewiesen, dass "Fanon selbst der Gewalt gegenüber sehr viel mehr Vorbehalte [hatte] als seine Bewunderer". In ihrem Essay "Macht und Gewalt" (1970), in dem sie sich kritisch mit der für die Dritte Welt entflammten Studentenbewegung auseinandersetzt, kritisiert sie sowohl Sartres polemische Zuspitzung als auch Fanons "unverantwortlich großsprecherische Redensarten"."Gewalt", so schreibt sie, "macht Geschichte oder Revolution so wenig wie die Hebamme das Kind erzeugt oder gebiert." Auch der schuldseligen Rhetorik der neuen Linken erteilt Arendt eine Abfuhr: "Nun, wo alle schuldig sind, ist es keiner; gegen die Entdeckung der wirklich Schuldigen [] gibt es keinen besseren Schutz als kollektive Schuldbekenntnisse.,Alle Weißen sind schuldig' ist nicht nur gefährlicher Unsinn, sondern Rassismus mit anderen Vorzeichen".
Geradezu emphatisch hingegen hat der österreichische Widerstandskämpfer und Publizist Jean Améry auf "Die Verdammten der Erde" reagiert. Er erkennt in dem Text einen Akt der Selbstermächtigung Fanons, der nun nicht mehr als "Opfer" auftrete wie noch zehn Jahre zuvor, sondern als "Inquisitor". Zudem entspreche "die gelebte Erfahrung der Schwarzen", wie sie Fanon darin beschrieben hat, seinen "eigenen, prägenden und unverlierbaren Erlebnissen [ ] als jüdischer KZ-Häftling".
In "Die Geburt des Menschen aus dem Geiste der Violenz"(1968) stellt Améry in Aussicht, dass die "revolutionäre Violenz", als die er sie prätentiös latinisierend bezeichnet, "am Ende doch zur Erfüllung ihrer humanen Aufgabe gelangt". Kurz nach diesem Loblied auf den "Revolutionär Frantz Fanon" hat Améry freilich eine, erst im Vorjahr neu aufgelegte, Reihe von Essays veröffentlicht, in der er mit dem als "Israel-Kritik" camouflierten Antisemitismus der Neuen Linken hart ins Gericht geht.
Angesichts der Ereignisse vom 7. Oktober hätte Améry, der 1978 freiwillig aus dem Leben schied, seinen Fanon vermutlich anders gelesen. Dessen Biograf Adam Shatz drückt sich um die Frage, wie Fanon selbst den Überfall der Hamas bewertet hätte, nicht herum und gelangt zu der vorsichtigen, aber verstörenden Auffassung, dass er "die Anfangsphase der ,Operation al-Aqsa-Flut' - den Angriff auf israelische Kasernen - möglicherweise gebilligt [hätte]". Shatz erinnert an Fanons tendenziöse Vorstellung von Ethik, die im Kolonialkrieg einzig Geltung beanspruche: "Das Gute ist ganz einfach das, was ihnen schadet."
Zugleich zitiert er freilich auch eine Passage aus "Die Verdammten", bis zu der viele Fanon-Fans wohl nie vorgedrungen sind. In ihr heißt es, dass die "nie endenden Übergriffe der kolonialistischen Streitkräfte" dem Militanten stets neue Gründe lieferten, "sich auf die Suche nach dem Kolonialherrn zu machen, um ihn zu erschlagen. Aber der Führer des Aufstands erkennt täglich mehr, dass der Hass allein kein Programm liefern kann."
Sich mit Leben und Werk des Anti-Gandhi Frantz Fanon auseinanderzusetzen ist auch heute noch eine lohnende Aufgabe -und ein echter Härtetest für Ambiguitätstoleranz.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: