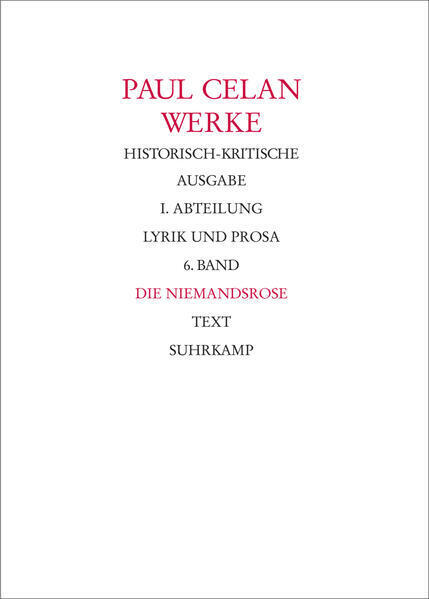Erich Klein in FALTER 6/2002 vom 06.02.2002 (S. 61)
Zuletzt schickt er an seine Frau vorwiegend sein "tägliches Gedicht". Der Kontext ist atemberaubend. "Ich habe keinen Menschen so geliebt, wie ich Dich geliebt habe, wie ich Dich liebe", heißt es in einem der letzten Briefe, und zum Abschied:
"Was kann ich Dir schenken? Hier ein Gedicht: Es wird etwas sein, später,
das füllt sich mit mir, und hebt sich an einen
Mund.
Aus dem zerscherbten Wahn stehe ich auf
und seh meiner Hand zu, wie sie
den einen, einzigen Kreis zieht."
Ihre Antwort ("das Gedicht begleitet mich") erreicht ihn nicht mehr: Celan war am Vortag in die Seine gegangen.
Der mustergültig kommentierte Briefwechsel enthält wenige "celanische" Formulierungen. Dafür findet man unbändigen (nicht immer gerechten) Spott, von dem kaum einer der Freunde oder Bekannten ausgeschlossen bleibt. Der Verleger Otto. F. Walter ist ein "linker, katholischer Schweizerkäs", Emile Cioran, dessen "Lehre vom Zerfall" Celan übersetzt hat, ein "Lügner", der seine faschistische Vergangenheit beharrlich verschweigt. Die deutschen Autorenkollegen Grass und Co., die ihn für politische Unterstützungserklärungen in Sachen SPD zu gewinnen suchen, sind für Celan "Linksnibelungen". Die Österreichische Gesellschaft für Literatur nennt er gar eine Ansammlung von "alten Baronessen und Marxisten". Einen anderen, höchst pragmatischen Dichter und Übersetzer Celan lernt man im Briefwechsel mit Hermann Lenz und dessen Frau Hanne kennen. Im schwäbischen Außenseiter der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur findet Celan Ende der Fünfzigerjahre etliche Jahre lang einen Freund, mit dem er die Ablehnung des "modischen Realismus" teilt. Und das, obwohl oder weil er künstlerische Zeitströmungen wie die aufkommende Popkultur genau verfolgt - die Beatles mochte er übrigens nicht. Familiäres wird ebenso ausgetauscht, wie berufliche Probleme abgehandelt werden. Der Briefwechsel endet abrupt, als Hanne Lenz erfährt, dass sich Celan abfällig über einen Roman ihres Mannes geäußert hat, und diesen zurechtweist. Auf ihre wenig später erfolgte Aufforderung, sich öffentlich deutlicher zum ihnen beiden gemeinsamen Judentum zu bekennen, reagiert Celan noch einmal und schreibt keinen weiteren Brief. "Ich bin Jude, zum Vertreter des Judentums fühle ich mich nicht berufen. Judesein ist subjektiv und existenziell." (Ein luzider Essay des Wiener Judaisten Jakob Allerhand zu Celans Judentum - das Beste, was es dazu gibt - ist soeben im Jüdischen Echo erschienen.) Die anfängliche Begeisterung endet im Schweigen. Ähnlich verläuft auch die sechzehn Briefe umfassende Korrespondenz mit Erich Einhorn, dem Jugendfreund aus Czernowitzer Tagen, der vor den heranmarschierenden deutschen Truppen in die Sowjetunion geflohen war. Einhorn und Celan, der sowjetische Besatzungssoldat und der rumänische Flüchtling, trafen vermutlich im Wien des Jahres 1948 noch einmal zusammen, bevor der Eiserne Vorhang weitere Kontakte zwischen West und Ost bis in die Sechzigerjahre unmöglich machte. Celans erster Brief stammt aus 1944: "Lieber Erich! Deine Eltern sind gesund, ich habe mit ihnen gesprochen . Meine Eltern sind von den Deutschen erschossen worden. In Krasnopolsk am Bug. Erich, ach Erich." In den Briefen aus den Sechzigerjahren, als mit der Sowjetunion freier Briefwechsel möglich war, geht es um Geschichte, Politik, Familiäres, Literatur, vor allem um die russische Literatur, die Celan in der Zwischenzeit übersetzt hat: Sergej Jessenin, Alexander Blok und Ossip Mandelstam. Die Begeisterung Celans für alles Russische wirkt grenzenlos, selbst seine Sommerferien plant er in der UdSSR zu verbringen.
Die Korrespondenz endet offenbar wegen einer Lappalie: Einhorn hat Celans geheime Telefonnummer an den österreichischen Altstalinisten und Majakowskij-Übersetzer Hugo Huppert weitergegeben. Celans Russland wird in seinem vierten Gedichtband, "Die Niemandsrose", zum wesentlichen Thema. Etwas Besseres als "Es war Erde in ihnen", "Psalm", "Tübingen, Jänner", "Radix, Matrix", "Und mit dem Buch aus Tarussa" oder "Eine Gauner- und Ganovenweise" hat Celan auch später nicht mehr geschrieben.
"Damals, als es noch Galgen gab,
da, nicht wahr, gab es
ein Oben.
Wo bleibt mein Bart, Wind, wo
mein Judenfleck, wo
mein Bart, den du raufst?
Krumm war der Weg, den ich ging,
krumm war er, ja,
denn, ja, / er war gerade.
Heia."
In der historisch-kritischen Ausgabe ist all das im Prozess seiner Entstehung zu lesen. Lesen!
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: