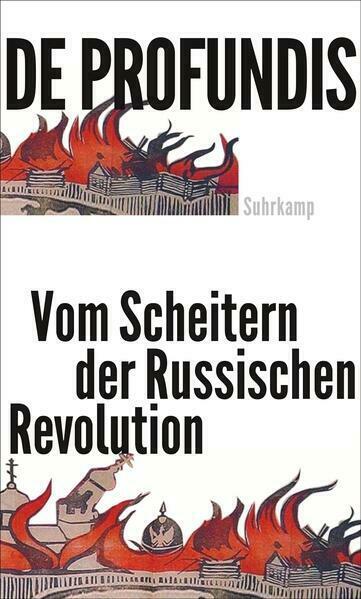Der Ramsch der Sowjetgeschichte
Erich Klein in FALTER 41/2017 vom 11.10.2017 (S. 49)
100 Jahre Russische Revolution: Karl Schlögel liefert eine grandiose Sowjetgeschichte, „De profundis“ Analysen von Zeitzeugen
Am Anfang von Russlands neuer Geschichte stand die Oktoberrevolution, und sie war eine Katastrophe für das Land. Zwar dankte der Zar nach über 300 Jahren Romanow-Herrschaft im Februar 1917 ab, die angekündigte russische Republik scheiterte aber. Im Oktober desselben Jahres triumphierten die Bolschewiki unter Lenin und Trotzki.
Analysen aus dem Abgrund
„Die russische Revolution hat sich als nationaler Bankrott und weltweite Schande erwiesen – das ist die unbestreitbare moralisch-politische Bilanz der Ereignisse, die wir seit dem Februar 1917 erleben.“
Dieser Befund stammt von Pjotr Struve, dem einstigen Mitstreiter von Lenin und späteren Gegner, Herausgeber und interessantestem Autor der Essaysammlung „De profundis“. Zehn russische Professoren, Philosophen und Theologen, fast alle anfänglich linke Intellektuelle, untersuchen zeitnahe die Ursachen jener Apokalypse, die in der bolschewistischen Propaganda zum Beginn einer neuen Ära der befreiten Menschheit erklärt wurde.
Semjon Frank, Sergej Bulgakow und ihre antibolschewistischen Mitstreiter verorten die Gründe in der russischen Geschichte, in mangelnder Bildung, falsch verstandener Religion, in der Verherrlichung des sogenannten „Volkes“ durch die Intelligenzija. Der Philosoph Nikolaj Berdjajew identifiziert die „Geister der Revolution“ in den Werken der russischen Klassiker Nikolai Gogol, Fjodor Dostojewskij und Lew Tolstoi.
Die Autoren von „De profundis“, die Lenin kurz als „Dreck“ tituliert, werden in der Folge verbannt, fliehen in die Emigration, enden im Gulag, einigen gelingt es, in der neuen Bürokratie der Bolschewiki an unauffälligen Stellen unterzutauchen. In den frühen 1920er-Jahren ist der Kampf gegen den Sowjetkommunismus verloren.
Intellektuelle Selbstkritik
Ob dieses imposante Dokument intellektueller Selbstkritik tatsächlich als Flaschenpost für zeitgenössische Leser verstanden werden kann, wie der Osteuropahistoriker Karl Schlögel in seiner Einleitung meint, sei dahingestellt. Dass die Oktoberrevolution einen „Rückfall hinter ein bereits erreichtes Zivilisationsniveau“ darstellt, ist in jeder „normalen“ Geschichte Russlands auch zu lesen.
Und dann stehen da Sätze wie: „Die Revolution wird zum Augenblick der Wahrheit, in dem die sonst verborgenen, tieferen Schichten der ,revolutionären Dämonie‘, des ,maximalistischen Nihilismus‘, der ,sentimentalen Volksanbetung‘ zu Tage treten.“ Im Nachwort schlägt der Schweizer Slawist Ulrich Schmid einen Bogen von den „De profundis“-Autoren bis zu den Vordenkern des heutigen Putin-Russlands, auch wenn es dort mehr um bloßen Machterhalt als um große Geister geht.
Weniger messianisch und apokalyptisch, mit fast gemächlicher Schreibdistanz hebt Karl Schlögel in seinem neuen, nach „Terror und Traum. Moskau 1937“ (2008) schon zweiten Opus maximum, „Das sowjetische Jahrhundert“, an. „Archäologie einer untergangenen Welt“, so der Untertitel des Wälzers, beginnt mit russischen Trödelmärkten Anfang der 1990er-Jahre.
Der Ramsch der Geschichte
Der Ramsch von 74 Jahren Sowjetmacht wurde plötzlich an die Oberfläche gespült, und der Historiker weidet sich an seinen Funden. Beginnend bei der Mythologisierung der Oktoberrevolution in Literatur und Kunst werden Schicht um Schicht die Überbleibsel des sozialistischen Experiments abgetragen.
Tragen die Verherrlicher der roten Barbarei im Kino keinerlei Verantwortung am Terror, nur weil sie eine „avancierte“ Ästhetik erfanden? In einem grandiosen Panorama auszumachen sind: das Leninmausoleum, die Stahlstadt Magnitogorsk im Ural und der Dnepr-Staudamm, die Hölle des Weißmeerkanals und des Gulags an der Kolyma, Stalins Datscha in Sotschi, das Sowjetparadies des Gorkiparks bis zu Chruschtschows Plattenbauten und Breschnews Beriozka-Läden für Privilegierte.
In Schlögels faktenreichem und mäanderndem Essayismus fehlt nichts, was in Russlands Geschichte des 20. Jahrhunderts gut und teuer ist: weder die Eineinhalb-Zimmer-Wohnung des späteren Literaturnobelpreisträgers Jossif Brodskij am Leningrader Litejni Prospekt noch Ilja Kabakows Installation einer Kommunalka aus dem Geist des Konzeptualismus.
Viele dieser „archäologischen“ Funde wie die Jugendstilarchitektur aus Nischni Nowgorod, Odessa und Riga oder die Provinzmuseen im fernöstlichen Magadan sind aus Schlögels früheren Büchern bekannt, bisweilen drängt sich der Eindruck auf, die Artefakte der Katastrophengeschichte des Sowjetimperiums haben letztendlich doch noch ihren guten Platz gefunden, und sei es in einer wohl aufgeräumten Museumsvitrine.
Homer des sowjetischen Traums
So sehr Schlögel seit vielen Jahren immer wieder drauf hinweist, er wolle keinerlei Russland-Exotismus betreiben, für sein Selbstverständnis als Historiker ist eine Bemerkung am Ende des Buchs dennoch höchst aufschlussreich. Der Autor wendet sich gleichsam an seine Leser: „Für Studenten, die schon nach dem Ende der Sowjetunion geboren wurden, war ich, Jahrgang 1948, ein Fossil, ein Mann des 20. Jahrhunderts, eine Art Homer aus längst vergangenen Zeiten, der Interessantes zu erzählen wusste aus einer Welt und einer Zeit, die sie selbst nicht mehr erlebt hatten.“
In anderen Worten: Geschichte ist nicht, wie es tatsächlich einmal war, sondern das, was ich erlebt habe und mich interessiert. Alles klingt sehr klug und gelehrt, aber man wird nicht immer aus allem schlau. In guter deutscher Erinnerungsmanier steht am Ende der Vorschlag, das Hauptquartier des KGB im Zentrum Moskaus in eine Gedenkstätte für die Opfer des Sowjetterrors zu verwandeln. Reicht der Gedenkstein, der sich dort seit 1990 befindet, nicht aus? Muss es immer eine ganze „Topographie des Terrors“ sein?
Nicht weniger wichtige Fragen wie etwa die, warum die Sowjetmacht nur schwer und in einem blutigen Bürgerkrieg zu etablieren war, 74 Jahre später aber geradezu widerstandslos von der Bildfläche verschwand, finden keine eindeutig Antwort. Vielleicht ist für Schlögels erzählerisches Meisterwerk aber auch eine ganz andere Lesart geboten und „Das sowjetische Jahrhundert“ so etwas wie die minutiöse intellektuelle Autobiografie eines Deutschen, der sich den 1960er-Jahren am sozialistischen Traum abarbeitet, ohne je ganz aufwachen zu wollen – auch wenn er weiß, dass Nostalgie nicht angebracht ist. Wer heute noch vom Sozialismus träumt, dem ist ohnehin nicht zu helfen – schon gar nicht in Russland.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: