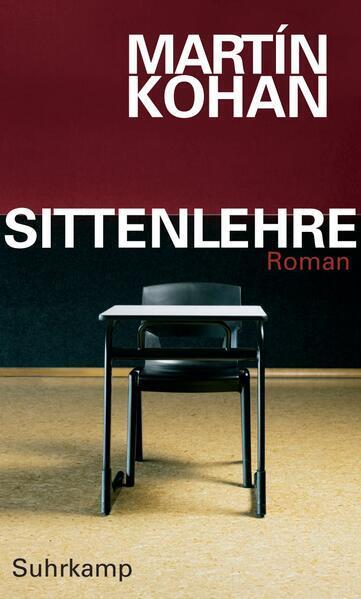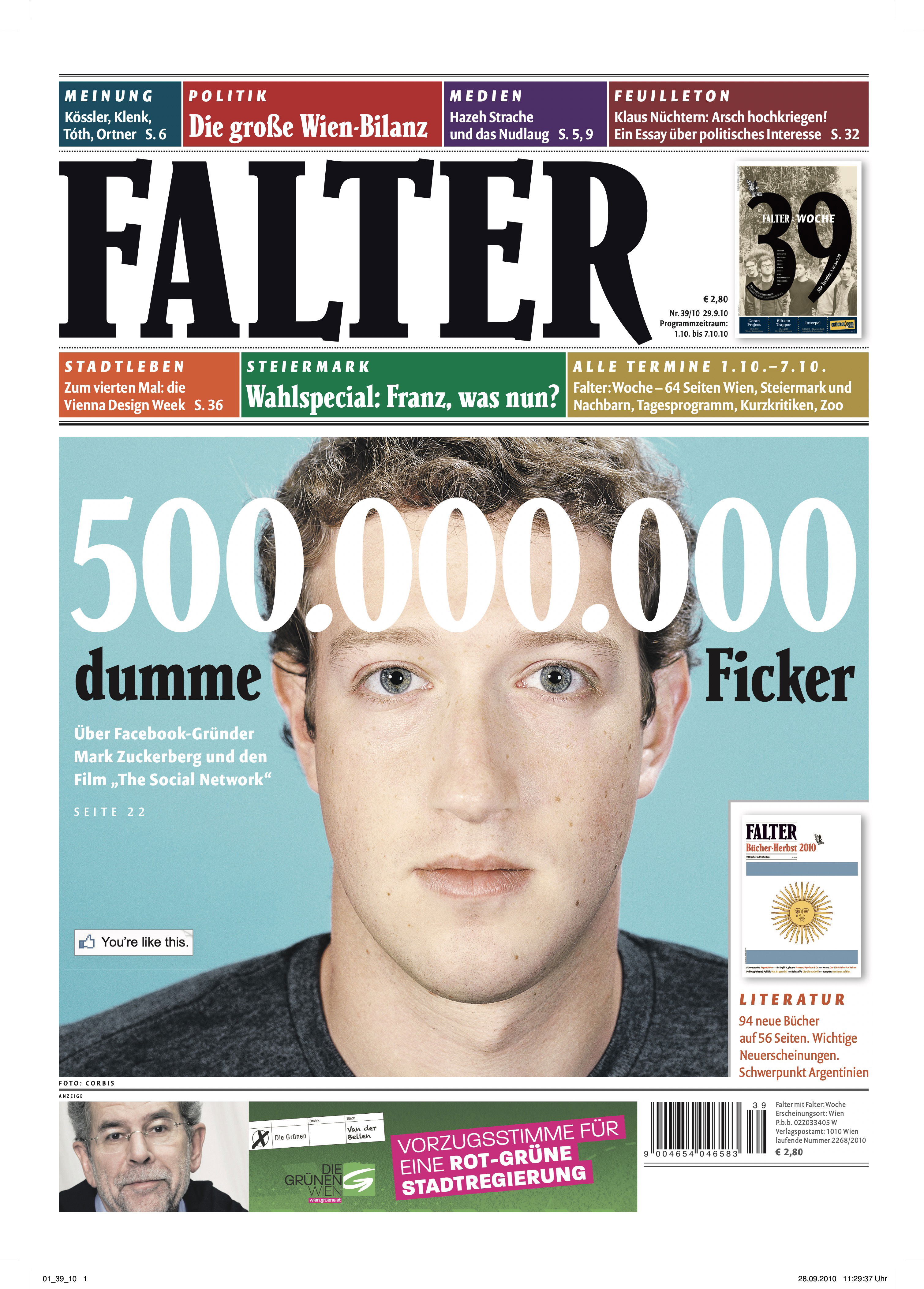
Vertuschen, verschweigen und heimlich rauchen
Sigrid Löffler in FALTER 39/2010 vom 29.09.2010 (S. 28)
Argentinien ist eine Bruchzone zwischen Europa und Lateinamerika", bemerkt Jorge Luis Borges."Europäisch sind die Traditionen und das Lebensgefühl, lateinamerikanisch ist die Politik." Die Stichworte zur lateinamerikanischen Politik lauten seit jeher: Revolution, Staatsstreich, Junta, Caudillo, Diktatur. Allenfalls sind die autokratischen Regimes der Putschgeneräle und Militärdiktatoren zwischendurch von demokratischen Intermezzi durchsprenkelt – und immer dann kommen in Lateinamerika die europäischen Traditionen von Vergangenheits- und Erinnerungspolitik zu ihrem Recht, immer dann ist "Memoria"-Literatur angesagt.
Die Shoah Argentiniens
Und nirgends ist diese eindringlicher und nachdrücklicher als in Argentinien. Die meisten aktuellen Romane aus dem diesjährigen Gastland der Frankfurter Buchmesse sind Erinnerungsliteratur. Thematisiert werden die nationalen Traumata der jüngeren argentinischen Geschichte: die sieben Terrorjahre nach dem Militärputsch von 1976 mit ihren willkürlichen Verhaftungen, geheimen Foltergefängnissen und Zehntausenden von "Verschwundenen" bis hin zur Niederlage der Junta im Falklandkrieg gegen England, die 1983 zum Sturz der Militärs und zur Wiedererrichtung der Demokratie führte. Seither wollen die einen die geschehenen Verbrechen vertuschen und verschweigen, während die anderen sie offengelegt und gesühnt sehen wollen. Wie die argentinische Tageszeitung Clarín neulich feststellte: "Die Militärdiktatur ist unsere Shoah."
Der Staatsterrorismus, der die systematische Ausrottung der politischen Linken im Lande zum Ziel hatte, ist das Hauptthema der Vergangenheitspolitik im postautoritären Argentinien. Davon zeugt auch die umfangreiche "Memoria"-Literatur, ein gewaltiger Erinnerungsspeicher, der den Frankfurter Auftritt des Gastlandes Argentinien beherrscht und prägt. Dabei könnten die Sichtweisen und die literarischen Darstellungsformen gar nicht unterschiedlicher, die Gestaltungsweisen des Themas gar nicht vielfältiger sein – aus der Sicht der Opfer, aus der Sicht der Täter, aus der Sicht der Nachgeborenen; realistisch, dokumentarisch, allegorisch; als Thesenroman, als Politparabel, als autobiografische Erinnerung.
Die neuen Romane von Laura Alcoba und Martín Kohan sind gute Beispiele für ganz unterschiedliche literarische Annäherungen an das Thema. Laura Alcoba wurde 1968 in La Plata in Argentinien geboren und folgte als Zehnjährige ihrer Mutter ins Exil nach Paris, wo sie heute als Universitätsdozentin lebt. In ihrem Debütroman "Das Kaninchenhaus" erzählt sie eine autobiografische Kindheitserinnerung aus der Zeit des Militärputsches und der Verfolgung von Oppositionellen. Martín Kohan, Jahrgang 1967 und somit ein Altersgenosse Alcobas, lebt als Schriftsteller und Literaturdozent in Buenes Aires und wählt in seinem Roman "Sittenlehre" sehr subtile, indirekte Stilmittel, um von den Überlebensstrategien kleiner Mitläufer des Terrorregimes zu erzählen.
Von Todesschwadronen verfolgt
Laura Alcoba war acht Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter in den Untergrund ging. Ihre Eltern, die der revolutionären Stadtguerilla der Montoneros angehörten, wurden von den staatlichen Todesschwadronen verfolgt, ihr Vater wurde verhaftet. Laura zog mit ihrer Mutter und einigen von deren Gesinnungsgenossen, darunter die schwangere Diana, in ein Versteck am Stadtrand von La Plata. Getarnt war das "Kaninchenhaus" als Betriebsstätte einer Kaninchenzucht; doch tatsächlich war es eine illegale Druckerei für die Flugblätter der Montoneros.
Dem kleinen Mädchen, das die Lage kaum begreift, werden einige Sicherheitsmaßregeln eingebläut. Dennoch kommt es zu potenziell gefährlichen Zwischenfällen, die Laura in ihrer Arglosigkeit verschuldet. Schließlich retten sich Laura und ihre Mutter ins Exil nach Frankreich. Kurz danach wird das Kaninchenhaus vom Militär gestürmt und völlig zerstört. Alle Bewohner, auch Diana, kommen dabei ums Leben. Erst Jahre später, als Erwachsene, erfährt Laura Alcoba, dass die Gruppe verraten wurde, und auch, wie und von wem. Die Autorin widmet ihr Buch einer Toten: "Für Diana E. Teruggi".
Wo Laura Alcoba ihre eigenen schmerzlichen Erinnerungen in aller Lückenhaftigkeit ganz direkt und ohne viel Kunstaufwand erzählt, bewahrt Martín Kohan in "Sittenlehre" einen kühlen, distanzierten Berichtston im strikten Präsens. Sein Roman erinnert daran, dass die Argentinier nicht nur Opfer, sondern auch Komplizen der Diktatur waren: Ohne Kollaborateure wäre die bleierne Zeit des Staatsterrors nicht denkbar gewesen. Kohans Kritik gilt einer Mitläufergesellschaft, die geholfen hat, die Militärjunta so lange an der Macht zu halten.
Die Schule als Kasernenhof
"Sittenlehre" ist zugleich Schulroman und politische Parabel. Schauplatz ist das Colegio Nacional, ein Elitegymnasium in Bue-
nos Aires – die Nationalschule als Schule der Nation, wo María Teresa, die junge Protagonistin, ihre neue Stelle als Aufseherin antritt. Sie soll die Ordnung, Zucht und Disziplin der Schüler kontrollieren und überwachen. Dass es in der Stadt Unruhen und Protestdemonstrationen gegen den Falklandkrieg gibt, ist kein Thema innerhalb der Schulmauern und wird totgeschwiegen.
Die Schule funktioniert wie ein Kasernenhof mit militärischem Drill und einem komplizierten Ritual täglicher Disziplinierungsmaßnahmen; hinzu kommen patriotische Feiern zur Stärkung des Nationalstolzes der Schüler. Die Aufseherin kon-
trolliert die genauen Abstände der Schüler beim Appellstehen, die Farbe der Socken, den vorschriftsmäßig kurzen Haarschnitt, und wacht darüber, dass die Schüler nicht auf der Toilette rauchen. Letzteres wird zur persönlichen Obsession: Stundenlang versteckt sich María Teresa in der Knaben-
toilette, um einen bestimmten Schüler, dessen frühreife männliche Erotik sie beunruhigt, beim Rauchen zu erwischen.
Die Toilette wird zum Ort der erotischen Verwirrung und Überwältigung für die unerfahrene und verklemmte junge Frau. Immer stärker werden ihre ambivalenten Gefühle, eine Mischung aus Ekel und Erregung, deren wahre masochistische Natur sie sich nicht eingestehen kann, bis sie schließlich vom impotenten Oberaufseher in einer Kabine brutal manuell entjungfert wird. Das Klima von Angst, Drill, Gewalt und Gewaltlust an der Nationalschule endet über Nacht, als die Junta stürzt und ein völlig neues Führungsteam die Schulleitung übernimmt.
Lesern von Elfriede Jelinek dürfte die Konstellation von "Sittenlehre" bekannt vorkommen. In seinem Mix aus Mutterfixierung und Angstlust an heimlicher Übertretung sowie in der Verklammerung von Schmutz und Sexualität, Frust, Begierde und Voyeurismus erinnert das Setting stark an "Die Klavierspielerin". Aber anders als in Jelineks Roman ist die sexuelle männliche Gewalt bei Kohan direkt politisch konnotiert. Seine Heldin bleibt auch als Zeremonienaufseherin der Schule immer ein blindes Vollzugsorgan der Staatsmacht, und die Machthaber kaschieren ihre Impotenz durch besondere Gewalttätigkeit.
1976 und die Folgen
Wenn Félix Bruzzone seinen Erzählungsband schlicht "76" betitelt, dann können seine Landsleute das Signal unschwer deuten. Alle acht Kurzgeschichten kreisen um die Generation der 1976-Geborenen – die Kinder von "Verschwundenen", wie auch der Autor selbst eines ist. Bruzzones Mutter wurde drei Monate nach seiner Geburt in einem der Geheimverliese der Luftwaffe gefoltert, danach ausgeflogen und über dem Atlantik abgeworfen. Sein Vater wurde verhaftet und ist seither ebenfalls spurlos verschwunden.
Scheinbar harmlos entwickelt Bruzzone seine Geschichten über Spurensuche nach Verschwundenen aus dem friedlichen argentinischen Alltag von heute heraus – bis plötzlich das Nichtnormale in die Normalität einbricht.
In "Haus am Strand" etwa geht es um den Ferienalltag dreier Buben, die heimlich Sexmagazine am Kiosk kaufen. Erst am Schluss wird klar, dass niemals von Eltern die Rede ist. Diese sind ebenfalls "verschwunden", die Kinder werden von den Großmüttern großgezogen. Am Strand verlustiert sich auch eine Diplomatenfamilie, die sich seinerzeit mit der Militärjunta glänzend arrangiert hat. Nur die Tochter des Hauses, die sich peinlicherweise der Stadtguerilla angeschlossen hat und in den Untergrund gegangen ist, bleibt leider verschwunden. Genauer will es die Familie gar nicht wissen. Sie tröstet sich: "Susana ist in Uruguay."
Wie aber geht es heute, mehr als 30 Jahre danach, jenen Linken, die den rechten Terror der Junta damals überlebt haben? Männern wie Carlos, dem gebrochenen, zornigen Antihelden im Roman "Wir haben uns geirrt" von Martín Caparrós, einem linken Journalisten, der 1976 ins Exil ging und heute als einer der Ton angebenden Intellektuellen seines Landes wieder in Buenos Aires lebt. Dieser Carlos, ein einstiger Studentenführer der Montoneros, dessen Frau damals wohl zu Tode gefoltert wurde und verschwunden ist, dient über weite Strecken als Sprachrohr für die bitteren Einsichten seines Autors Caparrós.
Die Wut gegen die Aussöhnung
Carlos wütet gegen den Aussöhnungsschmus, der den politischen Diskurs Argentiniens heute beherrscht. Er verabscheut die Veteranensentimentalität der linken Genossen, die sich in ihrer historischen Niederlage suhlen und in der Erinnerung an ihre Untergrundheldentaten der 70er-Jahre schwelgen, an all die Attentate, Anschläge, Entführungen, politischen Morde und Scharmützel mit der Armee. Er verachtet die Selbstzufriedenheit, mit der sie sich heute in ihrer Opfergloriole als Märtyrer der Militärdiktatur wohlig eingerichtet haben und nichts davon wissen wollen, dass es ihr linker Terror nach 1968 war, der den rechten Terror erst auf den Plan rief.
Heute hält Carlos den politischen Kampf der Linken für einen Egotrip verblendeter, wirrer Idealisten und will linke Utopien
nicht länger als Rechtfertigung für die eigenen politischen Verbrechen gelten lassen. Seine Grundthese: Die jungen Linken, die damals mit Militanz die Welt verbessern wollten, haben nur Argentiniens Katastrophe verschuldet. "Jetzt, nach all den Gefährten, die starben oder fliehen mussten, deren Leben versaut ist, steht es um Argentinien viel schlechter als damals. Kann man sich eine krassere Form des Scheiterns vorstellen?"
Seine Verbitterung hindert Carlos allerdings nicht daran, nach den Schuldigen für den Tod seiner Frau zu suchen und von Rache an den Folterknechten und Kerkermeistern von damals zu träumen. Namentlich auf Pater Fiorelli hat er es abgesehen, der damals die Folterer in den Geheimkerkern segnete und sie zu ihrem "Kreuzzug gegen das Böse" ermutigte.
"Wir haben uns geirrt" ist eine Mischung aus Thesenroman, historischer Spurensuche und Politkrimi – und ein notwendiges, sarkastisches Gegenstück zu all den Opfergeschichten über die schlimme Junta-Zeit, in denen die Täterschaft der Opfer so gerne ausgeblendet wird.